Die Begründung neuer Erklärungspflichten und der Gedanke des Vertrauensschutzes
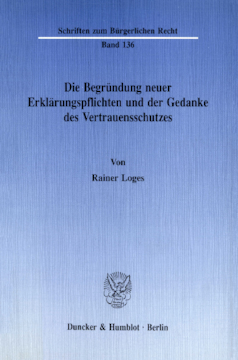
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Begründung neuer Erklärungspflichten und der Gedanke des Vertrauensschutzes
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 136
(1991)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Erster Teil: Die Entstehung neuer Erklärungspflichten | 13 | ||
| § 1 Problemstellung | 13 | ||
| I. Einführung in die Thematik | 13 | ||
| 1. „Vertrauensschutz“ als Argument in der neueren Rechtsentwicklung | 13 | ||
| 2. „Positive“ und „negative“ Vertrauenshaftung | 14 | ||
| 3. Erklärungspflichten außerhalb von Vertrag und culpa in contrahendo | 15 | ||
| II. Die Begründung von Schadensersatzpflichten mit Hilfe des Vertrauensschutzgedankens in der Rechtsprechung | 16 | ||
| 1. Culpa in contrahendo und der Gedanke des Vertrauensschutzes | 16 | ||
| 2. Die Rechtsprechung zur Auskunftshaftung | 17 | ||
| 3. Die Erweiterung des verantwortlichen Personenkreises | 20 | ||
| a) Der „Sachwalter“ | 20 | ||
| b) Prospekthaftung | 20 | ||
| III. Das Institut der Vertrauenshaftung in der Literatur | 22 | ||
| 1. Auskunftshaftung | 22 | ||
| 2. Produzentenhaftung | 22 | ||
| 3. Haftung für Werbeaussagen | 23 | ||
| 4. Die Vertrauenshaftung als eigenständiges Rechtsinstitut | 23 | ||
| IV. Der Gegenstand dieser Untersuchung | 25 | ||
| 1. Die Reichweite der Fragestellung | 25 | ||
| 2. Grundlage und Ausgestaltung der Vertrauenshaftung | 26 | ||
| 3. Wertungsgrundlagen und tatbestandliche Konturierung | 28 | ||
| § 2 Verhaltenspflichten und das System subjektiver Rechte | 29 | ||
| I. Zum Begriff des subjektiven Rechts | 30 | ||
| II. Die beiden Wege zum Schutz von Vermögensinteressen | 32 | ||
| 1. Die rechtstechnischen Möglichkeiten | 32 | ||
| 2. Rechtsschutz und Institutionenschutz | 32 | ||
| 3. Folgerungen für die vertrauenstheoretische Pflichtbegründung | 34 | ||
| Zweiter Teil: Die „Vertrauenshaftung“ | 37 | ||
| § 3 Der Gegenstand des Vertrauens | 37 | ||
| I. Begriff des Vertrauens | 37 | ||
| II. Der Gegenstand des Vertrauens in den Fällen der „Vertrauenshaftung“ | 38 | ||
| 1. Vertrauen in Erklärungen | 38 | ||
| 2. Der Gegenstand des Vertrauens bei der culpa in contrahendo | 39 | ||
| a) Aufklärungspflichten | 39 | ||
| b) Abbruch von Vertragsverhandlungen | 40 | ||
| c) Schutzpflichten | 40 | ||
| 3. Zusammenschau | 41 | ||
| III. Der Gegenstand des Vertrauens in den Vertrauensschutzbestimmungen des BGB | 43 | ||
| 1. Vertrauensschützende Bestimmungen im BGB | 43 | ||
| 2. Charakteristika | 44 | ||
| a) Einstandspflicht für den Schein einer bestimmten Rechtslage | 44 | ||
| b) Mehrere erlaubte Möglichkeiten | 44 | ||
| c) Die Funktion der Bestimmungen: Integritäts- oder Dispositionsschutz | 45 | ||
| IV. Analoge Anwendung des § 122 BGB? | 46 | ||
| V. Der fehlende Vertrauenstatbestand | 47 | ||
| § 4 Die Vertrauensbeziehung | 48 | ||
| I. Vertrauensbeziehung statt Vertrauenstatbestand | 48 | ||
| 1. Die Entwicklung der Vertrauensbeziehung im Gefolge der culpa in contrahendo | 48 | ||
| 2. Vertrauensverhältnis und Interessenwiderstreit | 51 | ||
| II. Vertrauensverhältnisse und Gesetz | 52 | ||
| § 5 Die Schutzwürdigkeit von Vertrauen | 54 | ||
| I. Der Vertrauensbegriff in der Ethik | 54 | ||
| II. Vertrauen als Rechtswert | 56 | ||
| 1. Das „rechtsethische Prinzip“ des Vertrauensschutzes | 56 | ||
| 2. Schutz nur des „berechtigten“ Vertrauens | 57 | ||
| 3. Kritik der Lehren vom „berechtigten Vertrauen“ | 60 | ||
| a) Allgemeines | 60 | ||
| b) Die Lehre v. Craushaars | 61 | ||
| III. Die Konzepte der sozialen Rolle | 65 | ||
| 1. Vorschläge in der rechtssoziologischen Literatur | 65 | ||
| 2. Die Legitimation der Rollenerwartungen | 66 | ||
| 3. Theorien der Selbstbindung durch Versprechen | 67 | ||
| IV. Folgerungen | 69 | ||
| § 6 Zum Tatbestand einer negativen Vertrauenshaftung | 70 | ||
| I. „Subjektive“ und „objektive“ Tatbestandsformulierung | 70 | ||
| 1. Vertrauensprinzip und Vertrauensgrundsatz | 70 | ||
| 2. Tatbestandsformulierungen bei der culpa in contrahendo | 71 | ||
| II. Die Eignung des Vertrauens als Tatbestandsmerkmal | 74 | ||
| 1. Der Zeitpunkt des Vorliegens von Vertrauen | 74 | ||
| 2. Die Stellung des Vertrauens im System der Vertrauenshaftung sowie der Delikts- und Vertragshaftung | 75 | ||
| 3. Vertrauen als in Verbindung mit anderen Faktoren haftungsbegründendes Moment | 77 | ||
| III. Tatsächlich vorliegendes und „normatives“ Vertrauen | 78 | ||
| IV. Der Zirkelschluß in der Argumentation | 80 | ||
| 1. Die Sonderbehandlung der Vertrauenshaftung | 80 | ||
| 2. Vertrauen als Schutzziel | 82 | ||
| 3. Vertrauensschutz und Rechtsschutz | 83 | ||
| V. Die „Vertrauenshaftung“ und der Aspekt der Rechtssicherheit | 84 | ||
| VI. Zusammenfassung zur negativen Vertrauenshaftung | 86 | ||
| Dritter Teil: Andere Geltungsgründe für eine Erklärungshaftung außerhalb von Vertrag und culpa in contrahendo | 88 | ||
| § 7 Gründe für eine Erklärungshaftung als Gründe für Vertrauensschutz | 88 | ||
| § 8 Argumente aus der Sonderverbindung | 91 | ||
| I. Vertrauenshaftung als Korrelat zur Privatautonomie | 91 | ||
| 1. Die Verantwortung als Ausgleich zur rechtsgeschäftlichen Freiheit | 91 | ||
| 2. Die Verantwortung als Ausgleich für die Schaffung besonderer Risiken | 93 | ||
| a) Risiken des Rechtsgeschäftes | 93 | ||
| b) Der soziale Kontakt | 94 | ||
| c) Die Lehre J. Schmidts | 94 | ||
| 3. Kritik | 96 | ||
| a) Die besondere Einwirkungsmöglichkeit | 96 | ||
| b) Ein Korrelat zur Freiheit? | 99 | ||
| c) Die Funktion des Korrelatsgedankens | 100 | ||
| II. Vertrauenshaftung zur Sicherung der Selbstbestimmung | 100 | ||
| 1. Die Gewährleistung der inhaltlichen Richtigkeit von Verträgen | 100 | ||
| a) Literaturstimmen | 100 | ||
| b) „Richtigkeitsgewähr“ des Vertrages? | 101 | ||
| c) Vertrauenshaftung zur Sicherung der materiellen Selbstbestimmung | 103 | ||
| 2. Kein Ausgleich individueller Vertragsdisparität | 104 | ||
| III. Die generelle Problematik der Anlehnung einer Erklärungshaftung an die einzelne Sonderbeziehung | 105 | ||
| 1. Die Ansicht Pickers | 105 | ||
| 2. Die Lösung jeder Erklärungshaftung vom einzelnen Rechtsgeschäft | 106 | ||
| IV. Das Modell Pickers: „neminem laedere“ in Sonderverbindungen | 110 | ||
| 1. Darstellung | 110 | ||
| 2. Kritik | 112 | ||
| V. Folgerungen | 114 | ||
| § 9 Vertrauensschutz als Instrument zum Schutze des sozial Schwächeren | 115 | ||
| I. Argumente aus dem Sozialstaatsprinzip | 115 | ||
| 1. Rechtsprechung und Literatur zum Einfluß des Sozialstaatsprinzips auf das Privatrecht | 116 | ||
| a) Sozialstaatsgemäße Privatrechtsordnung | 116 | ||
| b) Der Inhalt des Sozialstaatsprinzips im Privatrecht | 117 | ||
| c) Die Eignung zur Begründung der Erklärungshaftung | 118 | ||
| 2. Privatrechtssetzung und Sozialstaatsprinzip | 120 | ||
| a) Privatrecht als staatliches Recht | 120 | ||
| b) Das Eingriffssubjekt | 122 | ||
| c) Schutzpflichten des Staates? | 123 | ||
| II. Formulierung von Pflichten zum Schutze des Schwächeren | 125 | ||
| 1. Haftung aus „organisiertem sozialen Kontakt“ | 125 | ||
| a) Die „organisierte Verantwortungslosigkeit“ | 125 | ||
| b) Kritik | 127 | ||
| 2. Allgemeiner: Machtausgleich durch Vertrauensschutz? | 128 | ||
| § 10 Vertrauensschutz, Rechtsverkehr und Markt | 130 | ||
| I. Vertrauensschutz als Instrument zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Rechtsverkehrs | 131 | ||
| 1. Die Entbehrlichkeit von Vorsichtsmaßnahmen | 131 | ||
| 2. Vertrauenshaftung zwecks Minimierung von Transaktionskosten im Sinne der „economic analysis of law“ | 133 | ||
| a) Vorschläge in der Literatur | 133 | ||
| b) Zur Methode der ökonomischen Analyse des Rechts | 135 | ||
| 3. Die Herstellung von Waffengleichheit am Markt | 139 | ||
| 4. Verbraucherschutz | 140 | ||
| II. Gegeneffekte: Die Behinderung des Rechtsverkehrs durch die Vermeidung einer Vertrauenserregung | 142 | ||
| 1. Aufklärung bei bestehender Aufklärungspflicht | 143 | ||
| 2. Überwiegend im Fremdinteresse abgegebene Erklärungen | 144 | ||
| 3. Zufällig und geplant erlangte Informationen | 145 | ||
| III. Folgerungen | 146 | ||
| § 11 Das Konzept einer Berufshaftung | 146 | ||
| I. Vorschläge in der Literatur | 146 | ||
| II. Die Legitimation der Berufshaftung | 149 | ||
| 1. Legitimation durch die berufsregelnden Gesetze | 149 | ||
| 2. Die „Optimierung am Markt“ | 150 | ||
| 3. Die Förderung des Berufsstandes | 151 | ||
| III. Der Nutzen des Kriteriums „Beruf“ | 151 | ||
| Vierter Teil: Erklärungspflichten als Verkehrspflichten zum Schutze des Rechtsverkehrs | 154 | ||
| § 12 Grundelemente der Rechtfertigung neuer Erklärungspflichten | 154 | ||
| I. Der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit im Rechtsverkehr | 154 | ||
| II. Der Gesichtspunkt der Sozialisierbarkeit des Risikos | 157 | ||
| III. Die Begründung für neue Erklärungspflichten: Der Schutz von Rechtsverkehr und Markt | 160 | ||
| 1. Die Behinderung des Rechtsverkehrs durch Angst und Vorsicht | 160 | ||
| 2. Die Sicherung des Gleichgewichtes am Markt | 162 | ||
| IV. Die einzelnen Bestimmungsgrößen für die Erklärungspflichten | 162 | ||
| 1. Kollektive Machtungleichgewichte | 163 | ||
| 2. Handeln im Bezug zu Rechtsverkehr und Markt | 163 | ||
| 3. Der Aspekt der Entgeltlichkeit | 164 | ||
| 4. Die Problematik der primär im Fremdinteresse und ohne Rechtspflicht erteilten Auskünfte | 166 | ||
| 5. Aufklärungspflichten und Wahrheitspflichten | 167 | ||
| V. Die Funktion des Vertrauens bei der Begründung neuer Erklärungspflichten | 168 | ||
| § 13 Die Ausgestaltung der Haftung | 171 | ||
| I. Vertragshaftung, Deliktshaftung oder „Dritter Weg“? | 171 | ||
| 1. Allgemeines | 171 | ||
| 2. Die Abkehr von der rechtlichen Sonderverbindung | 172 | ||
| 3. Sicherung des Rechtsverkehrs als Aufgabe des Deliktsrechts | 172 | ||
| II. Erklärungspflichten als Verkehrspflichten zum Schutze fremden Vermögens | 176 | ||
| 1. Möglichkeiten der Fortbildung des § 823 II BGB | 176 | ||
| 2. Die Einordnung in das bestehende System der Verkehrspflichten | 178 | ||
| III. Rechtsfortbildung ohne Grenzen? | 181 | ||
| 1. Die Offenheit des § 823 II BGB | 181 | ||
| 2. Die Formulierung abstrakt-genereller Tatbestände durch den Richter | 183 | ||
| 3. Legitimationszwang durch offene Rechtsfortbildung | 184 | ||
| IV. Neue Verkehrspflichten und culpa in contrahendo | 185 | ||
| V. Das Problem der „Haftungslücken“ | 187 | ||
| § 14 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse | 190 | ||
| I. Die Begründung neuer Erklärungspflichten | 190 | ||
| II. Die Anwendung dieses Konzeptes auf die Ausgangsfälle | 191 | ||
| 1. Außervertragliche Auskünfte | 191 | ||
| 2. Sachwalter | 192 | ||
| 3. Prospekthaftung | 192 | ||
| 4. Weitere Fälle | 193 | ||
| Literaturverzeichnis | 194 |
