Bildung, Bildungsfinanzierung und Einkommensverteilung II
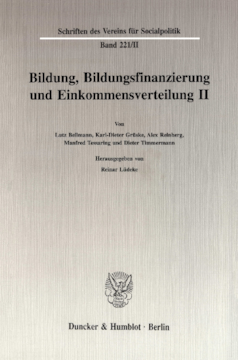
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Bildung, Bildungsfinanzierung und Einkommensverteilung II
Editors: Lüdeke, Reinar
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Vol. 221/II
(1994)
Additional Information
Book Details
Abstract
Mit diesem Band wird der zweite Teil der Untersuchungen vorgelegt, die der Bildungsökonomische Ausschuß in den vergangenen Jahren zum Themenkomplex »Bildung, Bildungsfinanzierung und Einkommensverteilung« diskutiert hat. In den drei Beiträgen dieses Sammelbandes, die die Autoren auf der Jahrestagung 1992 in Nürnberg präsentierten, stehen vor allem Anwendungen theoretischer Überlegungen auf der Grundlage reicher empirischer Befunde für die Bundesrepublik Deutschland im Mittelpunkt. Daß dabei die Hochschulausbildung eine besonders große Rolle spielt, ist nicht verwunderlich. Zum einen verband man mit der jetzt eingetretenen starken Expansion der Hochschulabsolventen häufig die Erwartung, daß die Einkommensunterschiede zwischen den Arbeitskräften mit unterschiedlichen Bildungsqualifikationen zusammenschmelzen würden, zum anderen haben viele in der öffentlichen Finanzierung der akademischen Ausbildungswege, die in der Vergangenheit zu relativ hohen Arbeitseinkommen führten, schon lange ein distributionspolitisches Problem gesehen.Bellmann, Reinberg und Tessaring gehen in ihrem Beitrag der Frage nach, ob sich mit der Bildungsexpansion zwischen 1961 und 1991 und mit den Änderungen der bildungsmäßigen Qualifikationsstrukturen zwischen 1976 und 1989 die bildungsbedingten Einkommensabstände und Bildungsrenditen gesenkt haben. Die Antwort ist durchweg negativ. Umso gewichtiger werden die Untersuchungen von Grüske und Timmermann, die den Verteilungskonsequenzen der Finanzierung der Hochschulausbildung - bei unterstellter Konstanz der Markteinkommen - auf der Grundlage neuerer Daten (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe sowie Mikrozensus) nachgehen. Die Analyse erfolgt sowohl aus der Perspektive der Eltern als auch aus der Sicht der entsprechend ausgebildeten Arbeitskräfte. Bei Grüske stehen die gesamten steuerfinanzierten öffentlichen Hochschulausgaben, bei Timmermann gebührenfinanzierte zusätzliche Ausgaben im Mittelpunkt. Trotz unterschiedlicher Vorgehensweisen stimmen A
