Haftungsbegründung und Schuldbefreiung bei §§ 415, 416 BGB
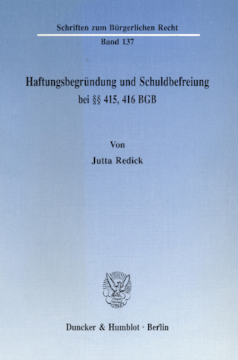
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Haftungsbegründung und Schuldbefreiung bei §§ 415, 416 BGB
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 137
(1991)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung | 11 | ||
| Teil 1: Die Problematik der herrschenden Schuldübernahmetheorie | 13 | ||
| A. Grundaussage der Verfügungstheorie | 13 | ||
| B. Die in der Praxis relevanten Fälle rechtsgeschäftlicher Schuldübernahme | 15 | ||
| I. Vorbemerkung | 15 | ||
| II. Fallgruppen | 15 | ||
| 1. Vermögensübernahme | 15 | ||
| 2. Übernahme eines Geschäftsbetriebes | 16 | ||
| 3. Kauf hypothekenbelasteter Grundstücke | 17 | ||
| III. Folgerungen für eine Auslegung des § 415 BGB | 18 | ||
| 1. Der Sacherwerb als Schuldübernahmemotiv | 18 | ||
| 2. Übernehmerhaftung und Altschuldnerentlassung als voneinander getrennte Vorgänge | 19 | ||
| C. Die Unzulänglichkeiten im theoretischen Ansatz der Verfügungskonstruktion | 19 | ||
| I. Das Einwendungsproblem | 19 | ||
| 1. § 417 II BGB – Kausalvereinbarung und “dingliche Verfügung” | 19 | ||
| 2. Herkömmliche Lösungswege zur Gleichstellung der §§ 414 und 415 BGB | 21 | ||
| 3. Kritik | 22 | ||
| II. Der Parteiwille | 23 | ||
| III. Das Problem der “Einrede des nichterfüllten Vertrages” | 25 | ||
| IV. Die dogmatische Konstruktion | 25 | ||
| D. Untersuchungsziel | 27 | ||
| Teil 2: Die Schuldübernahme beim Grundstückserwerb | 29 | ||
| A. Die Entwicklung in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Wissenschaft vor Inkrafttreten des BGB | 29 | ||
| I. Vorbemerkung | 29 | ||
| II. Das preußische Recht | 29 | ||
| 1. Rechtslage und praktische Entwicklung vor der Deklaration vom 21. 3. 1835 | 29 | ||
| 2. Die Deklaration vom 21. 3. 1835 | 31 | ||
| 3. § 41 pr. EEG vom 5. 5. 1872 | 33 | ||
| a) Inhalt und gesetzgeberische Motivation | 33 | ||
| b) Auslegung der Norm | 35 | ||
| aa) Dogmatische Einordnung des Gläubigerrechts | 35 | ||
| bb) Die Haftung des Übernehmers “als Grundstückserwerber” | 36 | ||
| cc) Unwiderruflichkeit des Gläubigerrechts | 37 | ||
| dd) Das Einwendungsproblem | 37 | ||
| ee) Das Problem der Altschuldnerbefreiung | 38 | ||
| III. Das bayrische Recht | 40 | ||
| 1. § 56 HypG von 1822 | 40 | ||
| a) Gesetzesmotivation (Auslegung v. Gönners) | 40 | ||
| b) Praktische Schwierigkeiten und Auslegungsprobleme | 41 | ||
| aa) Die Anrechnungsabrede als bloße Einverständniserklärung mit dem Stehenbleiben der dinglichen Belastung | 42 | ||
| bb) Kein unmittelbares Klagerecht des Gläubigers, sondern bloßes “Recht auf Beitritt” | 42 | ||
| cc) Die Anrechnungsabrede als bloße “Zahlungsübernahme” | 43 | ||
| 2. Art. 1 Ziff. 2 bayr. Gesetz vom 29. 5. 1886 | 44 | ||
| a) Funktion der Regelung als Ergänzung zu § 56 HypG | 44 | ||
| b) Neuerungen | 45 | ||
| aa) Erleichterte Altschuldnerbefreiung | 45 | ||
| bb) Widerruflichkeit des Gläubigerrechts | 46 | ||
| 3. Quintessenz der novellierten Fassung des § 56 HypG | 47 | ||
| a) Voraussetzungen der Ubernehmerhaftung | 47 | ||
| b) Altschuldnerbefreiende Modifikationen | 47 | ||
| 4. Fehlinterpretationen der gesetzlichen Regelung | 48 | ||
| IV. Sonstige partikularrechtliche Regelungen | 50 | ||
| V. Die gemeinrechtlichen Schuldübernahmetheorien | 52 | ||
| 1. Die Begründung des heutigen “Schuldübernahmebegriffs” durch Delbrück | 52 | ||
| a) Verdienste der Delbrückschen Abhandlung | 52 | ||
| b) Die “Zessionsanalogie” | 54 | ||
| 2. Die Verfügungstheorie | 55 | ||
| a) Entwicklung aus der Delbrückschen Terminologie | 55 | ||
| b) Praktische Mängel der Theorie | 56 | ||
| aa) Vernachlässigung der Vermögensübernahmekomponente bei der Erwerberhaftung | 56 | ||
| bb) Ungewollt haftungskonstitutive Gläubigerbeteiligung | 57 | ||
| c) Fazit | 59 | ||
| 3. Das Scheitern einer Konstruktion anhand des Vertrages zugunsten Dritter | 59 | ||
| a) Streit um die Notwendigkeit einer Gläubigerbeteiligung | 60 | ||
| b) Unklarheiten hinsichtlich der Anerkennung eines Schuldbeitritts im heutigen Sinne | 60 | ||
| c) Das Argument des “Rechtsaustauschs” | 60 | ||
| d) Die Widerruflichkeitsproblematik | 62 | ||
| 4. Die Kollektivofferten- sowie Vertragstheorie | 62 | ||
| a) Schuldsukzession nur durch Gläubigervertrag | 62 | ||
| b) Stellungnahme zu den in der Praxis relevanten Schuldübernahmefällen | 63 | ||
| c) Kritik | 64 | ||
| 5. Fazit | 65 | ||
| B. Die Entstehung der §§ 415–417 BGB: Gesetzeswortlaut und Gesetzgeberwille | 65 | ||
| I. Vorbemerkungen zur Auslegung | 65 | ||
| II. Der Vorentwurf v. Kübels zum Obligationenrecht, Nr. 26 §§ 1–5 | 66 | ||
| III. Die Entwicklung der §§ 315, 316 E I BGB (entsprechend den heutigen §§ 415, 417 BGB) | 69 | ||
| 1. Dogmatische Konstruktion | 69 | ||
| 2. Eigentliche Regelungsmotivation | 70 | ||
| a) Funktion der Genehmigung | 70 | ||
| b) Funktion der Mitteilung | 71 | ||
| 3. Fazit | 72 | ||
| IV. Die Entwicklung des § 318 E I BGB (entsprechend dem heutigen § 329 BGB) | 73 | ||
| 1. § 318 I E I BGB: Auslegungsregel zugunsten der Erfüllungsübernahme | 73 | ||
| 2. § 318 II E I BGB: Sondernorm für Kaufanrechnungsabreden | 74 | ||
| a) Auslegung als Schuldübernahme | 74 | ||
| b) Ablehnung einer Sonderbestimmung für den Grundstücksverkehr | 75 | ||
| 3. Fazit | 76 | ||
| V. Kritik an der Schuldübernahmeregelung des ersten Entwurfs | 77 | ||
| 1. Vorbemerkung | 77 | ||
| 2. Mängel der dogmatischen Konstruktion | 78 | ||
| 3. Verbesserungsvorschläge zu § 315 E I BGB | 78 | ||
| 4. Forderung nach einer Sondernorm für den Grundstücksverkehr | 79 | ||
| VI. Das weitere Gesetzgebungsverfahren | 80 | ||
| 1. Entwicklung und Bedeutung des § 415 BGB in seiner heutigen Fassung | 80 | ||
| a) Die “objektive Bindung” des Übernehmers | 80 | ||
| b) Das Mitteilungserfordernis | 81 | ||
| c) Das Fristsetzungsrecht beider Parteien | 82 | ||
| d) Fazit | 83 | ||
| 2. § 417 BGB | 83 | ||
| 3. Die Sondernorm des § 416 BGB für Fälle der Hypothekenübernahme beim Grundstückserwerb | 84 | ||
| a) Das Erfordernis des Grundstücksübergangs vor erfolgter Mitteilung | 85 | ||
| b) Die ausschließliche Mitteilungsbefugnis des Altschuldners | 86 | ||
| c) Die Anlehnung an partikularrechtliche Vorschriften zur Hypothekenübernahme | 87 | ||
| 4. Fazit | 88 | ||
| C. Eigene Konstruktion der Schuldübernahme beim Kauf hypothekenbelasteter Grundstücke | 88 | ||
| I. Die Haftung des Übernehmers | 88 | ||
| II. Die Entlassung des Altschuldners | 89 | ||
| III. Das gemeinsame Aufhebungsrecht der Parteien | 90 | ||
| IV. Die Einwendungsproblematik | 90 | ||
| Teil 3: Die Schuldübernahme beim Geschäftserwerb | 92 | ||
| A. Vorbemerkung | 92 | ||
| B. Der Geschäftserwerb als Haftungsvoraussetzung | 93 | ||
| I. Die Ausführungen des Gesetzgebers | 93 | ||
| II. Die gesetzgeberische Motivation vor dem Hintergrund der Gesamtproblematik einer “Schuldenhaftung des Geschäftserwerbers” | 94 | ||
| C. Die Anrechnungsabrede als unmittelbar haftungsbegründender Schuldbeitritt | 96 | ||
| I. Die Ausführungen des Gesetzgebers | 96 | ||
| II. Die Anrechnungsabreden im Rahmen der Gesamtproblematik einer “Schuldenhaftung des Geschäftserwerbers” | 97 | ||
| 1. Vertragliche Übernahmevereinbarungen als zum Geschäftserwerb hinzutretendes Haftungsmerkmal | 97 | ||
| 2. Öffentliche Bekanntmachung und Firmenfortführung | 99 | ||
| 3. Einflüsse der gemeinrechtlichen Dogmatik | 101 | ||
| III. Ergebnis | 102 | ||
| D. Konsequenzen der Untersuchung | 103 | ||
| Teil 4: Zusammenfassung und Ergebnisse | 105 | ||
| A. Der Schuldbeitritt als Ausgangspunkt einer privativen Schuldübernahmekonstruktion | 105 | ||
| B. Die Funktion der §§ 415, 416 BGB | 109 | ||
| I. Privative Wirkung vertraglicher Übernahmeabreden | 109 | ||
| II. Das Verhältnis zwischen “privativer” und “kumulativer” Schuldübernahme beim Sacherwerb | 112 | ||
| C. Die Funktion des § 417 II BGB | 114 | ||
| Schlußwort | 116 | ||
| Anhang | 117 | ||
| Literaturverzeichnis | 121 |
