Die Gesamtschuld
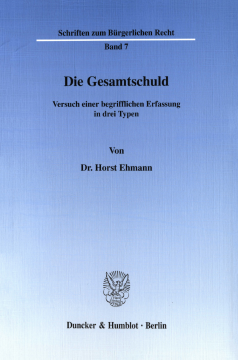
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Gesamtschuld
Versuch einer begrifflichen Erfassung in drei Typen
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 7
(1972)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorrede | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 11 | ||
| Erstes Kapitel: Strukturanalyse | 23 | ||
| § 1 Einleitung | 23 | ||
| I. Die Hauptstrukturen der Gesamtschuldregelung des BGB | 23 | ||
| II. Die Angst vor den Rechtsfolgen der Gesamtschuld | 25 | ||
| III. Die geschichtliche Entwicklung der Gesamtschuld | 28 | ||
| A. Im gemeinen Recht | 28 | ||
| 1. Die Unterscheidung zwischen Korreal- und Solidarobligationen | 28 | ||
| 2. Das Regreßproblem | 31 | ||
| 3. Einheits- und Mehrheitstheorie | 31 | ||
| B. Die Gesamtschuld im römischen Recht | 36 | ||
| 1. Ziel der Darstellung | 36 | ||
| 2. Die Entwicklung des Gesamtschuldbegriffs im römischen Recht | 37 | ||
| 3. Die Entdeckung anderer Fälle „unächter Correalität“ | 40 | ||
| 4. Die Lehren aus der geschichtlichen Entwicklung der Korrealschuld | 41 | ||
| IV. Methodologischer Exkurs | 42 | ||
| V. Das sogenannte Wesen der Gesamtschuld | 44 | ||
| § 2 Die Bestimmung der Voraussetzungen einer Gesamtschuld | 48 | ||
| I. Die Suche nach dem einheitlichen Begriff | 48 | ||
| II. Das Merkmal der sogenannten Zweckgemeinschaft | 50 | ||
| 1. Die vieldeutige Zauberformel | 50 | ||
| 2. Hilfreiche Krücke der Rechtsentwicklung | 51 | ||
| 3. Die Angst vor dem „falschen“ Regreß | 52 | ||
| 4. Die Zweckgemeinschaft als „quasi-konkretes“ Rechtsverhältnis | 53 | ||
| 5. Der Bedeutungswandel der „Zweckgemeinschaft“ von Enneccerus bis Lehmann | 54 | ||
| 6. Das theoretische Fehlverständnis des Zweckbegriffs | 57 | ||
| 7. Das Merkmal „Zweckgemeinschaft“ in der Rechtsprechung des RG und des BGH | 59 | ||
| III. Das Erfordernis der Gleichstufigkeit (Gleichrangigkeit) der Verpflichtungen | 62 | ||
| 1. Wieder: Die Angst vor dem „falschen“ Regreß | 62 | ||
| 2. Die „Studie“ Selbs | 62 | ||
| 3. Die Hilfsregel des § 426 Abs. I Satz 1 | 64 | ||
| 4. Die Bedeutung des Begriffs „zweistufige Solidarität“ bei Rabel | 65 | ||
| 5. Die Bedeutung des Begriffs „Gleichstufigkeit“ bei Rud. Schmidt | 66 | ||
| IV. Das Erfordernis einer sogenannten Tilgungs- bzw. Erfüllungsgemeinschaft | 67 | ||
| 1. Allgemeines | 67 | ||
| 2. Die Funktion der „wechselseitigen Tilgungsgemeinschaft“ | 68 | ||
| a) Abgrenzung der Gesamtschuld zu cessio-legis-Fällen | 68 | ||
| b) Abgrenzung zu Fällen des § 255 | 69 | ||
| 3. Voraussetzung und Funktion der „Tilgungsgemeinschaft“ bei Leonhard | 71 | ||
| 4. Die Voraussetzungen der „Tilgungsgemeinschaft“ bei Larenz | 73 | ||
| 5. Das Erfordernis der sogenannten Erfüllungsgemeinschaft (Selb, Frotz) | 76 | ||
| § 3 Mittilgung und Regreß als Rechtswirkungen der Gesamtschuld | 79 | ||
| I. Allgemeines | 79 | ||
| II. Die Mittilgung (§ 422) | 80 | ||
| 1. Die Auffassung des gemeinen Rechts | 80 | ||
| 2. Das Fortwirken der gemeinrechtlichen Auffassung im Recht des BGB | 81 | ||
| 3. Die Erfüllungslehre und der Obligations- und Zweckbegriff Hartmanns | 82 | ||
| III. Der Regreß (§ 426) | 88 | ||
| 1. Savignys Auffassung | 88 | ||
| 2. Das gemeine Recht und die Motive des BGB-Entwurfs | 90 | ||
| 3. Die Auffassung zum Recht des BGB | 92 | ||
| IV. Die Zusammenschau von Voraussetzungen und Wirkungen der Gesamtschuld | 97 | ||
| 1. Die Gesamtschuld als Sicherungssystem für den Gläubiger | 97 | ||
| 2. Das Schuldnerschutzsystem der Gesamtschuld | 98 | ||
| a) Der Regreß als notwendiges Korrelat der Mehrfachverpflichtung | 98 | ||
| b) Die Mittilgung als notwendiges Korrelat der Mehrfachverpflichtung | 100 | ||
| c) Das kommunizierende System der §§ 422, 426 II | 102 | ||
| 3. Noch einmal: Das Wesen der Gesamtschuld | 102 | ||
| a) Das Rätsel der soweit-Regel des § 426 I, 1 | 103 | ||
| b) Die Rechtsnatur der Regeln der §§ 422, 426 BGB | 106 | ||
| aa) § 422 im einzelnen | 107 | ||
| bb) Regreßanspruch (§ 426) | 108 | ||
| cc) Die cessio legis (§ 426 II) | 111 | ||
| § 4 Zusammenfassung des 1. Kapitels | 112 | ||
| Zweites Kapitel: Die Kriterien zur Unterscheidung der verschiedenen Schuld- und Gesamtschuldverhältnisse | 118 | ||
| § 5 Die uneinheitlichen Gründe für die gesamtschuldnerische Verbindung mehrerer Schuldverhältnisse | 118 | ||
| I. Warum entstehen Gesamtschuldverhältnisse? | 118 | ||
| 1. Die Fragestellung | 118 | ||
| 2. Klingmüllers Denkansatz | 119 | ||
| 3. Plan der folgenden Darstellung | 121 | ||
| II. Warum entstehen Einzelschuldverhältnisse? | 122 | ||
| 1. Allgemeines | 122 | ||
| 2. Erwerbsansprüche und Schutzansprüche | 122 | ||
| 3. Die Zwecke der Erwerbsansprüche (Einführung) | 123 | ||
| 4. Die Schutzansprüche | 124 | ||
| III. Warum werden mehrere Einzelschuldverhältnisse zu einem Gesamtschuldverhältnis verbunden? | 125 | ||
| 1. Die Differenzierung der Fragestellung | 125 | ||
| 2. Die verschiedenen Fallgruppen | 126 | ||
| 3. Die verschiedenen Antworten | 127 | ||
| 4. Einige Konsequenzen aus der Differenzierung | 128 | ||
| a) Die verschiedene Art der Beteiligung am Schuldverhältnis | 128 | ||
| b) Die verschiedenen Kriterien zur Bestimmung des Innenverhältnisses | 129 | ||
| § 6 Grundriß einer Lehre vom Zweck der Güterbewegung und des Güterschutzes (causa-Lehre) | 130 | ||
| I. Einführung | 130 | ||
| 1. Die juristische Aufgabe | 130 | ||
| 2. Die historische Entwicklung der causa-Lehre (Skizze) | 131 | ||
| 3. Die zeitgenössische causa-Lehre | 133 | ||
| 4. Hinweis auf ein „vergessenes“ System | 133 | ||
| II. Grundprinzipien des Schuldrechts (Thesen) | 134 | ||
| A. Allgemeines | 134 | ||
| B. Thesen | 135 | ||
| 1. Unterscheide Schutz- und Erwerbsansprüche | 135 | ||
| 2. Austausch- und Liberalitätszweck | 135 | ||
| 3. Handgeschäfte und Versprechensverträge | 135 | ||
| 4. Versprechensvertrag und Abwicklungsgeschäft | 136 | ||
| 5. Der Zweck als Inhaltsbestimmung | 136 | ||
| 6. Die Abwicklungszwecke | 136 | ||
| 7. Die geschlossene Zahl der Grundformen: Austausch-, Liberalitäts- und Abwicklungszwecke | 136 | ||
| 8. Alle Zwecke bedürfen der Vereinbarung | 136 | ||
| 9. Die Mischung der Zwecke | 136 | ||
| 10. Die Staffelung der Zwecke | 137 | ||
| 11. Der Leistungsbegriff | 137 | ||
| 12. Die Abhängigkeit der Rechtsgeschäfte von ihrem Zweck | 137 | ||
| 13. Der Schutzzweck | 137 | ||
| III. Motiv und Zweck | 138 | ||
| 1. Die Typisierung der Zwecke | 138 | ||
| 2. Die Zweckvereinbarung | 139 | ||
| 3. Die historischen Abgrenzungsversuche | 141 | ||
| 4. Die normative Abgrenzung durch Typisierung und Vereinbarung | 142 | ||
| IV. Formen, Arten und Zwecke der Güterbewegung | 144 | ||
| 1. Es gibt Realverträge (Handgeschäfte) | 144 | ||
| 2. Die Zwecke der Leistungsversprechen und die Leistungszwecke | 147 | ||
| 3. Typische und atypische Zwecke (Beispiele) | 150 | ||
| A. Beispiele: a–m | 150 | ||
| B. Weitere Beispiele: a–i | 151 | ||
| 4. Das Abstraktionsprinzip | 152 | ||
| a) Eine unzulässig vereinfachte Auffassung | 152 | ||
| b) Abstrakte und kausale Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte | 155 | ||
| c) Die logische Ableitung der Notwendigkeit des Zwecks der Eigentumsübertragung | 159 | ||
| d) Die Zerstörung des Systems (Stampe, Boehmer) | 163 | ||
| V. Erfüllungs- und Rechtsgrundbegriff | 164 | ||
| 1. Die sogenannte „überwiegende Lehre“ | 164 | ||
| 2. Die Erfüllungszweckvereinbarung und ihre Funktion | 164 | ||
| 3. Der Rechtsgrundbegriff bei den Leistungskondiktionen (§ 812 I, 1, 1. Alt. BGB) | 165 | ||
| 4. Der einheitliche Zweckbegriff | 168 | ||
| VI. Der Schutzzweck | 168 | ||
| VII. Angestaffelte und gemischte Zwecke | 171 | ||
| 1. Der Begriff „gestaffelter“ Zweck | 171 | ||
| 2. Gesetzliche Vertragstypen mit angestaffeltem Zweck | 172 | ||
| a) Gesellschaftsvertrag | 172 | ||
| b) Vergleich | 172 | ||
| c) Ausstattung u. a. | 173 | ||
| 3. Atypische Staffelung von Zwecken (Beispiele a–h) | 173 | ||
| 4. Die Staffelung von Schuldverhältnissen | 174 | ||
| 5. Fälle von sogenannter „Zweckerreichung, Zweckfortfall und -verfehlung“ (Esser, Schuldrecht, 2. Aufl. 1960, § 85) | 175 | ||
| 6. Die Mischung der Zwecke | 176 | ||
| VIII. Die Abhängigkeit der Schuldverhältnisse von ihrem Zweck | 177 | ||
| 1. Abgrenzung: Motiv – Zweck – Bedingung | 177 | ||
| 2. Die Verfehlung des Austauschzwecks | 180 | ||
| a) bei Versprechensverträgen | 181 | ||
| b) bei Verfügungsgeschäften | 181 | ||
| c) bei abstrakten Forderungen | 182 | ||
| d) bei angestaffeltem Austauschzweck | 182 | ||
| 3. Die Verfehlung des Liberalitätszwecks | 183 | ||
| 4. Die Verfehlung von Abwicklungszwecken | 184 | ||
| A. Die Abhängigkeit der Erfüllungsgeschäfte von ihrem Zweck | 184 | ||
| B. Die Abhängigkeit der Sicherungsgeschäfte von ihrem Zweck | 185 | ||
| C. Die Abhängigkeit des Vergleichs von seinem Zweck | 186 | ||
| 5. Die Verfehlung angestaffelter atypischer Zwecke | 186 | ||
| 6. Die Zwecklehre und das BGB | 191 | ||
| Drittes Kapitel: Die drei Gesamtschuldtypen | 193 | ||
| § 7 Die gleichgründige Gesamtschuld (ex eadem causa) | 193 | ||
| I. Die begriffliche Entwicklung der gleichgründigen Gesamtschuld | 193 | ||
| 1. Der historische Ursprung | 193 | ||
| 2. Die Regelung des BGB (Eisele) | 194 | ||
| 3. Die Regelung des BGB (Enneccerus) | 195 | ||
| II. Der Tatbestand der gleichgründigen Gesamtschuld | 197 | ||
| 1. Identität von Zweck und Leistung | 197 | ||
| 2. §§ 427, 431: Auslegungsregeln oder dispositive Vorschriften? | 198 | ||
| 3. Der Grund der gesamtschuldnerischen Bindung | 198 | ||
| 4. Die Bedeutung des Grundes der gesamtschuldnerischen Bindung im Außenverhältnis | 200 | ||
| 5. Die Bedeutung des Grundes der gesamtschuldnerischen Bindung im Innenverhältnis | 201 | ||
| 6. Miterfüllung und cessio-legis (§§ 422, 426 II) | 202 | ||
| 7. Unteilbare Leistungen (§ 431) | 203 | ||
| 8. Abwicklungsverbindlichkeiten und Schadensersatzverbindlichkeiten aus einem gemeinsamen Vertrag | 206 | ||
| 9. Abgrenzungsprobleme | 209 | ||
| a) Gesamtschuld und kumulierte Schuldverhältnisse | 209 | ||
| b) Gleichgründige und Sicherungsgesamtschulden | 210 | ||
| III. Der besondere „Rechtsfolgerahmen“ der gleichgründigen Gesamtschuld | 211 | ||
| 1. Mittilgung und Regreß (§§ 422, 426) | 211 | ||
| 2. Erlaß (§ 423) | 211 | ||
| 3. Gläubigerverzug | 211 | ||
| 4. Die Wirkungen anderer Tatsachen (§ 425) | 212 | ||
| 5. Die Verschiedenartigkeit und Selbständigkeit der verbundenen Einzelforderungen (= Schuldverhältnisse im engeren Sinne) | 213 | ||
| a) Bedingungen u. a. | 213 | ||
| b) Die sogenannten Rechtswohltaten der Teilung und Vorausklage | 213 | ||
| § 8 Schutzzweckgesamtschulden | 214 | ||
| I. Die begriffliche Entwicklung | 214 | ||
| 1. Von der Straf- zur Schutzfunktion der Schadensersatzverpflichtung (keine Mehrfachentschädigung bei mehreren Schädigern) | 214 | ||
| 2. Der Gläubigervorteil der gesamtschuldnerischen Bindung der Schutzansprüche | 215 | ||
| a) Die Mithaftung jedes Gesamtschuldners für die Tatbeiträge der anderen | 215 | ||
| b) Die Möglichkeit der Teilhaftung | 216 | ||
| 3. Der anteilsmäßige Regreß als notwendiges Korrelat der vollen Haftung im Außenverhältnis | 217 | ||
| a) Regreß als ausgleichende Gerechtigkeit | 217 | ||
| b) Maßstab des Regresses (§ 254) | 218 | ||
| c) Keine Gesamtschuld ohne Regreß | 220 | ||
| d) Gesamtschuld und Vorteilsausgleichung | 220 | ||
| 4. Die Verallgemeinerung des Gedankens der §§ 830, 840, 421 ff. | 222 | ||
| a) Die Verkennung des Schutzzwecks | 222 | ||
| b) Die „Krücke“ der Analogie und der „Zweckgemeinschaft“ | 223 | ||
| aa) RGZ 77, 317 | 223 | ||
| bb) BGHZ 43, 227 | 223 | ||
| cc) v. Caemmerer und BGHZ 52, 39 | 225 | ||
| dd) BGHZ 51, 278 | 226 | ||
| c) Ansprüche mit „gemeinsamem Schutzzweck“ (Lehmann) – „Erfolgsschulden“. (Leonhard) | 226 | ||
| d) Dilchers Kausalansatz | 227 | ||
| II. Der Tatbestand der Schutzzweck-Gesamtschuld | 229 | ||
| 1. Die verschiedenen Fallgruppen | 230 | ||
| a) Mehrere Deliktsschuldner (§ 840) | 230 | ||
| b) Schutzansprüche aus Gefährdungshaftungstatbeständen | 230 | ||
| c) Schutzansprüche aus Verträgen (positiver Forderungsverletzung) | 231 | ||
| d) Schutzversprechen und deliktische Schadensersatzansprüche | 233 | ||
| e) Schadensersatzansprüche und fiktive Gegenleistungsansprüche | 236 | ||
| f) Sonstige Schutzzweckgesamtschulden kraft gesetzlicher Anordnung | 237 | ||
| 2. Der Grund der gesamtschuldnerischen Bindung bei den Schutzzweck-Gesamtschulden und seine Bedeutung im Außen- und Innenverhältnis | 239 | ||
| III. Der besondere Rechtsfolgerahmen der Schutzzweck-Gesamtschuld | 241 | ||
| 1. Mittilgung und Regreß (§ 422, 426) | 241 | ||
| 2. Der Erlaß (§ 423) | 242 | ||
| a) Die sogenannte Einzelwirkung des Erlasses (§ 423) | 242 | ||
| b) Haftungsverzicht | 244 | ||
| c) Gesetzlich gestörter Gesamtschuldnerausgleich | 245 | ||
| aa) Das Problem | 245 | ||
| bb) Die Entscheidung BGHZ 51, 37 ff. | 246 | ||
| cc) diligentia quam in suis | 249 | ||
| d) Der Vergleich (§ 779) | 250 | ||
| 3. Der Gläubigerverzug (§ 424) | 251 | ||
| 4. Die Wirkung anderer Tatsachen (§ 425) | 252 | ||
| § 9 Schutzzweckgesamtschulden. Fortsetzung I: Lohnfortzahlung und Schadensersatz | 252 | ||
| I. Die Problemstellung | 252 | ||
| II. Die Rechtsnatur des Lohnfortzahlungsanspruchs | 254 | ||
| 1. Der „verschleiernde Wortlaut“ (Sieg) des § 616 II | 254 | ||
| 2. Sieberts Auffassung | 254 | ||
| 3. Selbs Auffassung | 256 | ||
| 4. Schutzzweck mit angestaffeltem Austauschzweck | 256 | ||
| III. Kein Schaden infolge Lohnfortzahlung | 261 | ||
| 1. Die Problemstellung | 261 | ||
| 2. Der Zeitpunkt der Entstehung des Schadensersatzanspruchs | 262 | ||
| 3. Die Fehlentwicklung der reichsgerichtlichen Rechtsprechung zum Begriff des Schadens | 263 | ||
| a) Die Rechtslage vor den Lohnfortzahlungsanteilen des BGH | 264 | ||
| b) Die Fehlentscheidung RGZ 64, 350 zur Vermeidung einer „Doppelentschädigung“ | 265 | ||
| c) Die Regreßerschwerung durch die Begründung (kein Schaden) der Fehlentscheidung | 267 | ||
| d) Die erste Regreßentscheidung des RG | 267 | ||
| e) § 12 Abs. 3 TOA und die Rechtsprechung | 268 | ||
| 4. Die Entscheidung BGHZ 7, 30 ff. | 269 | ||
| a) Die Argumente des BGH | 269 | ||
| b) Die Kritik an BGHZ 7, 30 ff. | 270 | ||
| 5. Der sogenannte normative Schadensbegriff | 273 | ||
| 6. Die Vorteilsausgleichung bei Drittleistungen | 275 | ||
| a) Schadensentstehung und Schadensbeseitigung | 275 | ||
| b) Kausaler Vorteil und zweckbestimmte Zuwendung (Leistung) | 277 | ||
| aa) Oertmanns Auffassung | 278 | ||
| bb) Das Vordrängen der Adäquanzformel | 279 | ||
| cc) Die Rechtsprechung des RG | 279 | ||
| dd) Die Rechtsprechung des BGH | 282 | ||
| ee) Cantzlers Auffassung | 284 | ||
| ff) Thieles Auffassung | 285 | ||
| gg) Durchbruch des Zweckgedankens | 286 | ||
| c) Die verschiedenen Zwecke der Drittleistungen | 287 | ||
| d) Zusammenfassung | 290 | ||
| IV. Doppelentschädigung oder Schuldnerausgleich? | 290 | ||
| 1. cessio-legis-Fälle | 291 | ||
| 2. Doppelentschädigungsfälle | 293 | ||
| 3. Leistungen und Leistungsversprechen nach dem Schadensfall | 296 | ||
| a) Schenkung | 296 | ||
| b) Drittleistung gemäß § 267 | 296 | ||
| c) Schadensausgleich unter Regreßvorbehalt | 296 | ||
| d) Andere Fälle | 297 | ||
| 4. Die Regreßkonstruktion bei Lohnfortzahlungen | 298 | ||
| a) Drittschadensliquidation | 299 | ||
| b) Geschäftsführung ohne Auftrag (§ 683) | 300 | ||
| c) Bereicherungsanspruch | 300 | ||
| d) Zessionskonstruktion | 301 | ||
| § 10 Schutzzweckgesamtschulden. Fortsetzung II: Unterhalts- und Schadensersatzpflichten | 302 | ||
| I. Das Problem | 302 | ||
| II. Materialien zu § 843 IV BGB = § 723 II E 1 | 303 | ||
| 1. Die Regel des § 723 II E 1 | 303 | ||
| 2. Die Regel des § 726 I, 4 E 1 | 306 | ||
| 3. Die Zusammenfassung von § 723 II und § 726 I, 4 E 1 | 307 | ||
| 4. Die Materialien zum Problem der compensatio lucri et damni im Hinblick auf Unterhaltsleistungen | 307 | ||
| III. Die Entwicklung des Schadensproblems durch Wissenschaft und Praxis | 309 | ||
| 1. Die Linie des Reichsgerichts | 309 | ||
| 2. Der Umschwung mit BGHZ 7, 30 ff. | 311 | ||
| IV. Die Regreßmethoden | 315 | ||
| 1. Rabel: Ausbau oder Verwischung des Systems | 315 | ||
| 2. Die sogenannte moderne Lehre | 318 | ||
| 3. Die Zessionskonstruktion (Abtretung und Gesamtschuld) | 319 | ||
| a) Die allgemeine Meinung: Abtretungskonstruktion | 319 | ||
| b) Gesamtschuldlösung | 319 | ||
| V. Feststellungsklage und Verjährung | 321 | ||
| 1. Die Feststellungsklage des eventuell Regreßberechtigten | 321 | ||
| 2. Die Verjährungsfrage | 322 | ||
| § 11 Sicherungsgesamtschulden | 322 | ||
| I. Die historische und begriffliche Entwicklung des rechtlich wirksamen Versprechens und seiner Sicherung | 322 | ||
| 1. Die „persönlichen“ Schulden (Obligationen, Bürgschaften) | 322 | ||
| 2. Die Pfandrechte („dingliche Schulden“, Realobligationen, Verwertungsrechte) | 325 | ||
| 3. Die Korrealobligation | 330 | ||
| II. Der Tatbestand der Sicherungsgesamtschuld | 332 | ||
| 1. Die verschiedenen Fallgruppen | 332 | ||
| a) Überblick | 332 | ||
| b) Die Bürgschaft | 333 | ||
| c) Schuldmitübernahme | 336 | ||
| d) Abstrakte Sicherungsversprechen | 337 | ||
| e) Die dinglichen „Verwertungsrechte“ (Pfandrecht, Hypothek, Grundschuld) | 342 | ||
| f) Die Sicherungsübereignung | 348 | ||
| g) Mehrere Verpfänder und andere Sicherungsgeber | 351 | ||
| aa) Mehrere Verpfänder (§ 1222) | 351 | ||
| bb) Gesamthypothek (§ 1132) | 352 | ||
| cc) Bürgen und Verpfänder | 353 | ||
| h) Sicherungsgesamtschulden kraft gesetzlicher Anordnung (Mitbürgschaft u. a.) | 354 | ||
| aa) Mitbürgschaft | 355 | ||
| bb) Fälle gesetzlicher Bürgschaft und Schuldmitübernahme | 356 | ||
| 2. Der Sicherungszweck als Grund der gesamtschuldnerischen Bindung | 357 | ||
| 3. Abgrenzungsprobleme | 358 | ||
| a) Sicherungsgesamtschuld und gleichgründige Gesamtschuld | 358 | ||
| b) Sicherungs- und Schutzzweckgesamtschuld | 359 | ||
| III. Der besondere Rechtsfolgerahmen der Sicherungsgesamtschuld | 360 | ||
| 1. Mittilgung und Regreß | 360 | ||
| a) Der Grundsatz | 360 | ||
| b) Abweichende Vereinbarungen | 360 | ||
| c) BGHZ 46, 14 | 361 | ||
| 2. Erlaß (§ 423) | 363 | ||
| a) Erlaß der gesicherten Schuld | 363 | ||
| b) Erlaß der sichernden Schuld | 363 | ||
| aa) Wirkung gegenüber dem Gläubiger | 363 | ||
| bb) Wirkung gegenüber den Mitschuldnern | 364 | ||
| 3. Gläubigerverzug (§ 424) | 365 | ||
| 4. Wirkung anderer Tatsachen (§ 425) | 366 | ||
| Abkürzungs- und Schrifttumsverzeichnis | 367 | ||
| Entscheidungsverzeichnis | 378 | ||
| Sachverzeichnis | 385 |
