Das Doppelverwertungsverbot bei strafrahmenbildenden Umständen
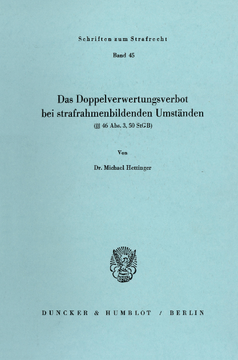
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Das Doppelverwertungsverbot bei strafrahmenbildenden Umständen
(§§ 46 Abs. 3, 50 StGB)
Schriften zum Strafrecht, Vol. 45
(1982)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 14 | ||
| Einleitung | 17 | ||
| Zur Terminologie | 23 | ||
| Erster Teil: Die Bedeutung des Doppelverwertungsverbots i. S. d. § 46 Abs. 3 | 30 | ||
| I. Die Entwicklung zum Doppelverwertungsverbot i. S. d. § 46 Abs. 3 | 30 | ||
| 1. Zum Standort des Problems | 30 | ||
| 2. Die Gesetzgebung | 34 | ||
| 3. Die Rechtsprechung | 42 | ||
| a) Das Reichsgericht | 42 | ||
| b) Der Bundesgerichtshof | 43 | ||
| 4. Stellungnahmen der Literatur | 46 | ||
| a) Zur Begründung des Verbots | 46 | ||
| b) Kritische Stimmen | 48 | ||
| 5. Resümee | 51 | ||
| II. Zur Vorarbeit des Gesetzgebers für die Strafzumessung | 52 | ||
| III. Zur Vorgehensweise bei der Strafzumessung | 55 | ||
| 1. Die Grundprinzipien | 55 | ||
| 2. Zur Bedeutung des § 46 für die Strafzumessung | 58 | ||
| IV. Die Ausgestaltung der Straftatbestände durch den Gesetzgeber | 60 | ||
| 1. Die Bedeutung des Art. 103 Abs. 2 GG für die Bildung von Straftatbeständen | 60 | ||
| 2. Die Gesetzgebungsmethode bei der Tatbestandsformulierung auf der Grundlage des Art. 103 Abs. 2 GG | 62 | ||
| 3. Die Interdependenz von Tatbestandsformulierung und Strafrahmenbildung | 66 | ||
| 4. Strafrahmen und Schuldprinzip | 71 | ||
| 5. Zur Bedeutung der Strafrahmen des geltenden Rechts | 77 | ||
| a) Zum Begriff der Strafrahmen | 77 | ||
| b) Folgerungen aus der Gesetzgebungsmethode | 78 | ||
| c) Die Strafrahmen als Wertmaßstab des Gesetzes | 82 | ||
| d) Fazit | 83 | ||
| V. Die „Umstände“ i. S. d. § 46 Abs. 3 | 84 | ||
| 1. Belings Differenzierung nach Begriff und Tatsache | 84 | ||
| 2. Die Weiterführung des Ansatzes von Beling durch Spendel | 86 | ||
| 3. Die Bedeutung des Tatbestandes und seiner Merkmale für die Strafzumessung | 88 | ||
| a) Der Tatbestand und seine Merkmale als Strafbarkeitsvoraussetzung | 88 | ||
| b) Der Tatbestand und seine Merkmale als Strafzumessungsgrund | 90 | ||
| aa) Steigerungsfähige Tatbestandsmerkmale | 91 | ||
| bb) Konkretisierungsfähige Tatbestandsmerkmale | 94 | ||
| cc) Zusammenfassung | 98 | ||
| 4. Hassemers Strafzumessungsmodell | 101 | ||
| 5. Zur Doppelfunktion der Tatbestandsmerkmale | 103 | ||
| 6. Die Bedeutung des § 46 Abs. 2 | 108 | ||
| VI. Die Steigerungsfähigkeit (Quantifizierbarkeit) von Unrecht und Schuld | 111 | ||
| 1. Die Steigerungsfähigkeit des Unrechts | 111 | ||
| 2. Die Steigerungsfähigkeit der Schuld | 117 | ||
| a) Schuld als Strafbarkeitsvoraussetzung | 117 | ||
| b) Schuld als Steigerungsbegriff | 119 | ||
| c) Schuld als Strafmaß- oder Strafzumessungsschuld | 119 | ||
| 3. Folgerungen für die Strafzumessung i. S. d. § 46 Abs. 1 und 2 | 121 | ||
| 4. Folgerungen für das Doppelverwertungsverbot i. S. d. § 46 Abs. 3 | 123 | ||
| 5. Die Deutung des Doppelverwertungsverbots durch Zipf | 127 | ||
| VII. Die Strafzumessung und die Theorie der Schwereskala | 128 | ||
| 1. Die Theorie der Schwereskala | 129 | ||
| 2. „Kontinuierliche“ oder „ungefähre“ Schwereskala | 131 | ||
| 3. Mögliche Konsequenzen für das Verständnis der Tatbestandsmerkmale in der Strafzumessung | 134 | ||
| VIII. Die Vorstellung vom Straftatbestand als „vertyptem Normalfall“ | 135 | ||
| 1. Die Bedeutung der Begriffe Durchschnittsfall – Regelfall – erfahrungsgemäß gewöhnlich vorkommender Fall | 137 | ||
| 2. Schwereskala und theoretischer Durchschnittsfall | 139 | ||
| a) Befürworter des Denkmodells des „theoretischen Durchschnittsfalls“ | 139 | ||
| b) Kritiker des Denkmodells des „theoretischen Durchschnittsfalls“ | 142 | ||
| c) Stellungnahme | 143 | ||
| 3. Der sogen. „Regelfall“ | 147 | ||
| a) Die Begründung der Existenz des „Regelfalls“ | 147 | ||
| b) Kritische Stellungnahme | 149 | ||
| IX. Schlußbetrachtung | 153 | ||
| Zweiter Teil: Die Bedeutung des Doppelverwertungsverbotes bei Strafrahmenmilderungsgründen i. S. d. § 49 Abs. 1 und bei unbenannten Strafrahmenänderungen | 164 | ||
| Vorbemerkung | 164 | ||
| A. Die besonderen gesetzlichen Strafrahmenmilderungsgründe i. S. d. § 49 Abs. 1 | 165 | ||
| I. Die Bedeutung der Strafrahmenvorschriften des § 49 Abs. 1 | 165 | ||
| II. Die Milderungsgründe i. S. d. § 49 Abs. 1 im einzelnen | 166 | ||
| 1. Die obligatorischen Rahmenmilderungsgründe | 166 | ||
| a) § 27 | 166 | ||
| b) § 28 Abs. 1 | 168 | ||
| c) § 30 | 168 | ||
| d) § 35 Abs. 2 | 169 | ||
| e) § 111 Abs. 2 | 169 | ||
| 2. Der abstrakte Wertmaßstab bei den obligatorischen Rahmenmilderungsgründen i. S. d. § 49 und die Konsequenzen für das Doppelverwertungsverbot | 170 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 173 | ||
| 4. Die fakultativen Rahmenmilderungsgründe | 174 | ||
| a) Zur Bedeutung der Regelungen | 174 | ||
| b) Zur Strafrahmenwahl und dem Einwand des Doppelverwertungsverbotes | 177 | ||
| c) Das Vorgehen der Rechtsprechung | 178 | ||
| aa) Beim Versuch | 178 | ||
| bb) Bei erheblich verminderter Schuldfähigkeit | 180 | ||
| d) Das von Dreher vorgeschlagene Modell | 181 | ||
| e) Die Auffassung Buschs | 183 | ||
| 5. Stellungnahme | 184 | ||
| 6. Zur Bedeutung des Doppelverwertungsverbotes bei der Entscheidungsfindung | 187 | ||
| 7. Geltung des Doppelverwertungsverbotes bzgl. strafrahmenbildender Umstände | 190 | ||
| 8. Das Gesamtrahmenmodell Zipfs nach altem Recht | 198 | ||
| 9. Die Übernahme des Modells für das neue Recht durch Horn | 200 | ||
| 10. Stellungnahme | 201 | ||
| B. Die Strafrahmentechnik der minder schweren Fälle und der besonders schweren Fälle | 202 | ||
| I. Zur Entwicklung der Gesetzgebungstechnik der unbenannten Strafrahmenänderungsgründe | 203 | ||
| II. Zur Verfassungsmäßigkeit der unbenannten Strafrahmenänderungen | 205 | ||
| III. Die Bedeutung der unbenannten Strafrahmenänderungen | 207 | ||
| IV. Der Geltungsbereich des Doppelverwertungsverbots bei den unbenannten besonders schweren Fällen und den minder schweren Fällen nach der h. M. | 211 | ||
| V. Eigene Würdigung | 212 | ||
| VI. Doppelverwertungsverbot und Regelbeispiele | 215 | ||
| VII. Exkurs: Kritik der Handhabung der besonders schweren Fälle und minder schweren Fälle durch die h. M. | 217 | ||
| 1. Zur Methode der Wertgruppenbildung | 217 | ||
| 2. Zum Einwand des Doppelverwertungsverbots | 221 | ||
| Dritter Teil: Das Zusammentreffen von Rahmenmilderungsgründen | 223 | ||
| I. Die Regelung des § 50 als Ausgangspunkt | 224 | ||
| 1. Die Rechtsprechung zu § 50 | 226 | ||
| 2. Folgerungen für das Verfahren bei Konstellationen i. S. d. § 50 | 232 | ||
| 3. Kritische Würdigung der Rechtsprechung zu § 50 | 233 | ||
| 4. Die Auslegung des § 50 in der Literatur | 240 | ||
| a) Übereinstimmungen mit der Rechtsprechung | 240 | ||
| b) Zum Verhältnis der Rahmenmilderungsgründe i. S. d. § 49 Abs. 1 zur Wertgruppe der minder schweren Fälle | 241 | ||
| c) Die Exklusivitätsthese Horns | 245 | ||
| d) Kriterien der Strafrahmenwahl | 245 | ||
| e) Zur Mehrfachverwertung strafrahmenbildender Umstände i. S. d. § 50 | 251 | ||
| f) Die Bedeutung des § 50 für die Endstrafzumessung | 252 | ||
| 5. Zwischenergebnis | 253 | ||
| II. Die Behandlung des „Zusammentreffens von Milderungsgründen“ in der Gesetzgebung und in den Reformentwürfen | 255 | ||
| 1. Das Verhältnis benannter und unbenannter Rahmenmilderungen im StGB von 1871 und den Entwürfen bis zum E 1936 | 255 | ||
| 2. Die Regelung des Zusammentreffens mehrerer besonderer gesetzlicher Rahmenmilderungsgründe in den Entwürfen | 262 | ||
| 3. Fazit | 263 | ||
| 4. Die Regelungen über das „Zusammentreffen von Milderungsgründen“ in den Entwürfen und Beratungen seit 1954 | 263 | ||
| 5. Fazit | 271 | ||
| III. Eigene Lösung | 273 | ||
| 1. Die Prämissen des § 50 | 273 | ||
| 2. Zur „freien“ Rahmenwahl | 285 | ||
| a) Obligatorische Rahmenmilderungsgründe | 285 | ||
| b) Fakultative Rahmenmilderungsgründe | 286 | ||
| 3. Die Folgenregelung | 290 | ||
| Literatur- und Quellenverzeichnis | 292 |
