Die Institution der kommunalen Sozialverwaltung
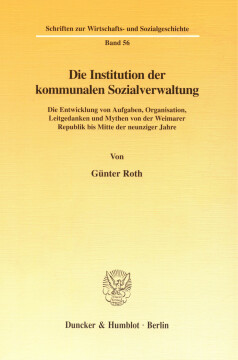
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Institution der kommunalen Sozialverwaltung
Die Entwicklung von Aufgaben, Organisation, Leitgedanken und Mythen von der Weimarer Republik bis Mitte der neunziger Jahre
Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Vol. 56
(1999)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Die Organisation, so die These Günter Roths, $aantizipiert$z soziale Probleme sowie Entwicklungen in der Verwaltungsumwelt und verarbeitet diese nach von $aihr$z entwickelten $aRegeln.$z Je mehr sie diese Regeln - in Wechselwirkung mit ihrer institutionellen, politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen $aUmwelt$z - formell und informell $adefiniert,$z desto mehr wird sie zur $aInstitution.$z Desto mehr ist die Sozialverwaltung mit ihren $aFachverbänden$z und den horizontal und vertikal verflochtenen $aFachverwaltungen$z an der Entwicklung der Problemsicht, an der Aufgabendefinition und organisatorischen Lösungskonzepten beteiligt. Richtungweisende Bedeutung hatten der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge, der Deutsche Städtetag sowie die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt). Mittels fachlichem Austausch, Publikationen, Tagungen etc. prägten sie Leitgedanken und organisatorische Konzepte bis hin zu gesetzlichen Regelungen.Daraus resultiert eine Reihe von Phänomenen: So ist schon vor und trotz einer »losen Kopplung« an Vorgaben des Zentralstaates eine wachsende »Isomorphie« der Organisation der kommunalen Sozialverwaltung festzustellen. Es entwickelte sich - so die quantitativ vergleichend und qualitativ vertiefend angelegte Untersuchung - eine Organisation, die durch enormes Wachstum und Differenzierung gekennzeichnet ist, was nur $amittelbar$z und mit zeitlicher Verzögerung durch Veränderungen in der Verwaltungsumwelt bestimmt und $arelativ losgelöst$z von den Aufgaben verlief. Darüber hinaus bestand seit der Weimarer Republik ein hohes Maß an $aKontinuität$z der Organisation, der rechtlichen Grundlagen, der Aufgaben sowie der fachlichen Leitbilder. Ein enormes institutionelles Beharrungsvermögen bedingte also eine »pfadabhängige« Entwicklung - trotz tiefgreifender politischer Systemwechsel sowie ökonomischer und sozialer Krisen.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Tabellenverzeichnis | 11 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 13 | ||
| A. Einführung und theoretischer Rahmen | 17 | ||
| I. Ausgangspunkt: Aspekte der Verwaltungsentwicklung | 17 | ||
| II. Wachstumslinien der deutschen Verwaltung | 20 | ||
| III. Defizite der Forschung | 22 | ||
| IV. Entwicklungslinien der kommunalen Sozialverwaltung | 23 | ||
| V. Theoretischer Ansatz | 30 | ||
| VI. Vorgehen | 36 | ||
| B. Die Sozialverwaltung in der Weimarer Republik | 41 | ||
| I. Die Begründung der Institution bis 1924 | 41 | ||
| 1. Gründung von Wohlfahrtsämtern und erste Vereinheitlichung der Organisation | 48 | ||
| 2. Die Institutionalisierung am Beispiel des Wohlfahrtsamtes der Stadt Nürnberg | 51 | ||
| 3. Die rechtliche Begründung von Aufgaben und Organisation | 58 | ||
| a) Verordnung über die Fürsorgepflicht (RFV) | 60 | ||
| b) Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge (RGr) | 61 | ||
| c) Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) | 64 | ||
| II. Die Leitgedanken der Fachwelt | 67 | ||
| 1. Überblick zur Konjunktur der Themen | 67 | ||
| 2. Leitgedanken und Mythen | 70 | ||
| a) Einheitlichkeit, Planmäßigkeit, Professionalität | 70 | ||
| b) ‚Rationalisierung‘ der Fürsorge nach dem Vorbild der Medizin | 74 | ||
| c) Familienfürsorge als Verbindung verschiedener Leitgedanken | 78 | ||
| d) Ausbau der Verwaltung und Professionalität als ‚Sparmaßnahmen‘ | 79 | ||
| III. Wachstum und Vereinheitlichung der Fürsorgeverwaltung von 1924–1932 | 83 | ||
| 1. Grundzüge der organisatorischen Entwicklung: Standardisierung, Differenzierung, Professionalisierung | 83 | ||
| 2. Die Entwicklung der Fürsorgeverwaltung zwischen 1925 und 1931 im Vergleich von 20 Großstädten | 92 | ||
| a) Methodisches Vorgehen | 92 | ||
| (1) Die abhängige Variable: Größe der Organisation | 93 | ||
| (2) Die unabhängige Variable Aufgabenumwelt | 96 | ||
| b) Die Fürsorgeverwaltung und ihre Umwelt | 97 | ||
| (1) Das Wachstum der Aufgaben | 97 | ||
| (2) Die Zahl der Einwohner | 104 | ||
| (3) Die Finanzkraft | 104 | ||
| c) Die Fürsorgeverwaltung und sonstige Parameter | 105 | ||
| (1) Das Wachstum der gesamten Verwaltung | 105 | ||
| (2) Bürokratische Strukturmerkmale | 106 | ||
| d) Die Fürsorgeausgaben und die Umwelt | 107 | ||
| (1) Zahl der Unterstützten und Höhe der Unterstützungsausgaben | 107 | ||
| (2) Die Finanzkraft | 108 | ||
| (3) Die Größe der Verwaltung | 109 | ||
| 3. Die Entwicklung der Fürsorgeverwaltung am Beispiel der Stadt Nürnberg | 110 | ||
| a) Der Abschluß der Institutionalisierung 1925 | 110 | ||
| b) Das Wachstum der Organisation und Aufgaben von 1925 bis 1932 | 113 | ||
| c) Die Bürokratisierung und der Konflikt mit den ‚Ehrenbeamten‘ | 121 | ||
| C. Die Sozialverwaltung im Dritten Reich | 128 | ||
| I. Vorbemerkungen | 128 | ||
| II. Kontinuität und Wandel institutioneller Strukturen | 132 | ||
| III. Die Leitgedanken der Fachwelt | 142 | ||
| IV. Beharrungsvermögen und Veränderung der Fürsorgeorganisation | 150 | ||
| 1. Grundstrukturen der organisatorischen Entwicklung | 150 | ||
| 2. Das Beispiel der Nürnberger Fürsorgeverwaltung | 154 | ||
| D. Die Sozialverwaltung nach dem Zweiten Weltkrieg | 169 | ||
| I. Institutionelle Restauration | 170 | ||
| 1. Die Restauration des Fürsorgesystems in den 50er Jahren | 170 | ||
| 2. Reform und Anpassung des Fürsorgerechts | 174 | ||
| II. Die Leitgedanken der Fachwelt | 180 | ||
| 1. Tradition statt Neubeginn | 180 | ||
| 2. Professionalisierung und Ausbau der Organisation | 182 | ||
| 3. Abschied vom ‚Ehrenamt‘ als Teil der kommunalen Fürsorgeverwaltung | 188 | ||
| 4. Definition neuer Aufgaben: Die Not der Alten | 190 | ||
| III. Restauration und Ausbau der Organisation | 192 | ||
| 1. Allgemeine Grundzüge | 192 | ||
| 2. Restauration und Ausbau der kommunalen Sozialverwaltung am Beispiel der Stadt Nürnberg | 194 | ||
| E. Die Sozialverwaltung in den sechziger und siebziger Jahren | 211 | ||
| I. Allgemeine institutionelle Entwicklung | 212 | ||
| 1. Das Wachstum der Sozialhilfe im Überblick | 212 | ||
| 2. Rechtliche Leistungsausweitungen und -einschränkungen | 217 | ||
| 3. Phasen des Wachstums und der Einschränkung von Ausgaben | 218 | ||
| II. Die Leitgedanken der Fachwelt | 221 | ||
| 1. Reorganisation, Expansion, neue und alte Mythen | 222 | ||
| 2. Finanzielle Restriktionen und Selbsthilfebewegung | 237 | ||
| III. Wachstum und Differenzierung der Organisation | 242 | ||
| 1. Allgemeine Tendenzen | 242 | ||
| 2. Wachstum und Differenzierung der Sozialverwaltung am Beispiel der Stadt Nürnberg | 245 | ||
| a) Die Ausgaben | 245 | ||
| b) Organisation und Aufgaben | 253 | ||
| (1) Ergebnisse und Folgen eines Organisationsvergleichs | 259 | ||
| (2) Die Organisationsstruktur der Nürnberger Sozialverwaltung (1980) | 267 | ||
| 3. Wachstum von Aufgaben und Organisation im Städtevergleich (1976–1986) | 271 | ||
| a) Zum Vorgehen | 271 | ||
| b) Übersicht der Entwicklung von 1976–1986 | 273 | ||
| c) Die Größe der Sozialverwaltung und Umweltparameter im Querschnitt | 275 | ||
| d) Die Größe der Sozialverwaltung und Umweltparameter im Längsschnitt | 279 | ||
| e) Die Ausgaben und die Zahl der Hilfeempfänger sowie Verwaltungskosten | 281 | ||
| F. Die Sozialverwaltung in den achtziger und neunziger Jahren | 283 | ||
| I. Reform und Neuordnung des institutionellen Systems | 283 | ||
| 1. Das Wachstum der Sozialhilfe im Überblick | 283 | ||
| 2. Einsparungen und Neuordnung in der wirtschaftlichen Krise | 289 | ||
| 3. Institutionelle Neuordnung durch die Pflegeversicherung | 296 | ||
| 4. Institutionelle Neuordnung durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz | 302 | ||
| II. Die Leitgedanken der Fachwelt | 306 | ||
| 1. Selbstreflexion und Selbstkritik | 307 | ||
| 2. Verbreitung von Organisationsanalysen | 311 | ||
| 3. ‚Neues Steuerungsmodell‘ | 314 | ||
| a) Das Tilburger Modell: ‚Konzern Stadt‘ | 317 | ||
| b) Neue Steuerungsmodelle der KGSt | 320 | ||
| c) Umsetzungsprobleme: Neue Steuerung versus Fachlichkeit? | 323 | ||
| III. Grundzüge der organisatorischen Entwicklung | 331 | ||
| 1. Allgemeine Tendenzen | 331 | ||
| 2. Organisatorische Entwicklung am Beispiel der Stadt Nürnberg | 335 | ||
| a) Die Entwicklung der Ausgaben | 335 | ||
| b) Organisation und Aufgaben | 344 | ||
| G. Fazit | 358 | ||
| H. Literatur | 371 | ||
| I. Quellen | 404 | ||
| J. Anhang | 405 |
