Die Tarifautonomie in der Bundesrepublik Deutschland
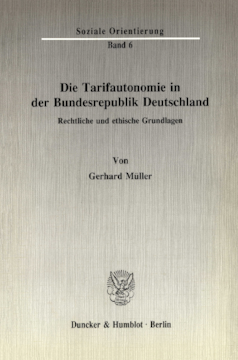
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Tarifautonomie in der Bundesrepublik Deutschland
Rechtliche und ethische Grundlagen
Soziale Orientierung, Vol. 6
(1990)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Die Reihe »Soziale Orientierung« erscheint seit 1979 und behandelt in Monographien oder in Sammelbänden aktuelle Probleme aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Das Zusammenleben der Menschen und Völker wird heute nicht mehr so sehr von überkommenen Traditionen bestimmt. Kennzeichen ist vielmehr die Komplexität der Verhältnisse und die rasante Entwicklung, die auch der wissenschaftlichen Reflexion ihren Stempel aufdrücken. Unter diesen Umständen erhält die Frage nach Orientierung eine neue Dringlichkeit. Auf der einen Seite ist es der »gesunde Menschenverstand«, der bei der Suche nach verlässlicher Orientierung helfen kann; auf der anderen Seite ist es die Besinnung auf das sittliche Vermögen, das die Menschen befähigt, über Sinn- und Wertstrukturen in Familie und Erziehung, in Wirtschaft und Gesellschaft, im Rechts- und Sozialstaat, in der Demokratie, auch in religiösen Gemeinschaften neu nachzudenken.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Kapitel I: Die rechtliche Grundlage der Tarifautonomie und ihre Entfaltung | 19 | ||
| 1. Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland als Ausgangs- und Bezugspunkt | 19 | ||
| 2. Der Bestands- und Betätigungsschutz des Koalitionswesens | 19 | ||
| 3. Die autonome Betätigung der Koalitionen | 20 | ||
| 4. Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen als Bezugsgrößen des Koalitionsschutzes | 21 | ||
| 5. Die Interessenverfolgung der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen in ihrem Verhältnis zueinander | 21 | ||
| 6. Die TV-Autonomie als Ergebnis | 22 | ||
| 7. Die arbeitsteilige Wirtschaftsordnung als Voraussetzung der TV-Autonomie | 23 | ||
| 8. Die Sachnahen als Träger der TV-Autonomie | 23 | ||
| 9. Geistige Grundlagen und ordnungspolitische Bedeutung der TV-Autonomie | 23 | ||
| 10. Wichtige Rechtsregelungen | 24 | ||
| Kapitel II: Die Interessenverfolgung seitens der Koalitionen | 25 | ||
| 1. Die Bedeutung der Interessenwahrung und der Interessenbildung allgemein | 25 | ||
| a) Der der TV-Autonomie zugrunde liegende Ausgangsgedanke | 25 | ||
| b) Die ethische Berechtigung und Notwendigkeit der Interessenverfolgung durch den Einzelnen | 26 | ||
| c) Der Begriff des Interesses. Das volitive Moment bei der Bestimmung der Interessen. Die Gefahr unethischen Verhaltens | 29 | ||
| d) Die Sicht der Rechtsordnung | 30 | ||
| e) Die Gemeinschaftsbezogenheit des Menschen | 31 | ||
| f) Folgerungen hinsichtlich der Rechtsordnung | 33 | ||
| g) Weder strenger Individualismus noch strenger Kollektivismus | 34 | ||
| h) Die Bedeutung des Art. 2 Abs. 1 GG | 35 | ||
| 2. Der Interessenbereich der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen | 37 | ||
| a) Die Arbeitsbedingungen | 37 | ||
| b) Die Wirtschaftsbedingungen | 38 | ||
| c) Zusammenfallen von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen | 39 | ||
| d) Keine nähere Bestimmung der verfolgbaren Interessen, aber kein absoluter Freiraum der Verbände | 40 | ||
| 3. Die Angehörigen des Arbeits- und Wirtschaftslebens. Ihre Bedeutung, ihre Stellung, ihre allgemeine Bindung | 40 | ||
| a) „Jedermann“ und „alle Berufe“ im Sinne des Art. 9 Abs. 3 GG | 40 | ||
| b) Die arbeitsteilige Wirtschaft als Grundlage und Voraussetzung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Stellung | 42 | ||
| c) Das Unternehmen als Personalverbund, das Eigentum im Unternehmen, Aufgaben der Unternehmer einschließlich ihrer treuhänderischen Verpflichtung, treuhänderische Seite der Arbeitnehmerstellung | 43 | ||
| d) Personengerechte Stellung der Arbeitnehmer | 48 | ||
| 4. Die Berufsfreiheit und die durch den Beruf erfolgende Bindung des Unternehmers/Arbeitgebers und des Arbeitnehmers | 48 | ||
| a) Die Berufsfreiheit des Unternehmers/Arbeitgebers | 48 | ||
| b) Die Berufsfreiheit des Arbeitnehmers | 49 | ||
| c) Zwänge beim Beruf des Unternehmers/Arbeitgebers | 50 | ||
| d) Vertiefung des treuhänderischen Aspektes des Unternehmens | 52 | ||
| e) Ergebnis für die Interessenverfolgung beider Seiten des Arbeits- und Wirtschaftslebens | 53 | ||
| f) Die Frage der Abgrenzung bei einer Kollision zwischen Gemeinbelangen und berechtigten Einzelinteressen | 53 | ||
| 5. Keine Abschaffung des Arbeitsverhältnisses | 54 | ||
| 6. Die Interessensituation der Arbeitnehmer und Unternehmer/Arbeitgeber | 55 | ||
| a) Die Tatsache divergierender Interessen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber/Unternehmer und der Grund hierfür | 55 | ||
| b) Die spezifischen Interessen der Arbeitnehmer und der Unternehmer | 57 | ||
| 7. Die Interessenverfolgung in der Assoziation | 58 | ||
| a) Die frei gebildete Vereinigung | 58 | ||
| b) Die freie Entschließung zum Beitritt, zum Verlassen und zur Bildung neuer Koalitionen | 59 | ||
| c) Der Antagonismus der Interessenverfolgung im Arbeits- und Wirtschaftsleben | 59 | ||
| 8. Interessenverfolgung außerhalb des Bereiches der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen | 60 | ||
| a) Illegitime und bedenkliche Ziele in Beispielen | 61 | ||
| b) Der Bereich der Sozialversicherungen als legitimer Betätigungsbereich der Koalitionen | 62 | ||
| c) Betätigung im Bereich des kulturellen Lebens u. dgl. | 63 | ||
| d) Entfallen des Charakters als Vereinigung zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen; Gefahr des Totalitarismus | 64 | ||
| 9. Organisation der Interessenverfolgung bei den Vereinigungen, insbesondere bei den Vereinigungen der Arbeitnehmer | 65 | ||
| a) Die hauptamtlichen Funktionäre | 65 | ||
| b) Die gewerkschaftlichen Vertrauensleute | 66 | ||
| c) Ein Bezug zwischen Betriebsräten/Personalräten und Gewerkschaften | 67 | ||
| d) Die Vereinigung des Betriebsratsamtes und der Tätigkeit als gewerkschaftlicher Vertrauensmann in einer Person | 69 | ||
| e) Ergebnis für die Gewerkschaften | 71 | ||
| 10. Bei der Interessenverfolgung auftretende ethische Gefahren | 71 | ||
| a) Die insbesondere mit dem institutionalisierten Verbandswesen verbundene Gefahr der Zielüberspannung und der Aufstellung verfehlter Ziele. Ihr ethisches Gewicht | 71 | ||
| b) Ein allgemeiner Gedanke | 72 | ||
| c) Die ethische Fragilität der Interessenvereinigungen | 73 | ||
| d) Die Korrektur überzogener und unethischer Forderungen aufgrund des Geschehens der Tarifauseinandersetzung unter ethischen Gesichtspunkten | 74 | ||
| e) Die veröffentlichte und die öffentliche Meinung in ihrer Bedeutung für die Korrektur von Tarifforderungen | 78 | ||
| f) Die Bedeutung der Mächtigkeit der Verbände im vorliegenden Zusammenhang | 79 | ||
| g) Ergebnis | 79 | ||
| 11. Eine andere Wirtschaftsverfassung? | 79 | ||
| a) Allgemeine Bemerkung | 79 | ||
| b) Die alternativen Betriebe | 80 | ||
| aa) Funktionsunfähigkeit alternativer Betriebe und Verwaltungen einschließlich der Gefährdung der Rechtsprechung | 81 | ||
| bb) Die Tatsächlichkeit der Basisdemokratie | 83 | ||
| cc) Der Gedanke der „herrschaftsfreien Gesellschaft“ | 84 | ||
| dd) Ergebnis für das Wirtschaftsleben und für die staatliche Ordnung | 84 | ||
| c) Planwirtschaft? | 85 | ||
| aa) Allgemeines | 85 | ||
| bb) Ergebnis | 87 | ||
| cc) Notlagensituationen | 88 | ||
| d) Das Zunftwesen | 89 | ||
| 12. Zurückdrängen der Zahl der Arbeitnehmer aufgrund der technologischen Entwicklung? | 90 | ||
| 13. Zusammenfassung | 91 | ||
| Kapitel III: Gesellschaftsrechtliche Größen im Arbeitsverhältnis | 93 | ||
| 1. Allgemeines | 93 | ||
| 2. Das Individualarbeitsrecht | 94 | ||
| a) Die betriebsbedingte Kündigung | 94 | ||
| b) § 613 a BGB | 95 | ||
| 3. Das Betriebsverfassungsrecht | 95 | ||
| a) Die Bedeutung des Mittragens des Unternehmens durch die Belegschaft und die existentielle Situation ihrer Angehörigen im Falle von Betriebsänderungen | 95 | ||
| b) Der Sozialplan | 97 | ||
| c) Begriff der Betriebseinschränkung i. S. des § 111 Abs. 1 BetrVG | 97 | ||
| d) Verpflichtung der Belegschaft und ihrer Angehörigen. Die Zentralnorm des Betriebsverfassungsrechts | 98 | ||
| 4. Näheres zum Betriebsverfassungsrecht als gesellschaftsrechtliche Größe | 99 | ||
| a) Die Gesetzeslage | 99 | ||
| b) Ergebnis | 100 | ||
| c) Keine Verneinung der Interessenspannungen; Doppelpoligkeit des Betriebsverfassungsrechts | 101 | ||
| d) Betriebsrat keine „Gegenmacht“ und kein „verlängerter Arm“ der Gewerkschaften | 101 | ||
| e) Ausübung der Mitwirkungskompetenzen des Betriebsrates und der Befugnisse des Arbeitgebers/Unternehmers im Blick auf eine Interessenverfolgung und unter gleichzeitiger Beachtung der Kooperationsmaxime | 103 | ||
| f) Ergebnis | 103 | ||
| g) Sprecherausschüsse | 105 | ||
| 5. Arbeitsverhältnis und Gesellschaftsverhältnis in der Sozialphilosophie der katholischen Kirche | 107 | ||
| 6. Die Repräsentanz des Arbeitnehmers in Unternehmensorganen | 109 | ||
| a) Die Sicht des Bundesverfassungsgerichts und Sichten des Schrifttums | 110 | ||
| b) Die Sicht des Verfassers | 113 | ||
| 7. Eine Miteignerstellung des Arbeitnehmers im Unternehmen und die Mitbestimmung am Arbeitsplatz | 120 | ||
| a) Die Beteiligung am Produktiveigentum | 120 | ||
| b) Die Gewinnbeteiligung | 121 | ||
| c) Die Mitbestimmung am Arbeitsplatz | 122 | ||
| d) TV-Autonomie und Beteiligung am Produktivvermögen, Gewinnbeteiligung und Mitbestimmung am Arbeitsplatz | 123 | ||
| Kapitel IV: Entwicklung des Gedankens der TV-Autonomie Zusammenfassung | 125 | ||
| Kapitel V: Die Tragweite der TV-Autonomie nach einfachem Recht Einzelfragen | 129 | ||
| 1. Die Regelungsbereiche der TV-Autonomie nach dem TVG | 129 | ||
| a) Inhalt, Abschluß und Beendigung von Arbeitsverhältnissen | 129 | ||
| b) Betriebliche Fragen | 131 | ||
| c) Betriebsverfassungsrechtliche Fragen | 133 | ||
| d) Gemeinsame Einrichtungen | 136 | ||
| 2. Tragweite der Regelungsbereiche | 139 | ||
| 3. Bindung der TV-Autonomie | 140 | ||
| a) Allgemeines | 140 | ||
| b) Bindung an die Verfassung und ihre Anerkennung | 141 | ||
| c) Bindung an eine mit Art. 9 Abs. 3 GG erfolgende Aussage | 142 | ||
| d) Bindung an die Grundrechte allgemein | 146 | ||
| e) Bindung an Art. 12 Abs. 1 GG | 147 | ||
| aa) Berufsfreiheit des Unternehmers | 148 | ||
| bb) Berufsfreiheit des Arbeitnehmers | 155 | ||
| cc) Der Zusammenhang der Berufsfreiheit des Unternehmers mit der Berufs- und der Arbeitsplatzwahlfreiheit des Arbeitnehmers | 162 | ||
| dd) Ausschluß der laboristischen Wirtschaftsordnung bei der Anerkennung der Berufsfreiheit, insbesondere der Berufsfreiheit des Unternehmers und des Arbeitnehmers | 166 | ||
| f) Der Koalitionspluralismus und die negative Koalitionsfreiheit. Der Solidaritätsbeitrag | 167 | ||
| g) Menschenwürde, Sozialstaatsprinzip, Rechtsstaatsprinzip | 171 | ||
| h) Das Gemeinwohl | 174 | ||
| aa) Allgemeines | 174 | ||
| bb) Das konkrete Gemeinwohl | 176 | ||
| cc) Die TV-Autonomie und das Gemeinwohl | 178 | ||
| i) Betriebs-Autonomie – TV-Autonomie | 184 | ||
| 4. Die Allgemeinverbindlicherklärung | 187 | ||
| a) Allgemeines | 187 | ||
| b) Die umgreifende Wirkung der betrieblichen und betriebsverfassungsrechtlichen Regelungen. Ihre Allgemeinverbindlicherklärung | 190 | ||
| c) Die Allgemeinverbindlicherklärung und gemeinsame Einrichtungen | 193 | ||
| d) Geltungsbereich des für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages bei Vorhandensein mehrerer Tarifverträge | 197 | ||
| e) Beendigung der Allgemeinverbindlicherklärung | 203 | ||
| f) Schlußbemerkungen | 206 | ||
| 5. Der Normencharakter der tarifrechtlichen Regelungen | 207 | ||
| a) Allgemeines | 207 | ||
| b) Rückwirkung von Tarifnormen | 208 | ||
| c) Schriftform und Publikation der Tarifverträge | 211 | ||
| 6. Die Tarifregelungen als Mindestregelungen | 212 | ||
| a) Allgemeines | 212 | ||
| b) Das Günstigkeitsprinzip | 214 | ||
| aa) Günstigkeitsprinzip und Tarifnormen als Höchstbedingungen | 214 | ||
| bb) Die Tragweite des Günstigkeitsprinzips und allgemeine sozialethische Erwägungen in diesem Zusammenhang | 216 | ||
| c) Schlußbemerkung | 220 | ||
| 7. Der schuldrechtliche Teil des Tarifvertrages | 221 | ||
| a) Allgemeines | 221 | ||
| b) Beispiele für schuldrechtliche Beziehungen der TV-Parteien. Im Zusammenhang hiermit stehende Fragen | 222 | ||
| c) Die Einwirkungspflicht | 227 | ||
| d) Die Tariferfüllungspflicht | 228 | ||
| e) Eintreten der Einwirkungs- und Erfüllungspflicht | 229 | ||
| f) Schriftform der schuldrechtlichen Vereinbarungen? | 230 | ||
| Kapitel VI: Von der TV-Autonomie verlangte Strukturforderungen Notwendige Kennzeichen tariffähiger Koalitionen | 232 | ||
| 1. Gegnerreinheit und Gegnerfreiheit der Koalitionen | 232 | ||
| a) Das allgemeine Prinzip | 232 | ||
| b) Umfassende Betrachtung der Rechtslage | 233 | ||
| aa) Die Leitenden Angestellten | 233 | ||
| bb) Die Chef-Manager | 236 | ||
| cc) Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat | 236 | ||
| c) Die sozialethische Grundlage der Prinzipien der Gegnerreinheit und Gegnerfreiheit | 237 | ||
| d) Grundsätzliche Einzelfragen zur Gegnerfreiheit | 239 | ||
| e) Besondere Fragen zur Gegnerunabhängigkeit | 242 | ||
| 2. Das Mächtigkeitsprinzip | 244 | ||
| a) Die Rechtslage | 244 | ||
| b) Die sozialethische Grundlage des Mächtigkeitsprinzips | 245 | ||
| c) Das Mächtigkeitserfordernis und der Gedanke der Konfliktgesellschaft | 248 | ||
| d) Rechtliches Gewicht des Mächtigkeitspostulates | 249 | ||
| aa) Der Mächtigkeitsgedanke kein bloßes Axiom der TV-Autonomie. Die Notwendigkeit des tatsächlichen Vorliegens der Mächtigkeit und ihre Feststellbarkeit | 249 | ||
| bb) Keine Rückwirkung auf die Wirksamkeit der Normenregelungen bei späterem Angriff auf die Tariffähigkeit eines Verbandes wegen fehlender Mächtigkeit | 253 | ||
| cc) Wirkung der rechtskräftigen Entscheidung zur Frage der Mächtigkeit für die Zukunft | 254 | ||
| dd) Das Erfordernis der Mächtigkeit bei einem bilateralen Monopol der TV-Parteien | 255 | ||
| e) Die Mächtigkeit und die Unabhängigkeit der TV-Parteien | 255 | ||
| f) Aushöhlung der positiven Koalitionsfreiheit durch das Mächtigkeitspostulat? | 257 | ||
| g) Die Mächtigkeit und die Unabhängigkeit der Koalitionen | 259 | ||
| h) Die Autorität der Koalitionen gegenüber ihren Angehörigen | 260 | ||
| 3. Die Tariffähigkeit des einzelnen Arbeitgebers | 262 | ||
| 4. Die Staatsneutralität | 264 | ||
| a) Die Rechtslage | 264 | ||
| b) Die Begrenzung der Staatsneutralität | 265 | ||
| c) Keine „fördernde Neutralität“ des Staates | 266 | ||
| d) Die zwei Zielrichtungen der staatlichen Neutralität | 267 | ||
| e) Äußerungen von Repräsentanten des Staates und des politischen Lebens während der Tarifverhandlungen | 267 | ||
| f) Die öffentliche Meinung | 268 | ||
| g) Sozialethische Wertung der Staatsneutralität | 269 | ||
| h) Das Neutralitätsprinzip und die Tariffähigkeit des einzelnen Arbeitgebers | 271 | ||
| Kapitel VII: Der Arbeitskampf | 272 | ||
| 1. Die rechtliche Notwendigkeit und die sozialethische Akzeptanz des Arbeitskampfes als Instrument zur Lösung des Tarifkonfliktes bei einer Nicht-Einigung der TV-Parteien | 272 | ||
| a) Die Möglichkeiten zur Lösung des Konflikts. Die gegenüber den einzelnen Möglichkeiten jeweils bestehenden Bedenken | 272 | ||
| b) Der Arbeitskampf als ein rechtlich wesentlicher und verfassungsrechtlich gewährleisteter Annex der TV-Autonomie | 274 | ||
| c) Die sozialethische Bewertung des Arbeitskampfes | 276 | ||
| aa) Die Bedeutung einer Einigung durch die Sachnahen | 277 | ||
| bb) Die Bedeutung der zu regelnden Fragen | 277 | ||
| cc) Das Gewicht der Übel | 278 | ||
| dd) Weitere Erwägungen | 278 | ||
| ee) Die Kampfparität | 279 | ||
| d) Das Verhältnismäßigkeitsprinzip im Arbeitskampf | 280 | ||
| aa) Tragweite des Grundsatzes | 280 | ||
| bb) Das Verhältnismäßigkeitsprinzip als Wesensmerkmal des Rechtsstaats im Arbeitskampf | 281 | ||
| cc) Die Offensichtlichkeit der Gemeinwohlverletzung als Kriterium eines Verstoßes gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz | 282 | ||
| dd) Näheres Ergebnis der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips auf den Arbeitskampf | 282 | ||
| ee) Abschließende zusammenfassende Bemerkungen | 285 | ||
| ff) Keine Tarifzensur | 286 | ||
| 2. Der Unternehmensverbund und der Arbeitskampf | 287 | ||
| 3. Arbeitskampffreiheit oder Arbeitskampfbefugnis? | 288 | ||
| 4. Die Staatsneutralität im Arbeitskampf | 291 | ||
| a) Unmittelbar am Arbeitskampf Beteiligte und Betroffene. Die Arbeitslosenversicherung mit ihrer besonderen Frage | 291 | ||
| b) Der Teilstreik. Der Arbeitskampf mit Modell- oder Signalcharakter | 293 | ||
| c) Die öffentlich-rechtlichen Leistungen außerhalb des Bereiches der Arbeitslosigkeit | 294 | ||
| d) Die Auswirkungen des Arbeitskampfes auf Bereiche, die keine Beziehung zu dem angestrebten Tarifvertrag haben | 295 | ||
| e) Die Sozialhilfe | 295 | ||
| 5. Die Arbeitskampfmittel | 296 | ||
| a) Allgemeines | 296 | ||
| b) Der Streik | 297 | ||
| aa) Begriffsbestimmung und Arten des Streiks | 297 | ||
| bb) Wahlfreiheit im Einsatz verschiedener Streikarten | 299 | ||
| cc) Die Massenänderungskündigung kein Kampfmittel der Arbeitnehmerseite | 299 | ||
| dd) Betriebsbesetzungen und Betriebsblockaden? | 299 | ||
| c) Die Aussperrung | 301 | ||
| aa) Die Frage der Rechtmäßigkeit der Aussperrung | 301 | ||
| bb) Alternativen zur Aussperrung? | 301 | ||
| (1) Die arbeitgeberseitige Kündigung? | 301 | ||
| (2) Allgemeine Bemerkung zu Kündigungen als Arbeitskampfmittel | 302 | ||
| (3) Kein Ersatz der Aussperrung durch „passive“ Mittel | 303 | ||
| (4) Rationalisierung anstelle von Aussperrung als arbeitgeberseitige Kampfmaßnahme? | 304 | ||
| (5) Produktionsverlagerung? | 306 | ||
| (6) Gemeinsame Bemerkung zur Rationalisierung und Verlagerung | 306 | ||
| (7) Keine sonstigen alternativen Kampfmittel der Arbeitgeber | 306 | ||
| cc) Ergebnis: Die Angriffsaussperrung | 307 | ||
| dd) Die Abwehraussperrung | 309 | ||
| ee) Sozialethische Wertung der Aussperrung | 310 | ||
| d) Der Boykott | 312 | ||
| aa) Der Boykott als immanenter Bestandteil von Streik und Aussperrung | 312 | ||
| bb) Unzulässigkeit des Boykotts als selbständiges Kampfmittel | 313 | ||
| 6. Zum Ausmaß und zur Betroffenheit bei Arbeitskämpfen | 315 | ||
| a) Der Sympathiearbeitskampf | 315 | ||
| b) Die legitim und legal im Arbeitskampf stehenden Angehörigen des Arbeits- und Wirtschaftslebens | 316 | ||
| aa) Die Nicht-Organisierten | 317 | ||
| bb) Koalitionsangehörige | 318 | ||
| cc) Anders-Organisierte | 319 | ||
| c) Der öffentliche Dienst und der Arbeitskampf | 319 | ||
| aa) Die TV-Autonomie und der öffentliche Dienst | 319 | ||
| bb) Der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst | 321 | ||
| 7. Rechtspolitische Fragen zum Arbeitskampfrecht | 323 | ||
| 8. Das Schlichtungswesen | 327 | ||
| a) Die Rechtslage | 327 | ||
| b) Die Frage einer Praktikabilität der Schlichtung | 327 | ||
| aa) Zur tatsächlichen Situation | 328 | ||
| bb) Praktikable Schlichtungsmöglichkeiten | 328 | ||
| cc) Die vereinbarte verbindliche Schlichtung | 329 | ||
| c) Die Zwangsschlichtung | 330 | ||
| d) Schlußbemerkung | 331 | ||
| Kapitel VIII: Zusammenfassung und Ergänzung | 332 | ||
| 1. Die TV-Autonomie als Schutzeinrichtung und als Ordnungsinstitution. Zu ihrer Bedeutung als ordnungspolitische Größe | 332 | ||
| 2. Der Gemeinwohlbezug der TV-Autonomie | 334 | ||
| 3. Eine europäische TV-Autonomie | 335 | ||
| 4. Grenzen der TV-Autonomie | 338 | ||
| 5. TV-Autonomie – Betriebsautonomie | 339 | ||
| 6. Das Verhältnis zwischen TV-Autonomie und staatlicher Gesetzgebung | 341 | ||
| 7. Neue Technologien und die TV-Autonomie | 343 | ||
| 8. Wirtschaftliche Entwicklung und der Arbeitnehmerbegriff | 344 | ||
| 9. Normalarbeitsverhältnis und Teilzeitarbeit | 347 | ||
| 10. Die demokratische Struktur der Koalitionen | 348 | ||
| 11. Das Vorgehen der TV-Parteien | 349 | ||
| 12. Der Subsidiaritätsgedanke | 350 | ||
| 13. Die Koalitionen: Gesellschaftliche Größen mit öffentlichen Aufgaben und einem öffentlichen Status | 352 | ||
| 14. Die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Akzeptanz der TV-Autonomie. Ihre Fragilität | 353 |
