Entstehung und Wettbewerb von Systemen
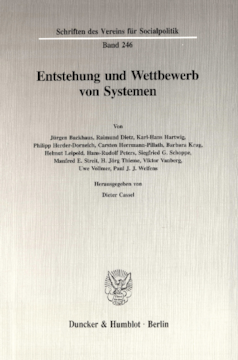
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Entstehung und Wettbewerb von Systemen
Editors: Cassel, Dieter
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Vol. 246
(1996)
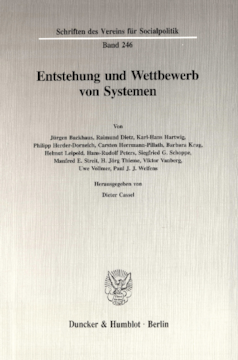
BOOK
Editors: Cassel, Dieter
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Vol. 246
(1996)