Die Fragestunde im Deutschen Bundestag
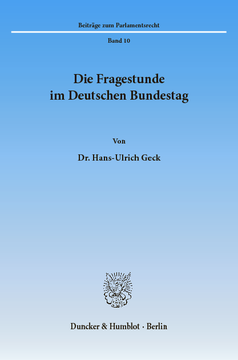
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Fragestunde im Deutschen Bundestag
Beiträge zum Parlamentsrecht, Vol. 10
(1986)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Geleitwort | 7 | ||
| Vorwort | 9 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 11 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 14 | ||
| A. Aufgabe und Gang der Untersuchung | 17 | ||
| B. Die historische Entwicklung der Fragestunde | 19 | ||
| I. Die Question Time im House of Commons als Vorbild für die Fragestunde im Deutschen Bundestag | 19 | ||
| II. Die Question Time | 20 | ||
| 1. Die Tradition der Question Time | 20 | ||
| a) Die geringe Bedeutung der Fragen im 18. Jahrhundert | 21 | ||
| b) Die Zunahme der Bedeutung der Fragen im 19. Jahrhundert als Folge der Herausbildung der ministeriellen Verantwortlichkeit | 21 | ||
| c) Die Herausbildung der Question Time um die Jahrhundertwende | 22 | ||
| d) Zusammenfassung | 25 | ||
| 2. Der Ablauf der Question Time | 25 | ||
| a) Die Einreichung der Fragen | 26 | ||
| b) Die Prüfung der Fragen auf ihre Zulässigkeit | 27 | ||
| c) Die Fragen an den Premierminister | 28 | ||
| d) Die Festlegung der Reihenfolge der Fragen | 29 | ||
| e) Die Aufgaben des Speaker | 30 | ||
| f) Die Zulässigkeit von Private Notice Questions | 30 | ||
| g) Zusammenfassung | 30 | ||
| III. Die Einführung der Fragestunde im Deutschen Bundestag im Jahre 1952 | 31 | ||
| IV. Die Einführung der Richtlinien im Jahre 1960 | 35 | ||
| 1. Die Herausbildung der Richtlinien | 36 | ||
| 2. Grundsätzliche Überlegungen zum Ablauf der Fragestunde im Jahre 1960 | 41 | ||
| 3. Die 19 Richtlinien | 42 | ||
| 4. Die Rolle des Ältestenrates bei der Ausarbeitung der Richtlinien | 46 | ||
| V. Die Änderung der Richtlinien im Jahre 1970 | 47 | ||
| VI. Die Änderung der Richtlinien im Jahre 1980 | 53 | ||
| C. Der Ablauf der Fragestunde | 56 | ||
| I. Der Geschäftsgang der Mündlichen Anfragen bis zur Behandlung im Plenum | 56 | ||
| II. Die Mündlichen Anfragen im Parlament | 57 | ||
| D. Die rechtliche Qualifizierung der Fragestunde | 58 | ||
| I. Die Ausübung parlamentarischer Kontrolle in der Fragestunde | 58 | ||
| 1. Begriff und Eigenart der Kontrolle | 59 | ||
| 2. Die Gestaltung parlamentarischer Kontrolle | 61 | ||
| 3. Konsequenzen für die Fragestunde | 63 | ||
| II. Die Auskunftspflicht der Regierung | 63 | ||
| 1. Die Herleitung aus § 105 GOBT i. V. m. der Anlage 4 GOBT | 63 | ||
| 2. Die Herleitung aus Art. 43 Abs. 1 GG | 64 | ||
| a) Die „Konkretisierungsthese“ | 65 | ||
| b) Kritik an der „Konkretisierungsthese“ | 66 | ||
| 3. Auskunftspflicht und Wirksamkeit der Kontrolle | 70 | ||
| a) Das Verhältnis von Information und Kontrolle | 70 | ||
| b) Die Informationslage des Bundestages | 71 | ||
| c) Die Informationszuständigkeit des Bundestages | 72 | ||
| d) Die Informationsverschaffungspflicht der Regierung als Folge der Notwendigkeit wirksamer parlamentarischer Kontrolle | 73 | ||
| aa) Bestätigung des Ergebnisses durch fehlende gegenläufige parlamentarische Praxis | 77 | ||
| bb) Keine Widerlegung des Ergebnisses aufgrund historischer Betrachtung der Fragestunde und der Verfassungslage in den Ländern | 78 | ||
| aaa) Historische Betrachtung der Fragestunde | 78 | ||
| bbb) Verfassungslage in den Ländern | 78 | ||
| cc) Weitere spezielle Verfassungsnormen als Bestätigung der Auskunftspflicht | 79 | ||
| 4. Der Umfang der Auskunftspflicht der Regierung | 81 | ||
| a) Der Verantwortungsbereich der Regierung | 81 | ||
| b) Grenzen der Auskunftspflicht | 87 | ||
| aa) Der Internbereich der Regierung | 87 | ||
| bb) Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland | 89 | ||
| cc) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht | 94 | ||
| c) Ergebnis | 96 | ||
| E. Das Fragerecht | 98 | ||
| I. Das Fragerecht des Abgeordneten als Statusrecht nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG | 98 | ||
| 1. Der Begriff „Status“ | 98 | ||
| 2. Der Inhalt des Status | 101 | ||
| II. Die Zulässigkeit von Richtlinien zur Ausübung des Fragerechts in der Anlage 4 GOBT | 104 | ||
| III. Inhaltliche Schranken für das Fragerecht | 105 | ||
| 1. Die Funktionsfähigkeit der Fragestunde als Instrument parlamentarischer Kontrolle | 105 | ||
| 2. Die Abgeordnetenfreiheit als Grenze inhaltlicher Schranken | 106 | ||
| IV. Maßstab für die verfassungsrechtliche Überprüfung der Richtlinien | 107 | ||
| 1. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit | 107 | ||
| 2. Die Einhaltung des „gesetzgeberischen Ermessens“ in bezug auf die Durchführung parlamentarischer Kontrolle | 109 | ||
| V. Die Auslegung der Richtlinien in Anlage 4 der GOBT | 109 | ||
| 1. Die Bedeutung der parlamentarischen Praxis für die Auslegung | 109 | ||
| 2. Der Einfluß des 1. Ausschusses und des Ältestenrates auf die parlamentarische Praxis | 110 | ||
| 3. Kriterien für die Auslegung | 111 | ||
| 4. Die Auslegung einzelner Richtlinien | 112 | ||
| a) Nr. 1 Abs. 2 i. V. m. Nr. 1 Abs. 3 Satz 2 | 112 | ||
| b) Nr. 1 Abs. 3 Satz 1 | 113 | ||
| c) Nr. 1 Abs. 3 Satz 2 | 114 | ||
| d) Nr. 2 Abs. 2 | 115 | ||
| e) Zusammenfassung | 116 | ||
| VI. Rechtsschutz des Abgeordneten bei Auskunftsverweigerung der Bundesregierung | 117 | ||
| F. Die Prüfungskompetenz des Bundestagspräsidenten | 118 | ||
| I. Die Zulässigkeitsprüfung gemäß den Richtlinien | 118 | ||
| II. Die Prüfung auf Verletzung von Grundrechten privater Dritter | 120 | ||
| III. Rechtsschutz des Abgeordneten bei Zurückweisung der Fragen | 121 | ||
| G. Der Indemnitätsschutz nach Art. 46 Abs. 1 GG | 122 | ||
| I. Der Indemnitätsschutz des Abgeordneten | 122 | ||
| II. Der Indemnitätsschutz des Regierungsvertreters | 124 | ||
| H. Die Bedeutung der Fragestunde in der parlamentarischen Praxis | 127 | ||
| I. Zahlen | 127 | ||
| II. Ursachen für die geringe Beteiligung der Abgeordneten | 128 | ||
| III. Vorschläge für eine Belebung der Fragestunde | 130 | ||
| a) Einführung einer Befragung des Bundeskanzlers nach dem Vorbild der Prime Minister’s Question Time | 130 | ||
| b) Aufruf dringlicher Fragen im Anschluß an die Fragestunde | 130 | ||
| c) Verbot der Umwandlung von Fragen zur mündlichen Beantwortung in Fragen zur schriftlichen Beantwortung | 130 | ||
| Zusammenfassung | 132 | ||
| Schrifttum | 134 |
