Die Bestrafung des Ratgebers
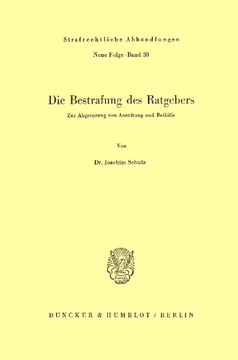
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Bestrafung des Ratgebers
Zur Abgrenzung von Anstiftung und Beihilfe
Strafrechtliche Abhandlungen. Neue Folge, Vol. 38
(1980)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Die »Strafrechtlichen Abhandlungen - Neue Folge« wurden 1957 von Eberhard Schmidhäuser in Zusammenarbeit mit den deutschen Strafrechtslehrern in der Nachfolge der von Hans Bennecke begründeten »Strafrechtlichen Abhandlungen« (1896 bis 1942) eröffnet. Ihr Ziel ist es, wie das ihrer Vorgängerin, hervorragenden Arbeiten des strafrechtswissenschaftlichen Nachwuchses eine angemessene Veröffentlichung zu sichern. Aufgenommen werden ausgezeichnete Dissertationen und Habilitationen zum Strafrecht und Strafprozessrecht sowie zur Straftheorie. 1986 wurde Friedrich-Christian Schroeder (Regensburg) zum Herausgeber bestellt, 2007 trat Andreas Hoyer (Kiel) als weiterer Herausgeber an die Stelle des verstorbenen Eberhard Schmidhäuser. Die Aufnahme in die Reihe erfolgt auf Vorschlag eines Strafrechtslehrers.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Einleitung | 9 | ||
| Erster Abschnitt: Der Meinungsstand zum Problem der Umstimmung | 11 | ||
| A. Einführung in die Problemstellung | 11 | ||
| B. Die analytischen Meinungen (Das Problem der Entschlußergänzung) | 16 | ||
| I. Grundlagen | 16 | ||
| 1. Die Unterscheidung von Tatplanergänzung und Tatplanmodifikation | 16 | ||
| 2. Die Unklarheit des Ergänzungsbegriffs (Die Funktionalität von plus und aliud) | 17 | ||
| 3. Folgen der Funktionalität von plus und aliud | 20 | ||
| a) Ein abstrakter Begriff von „Ergänzen“ | 21 | ||
| aa) Welzel | 22 | ||
| bb) Samson | 22 | ||
| cc) Die sonstigen Anhänger der analytischen Theorie | 27 | ||
| b) Der ceteris-paribus-Gedanke | 29 | ||
| 4. Resümee | 31 | ||
| II. Das analytische Trennungsprinzip und seine Berechtigung | 31 | ||
| 1. Das Problem der Gesamtverantwortung des Ratgebers in den Ergänzungsfällen | 32 | ||
| a) Die radikale Fassung des Trennungsprinzips (Eser) | 32 | ||
| b) Das gemäßigte Trennungsprinzip | 42 | ||
| aa) Das plus führt zu einem Tatbestandswechsel | 43 | ||
| bb) Das plus führt zu keinem Tatbestandswechsel | 49 | ||
| 2. Resümee | 54 | ||
| III. Zusammenfassende Würdigung der analytischen Meinung | 54 | ||
| C. Die einzelnen Identitätskriterien (Das Problem des aliud) | 56 | ||
| I. Die phänomenalen Identitätskriterien | 57 | ||
| 1. Der Unterschied zwischen phänomenalen und normativen Identitätskriterien | 57 | ||
| 2. Die Ausprägungen des phänomenalen Identitätskriteriums | 61 | ||
| a) Die Übernahme der Lösungen des Exzeßproblems | 61 | ||
| aa) Die dogmatische Einordnung des Exzeßproblems nach der herrschenden Lehre und ihre Konsequenzen | 62 | ||
| bb) Die Verantwortlichkeitsfrage beim Exzeß und beim Ratgeber | 71 | ||
| cc) Der Zusammenhang zwischen Exzeß- und Ratgeberproblematik | 72 | ||
| b) Sonstige Übernahmemöglichkeiten | 74 | ||
| aa) Die Wahlfeststellung | 74 | ||
| bb) Natürliche Handlungseinheit und Fortsetzungszusammenhang | 75 | ||
| c) Die natürliche Betrachtungsweise | 76 | ||
| aa) Die praktische Unvermeidbarkeit der natürlichen Betrachtungsweise | 76 | ||
| bb) Die theoretische Notwendigkeit der natürlichen Betrachtungsweise | 78 | ||
| cc) Natürliche Betrachtungsweise und juristische Rationalität | 80 | ||
| dd) Natürliche Betrachtungsweise und Unrecht (Die Auffassung Storks) | 84 | ||
| ee) Natürliche Betrachtungsweise und der Übergewichtsgedanke (Die Auffassung Roxins) | 87 | ||
| 3. Die Berechtigung des phänomenalen Identitätskriteriums (Die Ansicht Samsons und Heinzes) | 91 | ||
| II. Die normativen Identitätskriterien | 101 | ||
| 1. Die Funktion des normativen Identitätskriteriums | 101 | ||
| 2. Der Inhalt des normativen Identitätskriteriums | 103 | ||
| a) Das Rechtsgut als konstitutives normatives Identitätskriterium (Heinze, Samson) | 105 | ||
| b) Das Rechtsgut als limitierendes normatives Identitätskriterium (Stork) | 115 | ||
| c) Exkurs: Die Ansicht des Bundesgerichtshofs | 120 | ||
| 3. Zusammenfassung | 122 | ||
| Zweiter Abschnitt: Der Begriff des omnimodo facturus | 124 | ||
| I. Allgemeines | 124 | ||
| II. Der omnimodo-facturus-Begriff in Literatur und Rechtsprechung | 125 | ||
| Dritter Abschnitt: Die Abgrenzung von Anstiftung und Beihilfe nach dem Strafgrund der Anstiftung (Die eigene Ansicht) | 130 | ||
| I. Grundlegung der Abgrenzung von Anstiftung und Beihilfe | 130 | ||
| 1. Der Strafgrund der Anstiftung im Rahmen der allgemeinen Teilnahmelehre | 130 | ||
| 2. Der Strafgrund der Anstiftung als Sonderproblem der Teilnahmelehre | 132 | ||
| a) Die Korruption des Täters als Straf(erhöhungs)grund der Anstiftung | 133 | ||
| b) Die besondere Gefährlichkeit des Anstifters als Straf(erhöhungs)grund der Anstiftung | 135 | ||
| 3. Der Strafgrund der „beratenden“ Anstiftung (Die Planherrschaft) | 137 | ||
| 4. Die Schaffung oder Veränderung des deliktischen Sinnzusammenhangs als Haupttyp der Planherrschaft | 145 | ||
| II. Neuralgische Fälle der Planherrschaft | 151 | ||
| 1. Deliktischer Sinnzusammenhang und Motiv | 151 | ||
| 2. Innertatbestandliche Quantitätssteigerungen | 154 | ||
| 3. Deliktischer Sinnzusammenhang und höchstpersönliche Rechtsgüter | 156 | ||
| 4. Die omnimodo-facturus-Frage | 161 | ||
| 5. Deliktischer Sinnzusammenhang nur Haupttyp der Planherrschaft | 162 | ||
| III. Normative Grenzen des Planherrschaftsgedankens | 164 | ||
| 1. Die Bestimmung des normativen Identitätskriteriums | 164 | ||
| 2. Normatives Identitätskriterium und analytische Meinung | 172 | ||
| IV. Die „Abstiftung“ | 176 | ||
| Ergebnis | 179 | ||
| Literatur | 180 |
