Unterlassungsstrafbarkeit und Gesetzlichkeitsgrundsatz
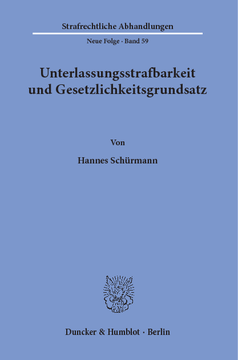
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Unterlassungsstrafbarkeit und Gesetzlichkeitsgrundsatz
Strafrechtliche Abhandlungen. Neue Folge, Vol. 59
(1986)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Die »Strafrechtlichen Abhandlungen - Neue Folge« wurden 1957 von Eberhard Schmidhäuser in Zusammenarbeit mit den deutschen Strafrechtslehrern in der Nachfolge der von Hans Bennecke begründeten »Strafrechtlichen Abhandlungen« (1896 bis 1942) eröffnet. Ihr Ziel ist es, wie das ihrer Vorgängerin, hervorragenden Arbeiten des strafrechtswissenschaftlichen Nachwuchses eine angemessene Veröffentlichung zu sichern. Aufgenommen werden ausgezeichnete Dissertationen und Habilitationen zum Strafrecht und Strafprozessrecht sowie zur Straftheorie. 1986 wurde Friedrich-Christian Schroeder (Regensburg) zum Herausgeber bestellt, 2007 trat Andreas Hoyer (Kiel) als weiterer Herausgeber an die Stelle des verstorbenen Eberhard Schmidhäuser. Die Aufnahme in die Reihe erfolgt auf Vorschlag eines Strafrechtslehrers.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 6 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 8 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 11 | ||
| Einleitung | 14 | ||
| Erster Teil: Der Regelungsgehalt des § 13 | 20 | ||
| 1. Abschnitt: Der „zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehörende Erfolg" | 20 | ||
| A. Der Erfolgsbegriff im Sinne der Abgrenzung „Erfolgsdelikte" - „(schlichte) Tätigkeitsdelikte" | 21 | ||
| I. Erfolg als vom Handeln abstrahierbares Ereignis | 24 | ||
| II. Erfolg als zeitlich und/oder räumlich von der Handlung abgrenzbares Ereignis | 27 | ||
| 1. Erkenntniswert der Abgrenzung für die Begehungsdelikte | 29 | ||
| 2. Bedeutung für die Unterlassensstrafbarkeit nach § 13 | 30 | ||
| III. Ergebnis | 33 | ||
| B. Der alle Begehungsdelikte erfassende Erfolgsbegriff in eigener Sicht | 33 | ||
| I. Struktur der tatbestandlichen Unrechtsbegründung bei den Begehungsdelikten | 34 | ||
| II. „Erfolg" auch als die für die Vollendung ausreichende Gefahr für ein Rechtsgutsobjekt? | 37 | ||
| 1. Die möglichen tatbestandlichen Geschehensausschnitte | 37 | ||
| 2. Bestimmung des Erfolgsbegriffs vom Rechtsgut her | 39 | ||
| a) Erfassen des objektiven Unwertgehalts | 41 | ||
| b) Einbeziehung der subjektiven Unrechtsmerkmale? | 43 | ||
| aa) Bedeutung der subjektiven Unrechtsmerkmale bei den Begehungsdelikten | 43 | ||
| bb) Übertragung auf das Unterlassungsdelikt? | 43 | ||
| (1) Der Handlungswille | 44 | ||
| (2) Die rechtsgutsverletzenden Absichten | 47 | ||
| (a) Absichtliches Unterlassen? | 47 | ||
| (b) Der beabsichtigten Rechtsgutsverletzung entsprechendes Unterlassen? | 49 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 50 | ||
| c) Ergebnis | 50 | ||
| 2. Abschnitt: Das Unterlassen der Erfolgsabwendung | 51 | ||
| A. Die objektive Zurechnung des Erfolges | 51 | ||
| B. Unterlassen der Erfolgsabwendung bei schon eingetretener Rechtsgutsobjekts Verletzung? | 58 | ||
| 3. Abschnitt: Die Wendung „wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, daß der Erfolg nicht eintritt" | 62 | ||
| A. Verweis auf Rechtsnormen, die auf Erfolgsabwendung gerichtete Handlungspflichten statuieren | 62 | ||
| I. Erfolgsabwendungspflichten in §§ 138, 323 c? | 65 | ||
| II. Erfordernis von „Garantenpflichten"? | 67 | ||
| 1. Die amtliche Begründung zu § 13 des Entwurfs 1962 | 68 | ||
| 2. Begründung im sonstigen Schrifttum | 70 | ||
| B. Erfordernis einer Rechtspflicht als überflüssiger oder tautologischer Hinweis? | 72 | ||
| C. Ergebnis | 75 | ||
| 4. Abschnitt: Die „ Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun" - Bedeutung für die Frage der Anwendbarkeit des §13 auf die bereits positivierten Unterlassungsdelikte | 77 | ||
| A. Vorschriften mit ausschließlicher Schilderung von Unterlassungsdelikten | 77 | ||
| B. Vorschriften, in denen sowohl eine Handlung als auch ein Unterlassen erfaßt sind | 78 | ||
| 5. Abschnitt: Das Entsprechenserfordernis | 89 | ||
| A. Der Unwertgehalt als Vergleichsgröße für die Feststellung des Entsprechens? | 90 | ||
| I. Keine „tatsächliche Gleichheit" der Unterlassung nach der amtlichen Begründung zu § 13 | 90 | ||
| II. Unterscheidung von „reinen Erfolgsdelikten" und „verhaltensgebundenen Delikten" als Grundlage der Auslegung des Entsprechenserfordernisses? | 93 | ||
| 1. Der „soziale Sinngehalt" und die „vergleichbare Prägung" des Unterlassens | 96 | ||
| 2. Die „doppelte Gleichwertigkeitsprüfung" | 103 | ||
| 3. Das Entsprechen in den „für die Zurechnung maßgeblichen sachlogischen Strukturen" | 106 | ||
| 4. Ergebnis | 110 | ||
| III. „Gleichwertigkeit" als Gleichheit des Unwerts | 110 | ||
| IV. Unwertgehalt und Strafmilderungsmöglichkeit | 112 | ||
| 1. Beschränkung auf den Unrechtsunwert - Konsequenzen für die Tatbestandsbildung | 113 | ||
| 2. Entsprechen als „annähernde Gleichheit" im Unwertgehalt | 116 | ||
| V. Ergebnis | 118 | ||
| B. Die Ermittlung des „entsprechenden" Unwertgehalts der unterlassenen Erfolgsabwendung | 118 | ||
| I. Erfordernis einer Sonderpflichtverletzung | 119 | ||
| II. Die Bestimmung der sonderunwertbegründenden Merkmale | 120 | ||
| III. Die fehlende Angabe der Sonderpflichtvoraussetzungen in § 13 | 125 | ||
| Zweiter Teil: Die Vereinbarkeit der Regelung in § 13 mit dem Verfassungsgrundsatz der gesetzlichen Strafbarkeitsbestimmung (Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz) | 127 | ||
| 1. Abschnitt: § 13 im Lichte des Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz im gegenwärtigen Schrifttum | 127 | ||
| A. Die Stellungnahmen für die Verfassungsmäßigkeit der Regelung in § 13 | 128 | ||
| B. Verfassungswidrigkeit der Regelung in § 13? | 148 | ||
| C. Ergebnis | 150 | ||
| 2. Abschnitt: Der für § 13 bedeutsame Gehalt des Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz | 152 | ||
| A. Die einzelnen Forderungen des Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz | 152 | ||
| B. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Bestimmtheitsgebot | 157 | ||
| I. Die auf Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit abstellenden Grundsätze | 157 | ||
| II. Die Aufweichung der eigenen Grundsätze bei der praktischen Anwendung | 159 | ||
| C. Das Gebot bestimmter Straftatbestände in eigener Sicht | 165 | ||
| I. Die historische Entwicklung des Gebotes als Verständnisgrundlage seiner heutigen Bedeutung | 165 | ||
| II. Ermittlung der Bedeutimg des Bestimmtheitsgebotes aus dem „Verfassungsganzen" - Das Gebot als Konsequenz des Verständnisses von Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz als Kompetenzzuweisungsnorm im Rahmen der grundgesetzlichen Funktionenverteilung | 171 | ||
| 1. Demokratieprinzip als Grundlage der Funktionenzuweisung | 175 | ||
| a) Funktionell-rechtliches Verständnis der Gesetzgebung | 176 | ||
| b) Funktionell-rechtliches Verständnis der Rechtsprechung | 179 | ||
| c) Konsequenzen | 182 | ||
| 2. Rechtssicherheit durch Zuweisimg der Strafbarkeitsbestimmung an den (demokratischen) Gesetzgeber - Wechselbezogenheit von Demokratieprinzip und Rechtsstaatlichkeit | 183 | ||
| a) Grundrechtsbegrenzung und -ausgestaltung | 183 | ||
| b) Grundrechtsgewährleistung durch Kontrolle im Sinne von Nachvollziehbarkeit | 186 | ||
| 3. Verhältnis Rechtssicherheit - Gerechtigkeit | 187 | ||
| D. Konsequenz für § 13 | 188 | ||
| Ergebnis und Ausblick | 190 | ||
| Literaturverzeichnis | 197 |
