Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und seine gewerblichen Erscheinungsformen
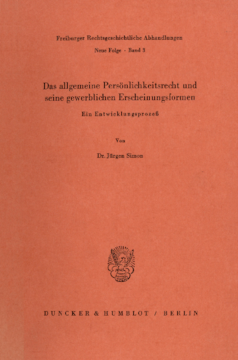
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und seine gewerblichen Erscheinungsformen
Ein Entwicklungsprozeß
Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. N. F., Vol. 3
(1981)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Rechtsgeschichtliche Forschung in Freiburg hat eine lange Tradition. Otto Lenels Rekonstruktionen des Edictum perpetuum und der klassischen Juristenschriften wurden zum unentbehrlichen Rüstzeug der Romanistik auf der ganzen Welt und sind es bis heute geblieben. Aus der Feder Freiburger Forscher stammen zwei der bedeutendsten Gesamtdarstellungen der Rechtsgeschichte: Franz Wieackers »Privatrechtsgeschichte der Neuzeit« und Karl Kroeschells dreibändige »Deutsche Rechtsgeschichte«.Monographien, Editionen, Aufsatz- und Tagungsbände präsentiert das Freiburger Institut für Rechtsgeschichte und geschichtliche Rechtsvergleichung in der Reihe »Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen«. Die Reihe erschien erstmals von 1931 bis 1937. Sie wurde 1978 von Karl Kroeschell, Detlef Liebs und Joseph Georg Wolff wiederbegründet. Die »Abhandlungen« stehen sowohl für Freiburger Forscherinnen und Forscher als auch für Gäste offen.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Gliederung | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 15 | ||
| Allgemeines Persönlichkeitsrecht als Aufgabe und Anspruch | 17 | ||
| Erster Teil: Die geistig-gewerblichen Persönlichkeitsrechte | 21 | ||
| Erstes Kapitel: Das Urheberpersönlichkeitsrecht | 21 | ||
| 1. Problemstellung | 21 | ||
| 2. Geistes- und wirtschaftsgeschichtliche Grundlagen | 22 | ||
| 3. Erste gesetzliche Regelungen des Urheberrechts im 19. Jahrhundert | 27 | ||
| 4. Der Stand der zeitgenössischen Technologie | 29 | ||
| 5. Die Lehre vom geistigen Eigentum | 30 | ||
| 6. Persönlichkeitsrechtliche Opposition zur Lehre vom geistigen Eigentum | 33 | ||
| 7. Das Literatururhebergesetz vom 11. Juni 1870 | 34 | ||
| 8. Das Urheberrecht als Persönlichkeitsrecht | 37 | ||
| a) Carl Gareis | 37 | ||
| b) Otto von Gierke | 38 | ||
| c) Die dualistische Theorie Josef Kohlers | 41 | ||
| d) Die monistische Theorie Philipp Allfelds | 42 | ||
| e) Die trialistische Theorie Alexander Elsters | 43 | ||
| 9. Das Literatururhebergesetz von 1901 in der wissenschaftlichen Diskussion | 44 | ||
| 10. Die Entwicklung des Urheberpersönlichkeitsrechts nach 1927 | 46 | ||
| a) Die Konferenz von Rom und ihre Folgen | 47 | ||
| b) Ausstrahlungen des Begriffs „droit moral“ | 48 | ||
| Zweites Kapitel: Die Rechtsprechung zum Urheberpersönlichkeitsrecht | 49 | ||
| 1. Die Rechtsprechung vor 1900 (LUG von 1870) | 49 | ||
| 2. Die Rechtsprechung bis 1908 (LUG von 1901) | 50 | ||
| 3. Die Rechtsprechung nach dem 1. Weltkrieg | 53 | ||
| a) Strindberg-Urteil | 53 | ||
| b) Erstes Rundfunkurteil (Der Tor und der Tod) | 54 | ||
| c) Zweites Rundfunkurteil (Wilhelm Busch) | 56 | ||
| 4. Das Urheberpersönlichkeitsrecht als ständige Rechtsprechung | 59 | ||
| Drittes Kapitel: Urheberpersönlichkeit im Nationalsozialismus | 61 | ||
| 1. Ideologische Bestimmungen und ihre praktische Bedeutung für das Urheberpersönlichkeitsrecht | 61 | ||
| 2. Die Rechtsprechung als Anwalt der Volksinteressen | 64 | ||
| Viertes Kapitel: Der Schutz des Urhebers in der bildenden Kunst | 68 | ||
| 1. Die Entwicklung der Kunsturhebergesetze und ihres persönlichkeitsrechtlichen Gehalts | 68 | ||
| 2. Der Beitrag der Rechtsprechung | 70 | ||
| a) Das Sirenen(Fresken-)Urteil | 70 | ||
| b) Die Erweiterung des Schutzbereichs | 73 | ||
| Fünftes Kapitel: Das Persönlichkeitsrecht des Verlegers | 76 | ||
| Sechstes Kapitel: Persönlichkeitsrecht des ausübenden Künstlers | 82 | ||
| Siebtes Kapitel: Die Anerkennung der Erfinderehre | 88 | ||
| 1. Zur Geschichte des Erfinderrechts | 88 | ||
| a) Die Entwicklung bis zum Gesetz von 1877 | 88 | ||
| b) Das Patentwesen nach 1877 | 93 | ||
| 2. Die Patentgesetze von 1877 und 1891 | 96 | ||
| 3. Das Persönlichkeitsrecht an der Erfindung | 98 | ||
| a) Das Recht vor Anmeldung der Erfindung | 98 | ||
| b) Das Recht am angemeldeten Patent | 99 | ||
| 4. Das Gesetz von 1936 | 103 | ||
| 5. Der Beitrag der Rechtsprechung | 105 | ||
| Achtes Kapitel: Der angestellte Erfinder | 108 | ||
| 1. Die Ausgangssituation | 109 | ||
| 2. Persönlichkeitsrechtliche Tendenzen zugunsten des angestellten Erfinders | 112 | ||
| Neuntes Kapitel: Wettbewerbsrecht | 117 | ||
| 1. Allgemeines Wettbewerbsrecht und Persönlichkeitsrecht | 117 | ||
| a) Zur Geschichte wirtschaftlichen Wettbewerbs | 117 | ||
| b) Persönlichkeits- oder Immaterialgüterschutz: die Anfänge der Auseinandersetzung | 122 | ||
| c) Stärkung des privatrechtlichen Standpunkts in den 20er Jahren | 125 | ||
| d) Gegenläufige Tendenzen in den 30er Jahren | 126 | ||
| Zehntes Kapitel: Schutz der Arbeitskraft | 129 | ||
| 1. Sozialgeschichtliche Voraussetzungen | 129 | ||
| 2. Schutz der Arbeitskraft als Persönlichkeitsrecht durch § 823 Abs. 1 BGB? | 130 | ||
| 3. Die Folgediskussion um ein Persönlichkeitsrecht auf Schutz der Arbeitskraft | 132 | ||
| Elftes Kapitel: Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb | 134 | ||
| 1. Wirtschaftsgeschichtliche Voraussetzungen | 134 | ||
| 2. Persönlichkeitsrechtliche Tendenzen in der Rechtsprechung um 1900 | 135 | ||
| 3. Der gleichzeitige Streit um das geschützte Rechtsgut in der Wissenschaft | 140 | ||
| 4. Stärkung der persönlichkeitsrechtlichen Argumentation durch die Rechtsprechung um 1930 | 141 | ||
| Zwölftes Kapitel: Namens-, Warenzeichen- und Firmenrecht | 145 | ||
| 1. Die Entwicklung des Namensrechts zum Persönlichkeitsrecht | 145 | ||
| 2. Die Entwicklung des Warenzeichens zum Persönlichkeitsrecht sowie ihre Umkehrung | 146 | ||
| 3. Der persönlichkeitsrechtliche Schutz der Firma | 151 | ||
| Zweiter Teil: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht als subjektives Recht: Ein dogmatischer Hindernislauf | 155 | ||
| Erstes Kapitel: Die Gesetzgebungsgeschichte des § 823 Abs. 1 BGB | 155 | ||
| 1. Der Vorschlag des ersten Entwurfs | 156 | ||
| 2. Vorschlag und Diskussion zum zweiten Entwurf | 157 | ||
| 3. Die Problematik des § 727 des ersten Entwurfs | 158 | ||
| 4. Die Revision des zweiten Entwurfs | 159 | ||
| 5. Schutz eines allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder einzelner Rechtsgüter durch § 823 Abs. 1 BGB | 161 | ||
| 6. Zusammenfassung | 163 | ||
| EXKURS: Die Ablehnung des immateriellen Schadenersatzes | 166 | ||
| Zweites Kapitel: Der Streit um das allgemeine Persönlichkeitsrecht als subjektives Recht vor 1900 | 169 | ||
| 1. Die rechtsphilosophischen Grundlagen | 169 | ||
| a) Immanuel Kant | 169 | ||
| b) Georg Wilhelm Friedrich Hegel | 170 | ||
| 2. Friedrich Carl von Savigny | 173 | ||
| 3. Georg-Friedrich Puchta | 178 | ||
| 4. Der weitere Diskussionsverlauf zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht als subjektivem Recht | 180 | ||
| a) Karl-Adolph v. Vangerow | 180 | ||
| b) Bernhard Windscheid | 180 | ||
| c) Carl Neuner | 181 | ||
| d) Rudolph von Jhering und Carl-Georg Bruns | 182 | ||
| 5. Carl Gareis | 184 | ||
| 6. Josef Kohler | 186 | ||
| 7. Otto von Gierke | 187 | ||
| 8. Erste Ergebnisse als Konturen und Tendenzen | 189 | ||
| Drittes Kapitel: Der Streit um ein allgemeines Persönlichkeitsrecht als subjektives Recht nach 1900 | 191 | ||
| 1. Die Begründung des Persönlichkeitsrechts aus der zentralen Stellung des subjektiven Rechts und der Entstehungsgeschichte des § 823 Abs. 1 (Heinrich Dernburg) | 191 | ||
| 2. Restriktive Bestimmung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts trotz extensiver Auslegung des subjektiven Rechts (Paul Eltzbacher) | 193 | ||
| 3. Die Begründung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts als subjektives Recht aus dem Ordnungszusammenhang von § 823 Abs. 1 und 2 BGB (Heinrich Lehmann) | 195 | ||
| 4. Zwischenbilanz einer das allgemeine Persönlichkeitsrecht ablehnenden Position (Andreas v. Tuhr) | 196 | ||
| 5. Unbehagen an der Dogmatik als Grund für eine Wende zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Paul Oertmann) | 199 | ||
| 6. Entstehungsgeschichte und mangelndes Verkehrsbedürfnis als Argument gegen ein allgemeines Persönlichkeitsrecht im Sinne eines subjektiven Rechts (Gottlieb Planck) | 200 | ||
| 7. Ablehnung des Persönlichkeitsrechts als subjektives Recht wegen zu weitreichenden Normschutzes (Enneccerus / Lehmann) | 202 | ||
| 8. Das Persönlichkeitsrecht als bloße Rechtskategorie, nicht als subjektives Recht (A. Wieruszowski) | 204 | ||
| 9. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht als „Mutterboden“ für besondere Persönlichkeitsrechte, nicht als subjektives Recht (Walter Schönfeld) | 205 | ||
| 10. Die dogmatische „Charakterlosigkeit“ des allgemeinen Persönlichkeitsrechts | 206 | ||
| Viertes Kapitel: Beiträge des Schrifttums zur Entwicklung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts außerhalb der Diskussion um ein subjektives Recht | 209 | ||
| 1. Die Wirkung der Grundrechtsartikel der Weimarer Verfassung für ein allgemeines Persönlichkeitsrecht | 209 | ||
| 2. Analogieschlüsse und leitende Rechtsgedanken | 211 | ||
| Fünftes Kapitel: Der Weg der Rechtsprechung | 215 | ||
| 1. Die grundsätzliche Ablehnung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts | 216 | ||
| 2. Freiberufliche Tätigkeit und der Nietzsche-Briefe-Fall | 219 | ||
| 3. Erste Ansätze allgemein-persönlichkeitsrechtlicher Rechtsbildung | 222 | ||
| 4. Verstärkte Hinweise auf eine Annäherung an ein allgemeines Persönlichkeitsrecht | 223 | ||
| Sechstes Kapitel: Die Veränderung des subjektiven Rechts im Nationalsozialismus und seine Auswirkungen auf das Recht der Persönlichkeit | 226 | ||
| Siebtes Kapitel: Die Beiträge der §§ 826 und 1004 BGB zur Entwicklung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts | 231 | ||
| 1. Persönlichkeitsschutz und Persönlichkeitsrechts-Entwicklung über § 826 BGB | 232 | ||
| a) Die Einstellung der Wissenschaft | 232 | ||
| b) Schwerpunkte der Rechtsprechung | 234 | ||
| 2. Zum aktionenrechtlichen Gehalt der Entwicklung des Persönlichkeitsrechts | 240 | ||
| a) Die deliktische Unterlassungsklage | 240 | ||
| b) Die actio quasinegatoria | 241 | ||
| c) Stellungnahme der Wissenschaft | 244 | ||
| Ergebnis | 247 | ||
| Literaturverzeichnis | 251 | ||
| Verzeichnis der Entscheidungen | 263 |
