Die Wissenschaftsfreiheit des Beamten
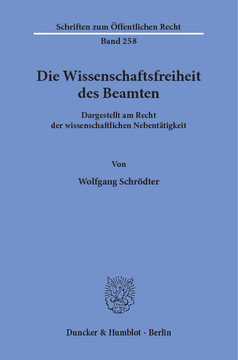
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Wissenschaftsfreiheit des Beamten
Dargestellt am Recht der wissenschaftlichen Nebentätigkeit
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 258
(1974)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsübersicht | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 13 | ||
| Einleitung | 17 | ||
| I. Das Problem | 17 | ||
| II. Methodische Bemerkungen zur Problemlösung | 20 | ||
| Erster Teil: Die verfassungsrechtliche Grundlegung des Rechts der wissenschaftlichen Nebentätigkeit | 24 | ||
| Erster Abschnitt: Der Begriff der Wissenschaft i. S. der Verfassung und des Beamtenrechts | 24 | ||
| A. Die Schwierigkeiten einer Bestimmung des verfassungsrechtlichen Wissenschaftsbegriffs | 25 | ||
| I. Wissenschaftstheorie und Verfassungsrecht | 25 | ||
| II. Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit | 28 | ||
| B. Die Definitionsversuche der h. M. in Lehre und Rechtsprechung und ihre Kritik | 29 | ||
| I. Die einzelnen Spielarten einer inhaltlichen Bestimmung des Wissenschaftsbegriffs | 29 | ||
| 1. Die immer noch akzeptierte Formel Smends | 29 | ||
| 2. Methodik, Systematik und Voraussetzungslosigkeit als Essentialia der Wissenschaftlichkeit? | 30 | ||
| 3. Die Vorschläge der Rechtsprechung | 32 | ||
| 4. Die Auffassung des beamtenrechtlichen Schrifttums zum Begriff der wissenschaftlichen Nebentätigkeit i. S. des § 66 Abs. 1 Nr. 2 BBG | 33 | ||
| II. Kritik dieser inhaltlichen Definitionen | 33 | ||
| 1. Keine Eignung für die Rechtspraxis | 33 | ||
| 2. Die freiheitsbeschränkenden Wirkungen einer inhaltlichen Bestimmung des Wissenschaftsbegriffs | 37 | ||
| C. Art. 5 Abs. 3 GG als Grundlage eines „Definitionsverbotes"? | 41 | ||
| I. Der Tenor dieser Lehrmeinung | 41 | ||
| II. Die Einwände gegen ein Definitionsverbot | 43 | ||
| 1. Definitionsverbot und „Wissenschaftspluralismus" | 43 | ||
| 2. Eine modifizierte Fassung dieser Lehre als Ausweg aus dem Dilemma? | 44 | ||
| 3. Die Wissenschaftstheorie erhält Verfassungsrang | 46 | ||
| D. Versuche einer formalen Bestimmung des Wissenschaftsbegriffs | 47 | ||
| I. Art. 5 Abs. 3 GG — ein Grundrecht allein der Hochschullehrer? | 48 | ||
| 1. Eine enge Bestimmung der personalen Reichweite der Wissenschaftsfreiheit | 48 | ||
| 2. Die Vorzüge dieser Interpretation der Wissenschaftsfreiheit | 51 | ||
| 3. Das systematische Argument | 51 | ||
| 4. Das Argument aus der Entstehungsgeschichte | 52 | ||
| a) § 152 der Paulskirchenverfassung | 53 | ||
| b) Art. 17, 20 der preußischen Verfassungen | 55 | ||
| c) Art. 142 WRV und Art. 5 Abs. 3 GG | 57 | ||
| II. Roelleckes Auslegung der Wissenschaftsfreiheit als „Staatsdienergrundrecht" | 58 | ||
| III. Knemeyers — angeblich — technisch formale Bestimmung des Wissenschaftsbegriffs | 60 | ||
| 1. Die Formel Knemeyers | 60 | ||
| 2. Kritik | 60 | ||
| IV. Zwischenergebnis | 62 | ||
| E. Die eigene formale Bestimmung des Wissenschaftsbegriffs | 63 | ||
| I. Methodische Überlegungen | 63 | ||
| II. Die Alternative „akademische Lehre" i. S. des Art. 5 Abs. 3 GG | 65 | ||
| 1. Die stillschweigende Anerkennung eines formalen Begriffs der akademischen Lehre | 65 | ||
| 2. Der rechtliche Hintergrund dieses formalen Lehrbegriffs | 67 | ||
| 3. Politische Stellungnahmen, „Aufforderung zum Handeln" und „wissenschaftliche Praxis" als akademische Lehre? | 68 | ||
| 4. Ausstrahlung dieses formalen Begriffs der akademischen Lehre auf das Recht der wissenschaftlichen Nebentätigkeit | 73 | ||
| III. Außeruniversitäre Formen der Wortlehre i. S. des Art. 5 Abs. 3 GG | 74 | ||
| 1. Die Abgrenzung der Unterrichtsfreiheit von der Lehrfreiheit | 74 | ||
| 2. Wissenschaftliche Lehre an wissenschaftsbezogenen Bildungseinrichtungen | 76 | ||
| 3. Bedeutung dieses Lehrbegriffs für die Praxis des Rechts der wissenschaftlichen Nebentätigkeit | 80 | ||
| IV. Die wissenschaftliche Schriftlehre | 82 | ||
| 1. Köttgens enge Auslegung des Lehrbegriffs | 82 | ||
| 2. Die formale Umschreibung der Schriftlehre | 83 | ||
| V. Die Forschung | 84 | ||
| 1. Allgemeines | 84 | ||
| 2. Die wissenschaftliche Gutachtertätigkeit eines Beamten unter dem Blickwinkel des Art. 5 Abs. 3 GG und des § 66 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BBG | 86 | ||
| a) Die beamtenrechtliche Argumentation der h. M. | 86 | ||
| b) Der Bereich der genehmigungsfreien wissenschaftlichen Gutachtertätigkeit i. S. des Art. 5 Abs. 3 GG und des § 66 Abs. 1 Nr. 2, 3 BBG | 87 | ||
| VI. Konfrontation des formalen Wissenschaftsbegriffs mit den Prämissen, denen jede Definition des Wissenschaftsbegriffs genügen muß | 90 | ||
| 1. Die Position der Verfassung im Streit um den außerrechtlichen Wissenschaftsbegriff | 91 | ||
| 2. Die Abgrenzung der Wissenschaftsfreiheit von der Meinungsfreiheit | 92 | ||
| 3. Die Bedeutung der formalen Schrankenfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG für den Wissenschaftsbegriff | 92 | ||
| Zweiter Abschnitt: Die Konstruktion beamtenrechtlicher Begrenzungen der Wissenschaftsfreiheit | 95 | ||
| A. § 66 Abs. 2 BBG — eine gegen Art. 5 Abs. 3 GG verstoßende Eingriffsermächtigung? | 95 | ||
| I. Eine mögliche Auffassung zum Verhältnis von Wissenschaftsfreiheit und beamtenrechtlichem Sonderstatus | 95 | ||
| II. Grundrechte und beamtenrechtlicher Sonderstatus. Eine Skizze des Meinungsstandes | 97 | ||
| 1. Die konservative Auffassung | 98 | ||
| 2. Moderne Begründungen | 99 | ||
| 3. Stellungnahme | 99 | ||
| B. Leitlinien für die Entscheidung des Konflikts zwischen der Wissenschaftsfreiheit und dem Beamtenrecht | 101 | ||
| I. Abwägung zwischen der Wissenschaftsfreiheit und dem Beamtenrecht i. S. „praktischer Konkordanz" | 101 | ||
| II. Zwei wichtige Grundsätze | 103 | ||
| 1. Die verfassungsrechtliche Spitzenstellung der Wissenschaftsfreiheit | 103 | ||
| 2. Die Bedeutung des wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Wertes einer wissenschaftlichen Erkenntnis für den Umfang des Art. 5 Abs. 3 GG im Sonderstatus des Beamten | 104 | ||
| Zweiter Teil: Der Konflikt zwischen der Wissenschaftsfreiheit und dem Beamtenrecht — Dargestellt am Recht der wissenschaftlichen Nebentätigkeit | 106 | ||
| Erster Abschnitt: Wissenschaftsfreiheit und „dienstliche Verantwortlichkeit" des Beamten | 106 | ||
| A. Wissenschaftsfreiheit und politische Treuepflicht | 107 | ||
| I. Das Problem. Zugleich eine Skizze des eigenen Lösungsansatzes | 107 | ||
| 1. Die aktuelle Bedeutung des Problems | 107 | ||
| 2. Eine nicht überzeugende Problemlösung | 111 | ||
| 3. Der methodisch notwendige Umweg über die Treueklausel des Art. 5 Abs. 3 Satz 2 GG | 114 | ||
| II. Die Treueklausel des Art. 5 Abs. 3 Satz 2 GG — eine ungeklärte Verfassungsnorm | 115 | ||
| 1. Die Prämissen jeder Interpretation der Treueklausel | 115 | ||
| 2. Kritik der h. M. | 118 | ||
| 3. Zwei widersprüchliche Deutungen | 122 | ||
| 4. Die Pflicht zur Verfassungstreue — ein Moderationsgebot? | 123 | ||
| 5. Die Treueklausel als Fremdkörper im System des verfassungsrechtlichen Verfassungsschutzes | 125 | ||
| a) Der Vorschlag von Köttgen und Schmitt Glaeser | 125 | ||
| b) Die gebotene enge Auslegung einer allgemeinen Pflicht zur Verfassungstreue | 127 | ||
| 6. Zwischenergebnis | 132 | ||
| III. Die eigene beamtenrechtliche Auslegung der Treueklausel | 133 | ||
| 1. Die Pflicht des Beamten zur Verfassungstreue als Gegenstand der Verweisung i. S. des Art. 5 Abs. 3 Satz 2 GG | 133 | ||
| 2. Die Vorzüge dieser beamtenrechtlichen Interpretation der Treueklausel — Diskussion einzelner Einwände | 134 | ||
| IV. Die Pflicht des wissenschaftlich tätigen Beamten zur Verfassungstreue | 137 | ||
| 1. Pflicht zur Verfassungstreue — ein mehrdeutiger Begriff | 137 | ||
| 2. Die politische Treuepflicht i. S. des § 52 Abs. 2 BBG — ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums? | 139 | ||
| 3. Der verfassungsrechtlich zulässige Inhalt einer Pflicht des Wissenschaftlers zur Verfassungtreue | 141 | ||
| 4. Die Bedeutung der Art. 9 Abs. 2, 18 und 21 Abs. 2 GG für die disziplinarrechtliche Ahndung einer Treuepflichtverletzung | 145 | ||
| a) Keine Sperrwirkung des Art. 21 Abs. 2 GG | 145 | ||
| b) Keine Sperrwirkung der Art. 9 Abs. 2 GG, 18 GG | 148 | ||
| 5. Die gebotene Differenzierung nach der Funktion des Beamten | 149 | ||
| B. Wissenschaftsfreiheit und beamtenrechtliche „Loyalitätspflicht" | 151 | ||
| I. Das Problem | 151 | ||
| 1. Zur Einführung: Die Fälle Seifert und Schnippenkötter | 151 | ||
| 2. Die sporadische Behandlung des Problems im Schrifttum und in der Verwaltungspraxis | 153 | ||
| II. Der eigene Lösungsvorschlag | 156 | ||
| 1. Die Einordnung der Loyalitätspflicht in den Kontext der Beamtenpflichten | 156 | ||
| 2. Besteht aus Gründen der Loyalität eine Schweigepflicht des Wissenschaftlers? | 157 | ||
| 3. Der Umfang einer Pflicht zur fairen, sachlichen Kritik | 159 | ||
| C. Wissenschaftsfreiheit und beamtenrechtliche Verschwiegenheitspflicht | 162 | ||
| I. Skizze des Problems | 162 | ||
| II. Wissenschaftsfreiheit und private Geheimhaltungsinteressen | 163 | ||
| III. Wissenschaftsfreiheit und öffentliche Geheimhaltungsinteressen | 165 | ||
| 1. Das Schutzgut dieser Geheimhaltungsinteressen | 165 | ||
| 2. Verschwiegenheitspflicht und Informationsanspruch der Öffentlichkeit | 167 | ||
| 3. Bemerkungen zum Begriff des Amtsgeheimnisses i. S. des § 61 Abs. 1 Satz 2 BBG | 171 | ||
| Zweiter Abschnitt: Wissenschaftliche Nebentätigkeit und Mißbrauchsaufsicht (§ 66 Abs. 2 HS 2 BBG) | 173 | ||
| A. Die verfassungsrechtliche Problematik dieser Eingriffsermächtigung vor dem Hintergrund des Strafvollzugsbeschlusses | 173 | ||
| B. § 66 Abs. 2 HS 2 BBG — eine rechtsstaatlichen Grundsätzen widersprechende Eingriffsermächtigung? | 175 | ||
| I. Mißbrauchstatbestand und Rechtsstaatsprinzip | 175 | ||
| 1. Der Meinungsstand zum Begriff des Mißbrauchs i. S. des § 66 Abs. 2 HS 2 BBG | 175 | ||
| 2. Die Mehrdeutigkeit des Mißbrauchstatbestandes | 176 | ||
| II. Mißbrauchsaufsicht und Rechtsstaatsprinzip | 179 | ||
| 1. Der Streit über den Inhalt der Mißbrauchsaufsicht | 179 | ||
| 2. Das entscheidende Argument gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 66 Abs. 2 HS 2 BBG | 180 | ||
| 3. Die Folgen dieser Auslegung des § 66 Abs. 2 HS 2 BBG für die Praxis des Rechts der wissenschaftlichen Nebentätigkeit | 183 | ||
| Literaturverzeichnis | 186 |
