Grundfragen der Staatshaftung bei rechtmäßigen hoheitlichen Eigentumsbeeinträchtigungen
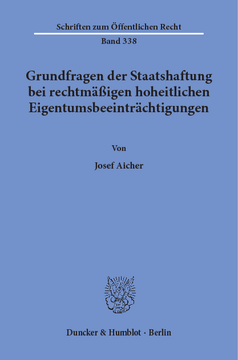
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Grundfragen der Staatshaftung bei rechtmäßigen hoheitlichen Eigentumsbeeinträchtigungen
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 338
(1978)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 11 | ||
| Erster Teil: Einleitung und Problemstellung | 17 | ||
| Zweiter Teil: Die Beeinträchtigung des Eigentums durch rechtmäßige Eingriffe | 25 | ||
| I. Die Abgrenzung der Enteignung von der Eigentumsbeschränkung und die verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie | 25 | ||
| A. Die Notwendigkeit der Unterscheidung von Enteignung und Eigentumsbeschränkung und der Verfassungsschutz des Eigentums in Art. 5 StGG | 25 | ||
| 1. Einleitung | 25 | ||
| 2. Die normative Konzeption des Art. 5 StGG | 26 | ||
| 3. Enteignung und Entschädigung | 32 | ||
| 4. Die Eigentumsbeschränkung und Art. 5 StGG | 60 | ||
| 5. Der kompetenzrechtliche Enteignungsbegriff | 70 | ||
| B. Die Funktion der Wesensgehaltsgarantie bei Eigentumsbeschränkung und Enteignung | 74 | ||
| 1. Die Wesensgehaltsgarantie in der Judikatur des VerfGH | 74 | ||
| 2. Die Judikatur des VerfGH zur „Wesensgehaltssperre" in Art. 5 StGG | 79 | ||
| 3. Der „Doppelcharakter" der Grundrechte | 82 | ||
| a) Einleitung — Rechtsstellungsgarantie und Institutsgarantie | 82 | ||
| b) Die Institutsgarantie in Art. 5 StGG | 86 | ||
| c) Die Institutgsgarantie in Art. 5 StGG und der Gleichheitssatz | 97 | ||
| d) Die Schutzrichtung der Wesensgehaltssperre: Rechtsstellungs- oder Institutsgarantie? | 100 | ||
| e) Die Konkretisierung des Wesensgehaltes der Eigentumsgarantie | 124 | ||
| f) Schlußfolgerungen für die Enteignungsdiskussion | 134 | ||
| II. Die Abgrenzung der Enteignung von der Eigentumsbeschränkung in der bisherigen Lehre und Judikatur | 137 | ||
| A. Der verbal-historisch-formale Enteignungsbegriff des VerfGH | 137 | ||
| 1. Die historische Dimension des Enteignungsbegriffes in der Judikatur des VerfGH | 137 | ||
| 2. Die einzelnen Merkmale des Enteignungsbegriffes in der Judikatur des VerfGH | 139 | ||
| a) Enteignung nur auf Grund oder auch unmittelbar durch Gesetz? | 139 | ||
| b) Die Art des Eingriffs | 140 | ||
| c) Die Rechtsübertragung als Merkmal der Enteignung? | 141 | ||
| d) Die „Vermögensverschiebung" als Merkmal der Enteignung? | 142 | ||
| 3. Der Enteignungsbegriff des VerfGH. Zusammenfassende Kritik | 144 | ||
| B. Die Abgrenzungsversuche der deutschen Lehre und Judikatur und ihr Einfluß auf die österreichische Lehre | 147 | ||
| 1. Die ungleiche Belastung, das besondere Opfer als zutreffender Ansatzpunkt für die Abgrenzung der Enteignung von der Eigentumsbeschränkung | 148 | ||
| 2. Die Einzelaktstheorie | 152 | ||
| a) Charakteristikum und dogmengeschichtliche Entstehungsgründe der Einzelaktstheorie | 152 | ||
| b) Die Einzelaktstheorie in der Judikatur des RG und RStGH und ihre Mängel | 155 | ||
| c) Die Einzelaktstheorie in der österreichischen Lehre | 163 | ||
| 3. Die Sonderopfertheorie (modifizierte Einzelaktstheorie) des BGH | 165 | ||
| a) Die Sonderopfertheorie des BGH und der Gleichheitssatz | 167 | ||
| b) Eingriffsschwere und Folgenschwere als Unterscheidungsmerkmal zwischen Enteignung und Eigentumsbeschränkung in der Judikatur des BGH | 174 | ||
| aa) Wirtschaftliche Betrachtimgsweise, Opfergrenze und Fühlbarkeit des Eingriffs | 174 | ||
| bb) „Pflichtigkeit" und „Situationsgebundenheit" | 179 | ||
| cc) Die Dauer der Bausperre als Zumutbarkeitskriterium | 193 | ||
| dd) Die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs als Zumutbarkeitskriterium | 194 | ||
| ee) Die „Antastung des Wesenskerns" des Eigentumsrechts als Kriterium der Enteignung | 197 | ||
| ff) Anliegerschäden durch Straßenarbeiten und Zumutbarkeit | 202 | ||
| gg) Das private Nachbarrecht als Bestimmungskriterium für die Enteignungsschwere | 204 | ||
| hh) Zusammenfassung | 220 | ||
| 4. Die „Schweretheorie" des BVerwG | 221 | ||
| 5. Die „Privatnützigkeitstheorie" Reinhardts | 229 | ||
| 6. Zusammenfassung. Leitsätze zu den bisherigen Abgrenzungsversuchen in Lehre und Judikatur | 233 | ||
| III. Die Abgrenzung der Enteignung von der Eigentumsbeschränkung an Hand positivrechtlich vorgegebener Kriterien | 235 | ||
| A. Der Lösungsansatz | 235 | ||
| B. Zur Entwicklungsgeschichte der für die Inhaltsbestimmung des Eigentumsrechts relevanten Normen im ABGB | 243 | ||
| 1. Der Codex Theresianus | 243 | ||
| 2. Der Entwurf Horten | 247 | ||
| 3. Der Entwurf Martini | 249 | ||
| 4. Vom Urentwurf bis zum ABGB des Jahres 1811 | 251 | ||
| 5. Das Verhältnis von Eigentumsrecht, Eigentumsbeschränkung und Enteignung in der Entwicklungsgeschichte des ABGB — Zusammenfassimg | 256 | ||
| 6. Die Änderung des ABGB durch die 3. Teilnovelle und das Verhältnis von Eigentumsrecht, Eigentumsbeschränkung und Enteignung | 256 | ||
| C. Die dem Verhältnis von § 364 Abs. 2 ABGB zu § 364 a ABGB zugrunde liegende Wertung als tragfähiges Unterscheidungskriterium zwischen Enteignung und Eigentumsbeschränkung | 259 | ||
| 1. Zur näheren Präzisierung des Begriffes der „Ortsüblichkeit" in §364 Abs. 2 ABGB und seine Funktion als Unterscheidungsmerkmal zwischen zulässigem und unzulässigem Eingriff in das Eigentumsrecht | 260 | ||
| a) Einleitung | 260 | ||
| b) Die Ortsüblichkeit des Eingriffs und die ortsübliche Benutzung des beeinträchtigten Grundstückes als Tatbestandselemente des § 364 Abs. 2 ABGB | 262 | ||
| c) Die Wesentlichkeit des Eingriffs als Tatbestandsmerkmal des §364 Abs. 2 ABGB | 269 | ||
| 2. Die „private Aufopferung" in § 364 a ABGB und der Enteignungstatbestand des § 365 ABGB | 270 | ||
| 3. Die in §364 Abs. 2 ABGB enthaltene Wertentscheidung und deren Anwendbarkeit auf die Unterscheidung von inhaltsbestimmender Eigentumsbeschränkung und Enteignung — Zusammenfassung | 273 | ||
| 4. Der „an sich" gegebene Abwehranspruch und seine Versagung durch § 364 a und § 365 ABGB | 274 | ||
| 5. Zum „öffentlichen Interesse" bei der privaten Aufopferung und bei der Enteignung | 279 | ||
| D. Die Wertungsgrundlagen der §§ 906 BGB und 26 GewO (= 14 BISchG) und der Enteignungstatbestand | 294 | ||
| E. Die unterschiedliche Konzeption des Nachbarrechts in § 364 Abs. 2 ABGB und i n §906 BGB — Ihre Auswirkung auf die Enteignungsproblematik | 296 | ||
| F. Die Wertungsgesichtspunkte des Nachbarrechts und ihre Operationalisierung für die Abgrenzung zwischen Enteignung und Eigentumsbeschränkung | 301 | ||
| 1. Das Tatbestandsmerkmal des Eingriffs in die „ortsübliche Nutzung" | 301 | ||
| a) Die von der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie geschützten Rechtspositionen | 302 | ||
| aa) Der Umfang des verfassungsrechtlichen Eigentumsschutzes | 302 | ||
| bb) Das Eigentum im objektiven Sinn des § 353 ABGB und der Eigentumsschutz in Art. 5 StGG | 305 | ||
| cc) Der Eigentumsschutz in Art. 5 StGG und öffentlichrechtliche Ansprüche | 311 | ||
| aaa) Die Judikatur des VerfGH. Die Lehre Ermacoras | 311 | ||
| bbb) Der Eigentumsschutz öffentlich-rechtlicher Rechtsstellungen i n der Judikatur des BGH. Die Lehre Janssens | 315 | ||
| ccc) Der Eigentumsschutz öffentlich-rechtlicher Rechtsstellungen i n der Judikatur des BVerfG und des BGS | 319 | ||
| ddd) Der eigene Lösungsversuch | 323 | ||
| dd) Der „eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb" als Schutzobjekt der Eigentumsgarantie | 338 | ||
| aaa) Der Eigentumsschutz im Grundsätzlichen | 338 | ||
| bbb) Der Schutzumfang des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs — Das Anliegerrecht | 343 | ||
| b) Beeinträchtigung der „ortsüblichen Nutzung" und eigentumsgarantierte Rechtsposition | 363 | ||
| aa) Zwischenergebnis für den Schutzumfang der Rechtsposition „Eigentum" | 363 | ||
| bb) Eigentumsschutz und Polizeigefahr | 366 | ||
| cc) Baufreiheit und eigentumsgarantierte Rechtsposition | 367 | ||
| c) Eigentumsgarantierte Rechtsposition und Eingirffsqualifikation | 386 | ||
| aa) „Gezielter Eingriff" oder „unmittelbare" Einwirkung? Das Problem der „Eingriffsfinalität" | 386 | ||
| aaa) Drei Fälle als Einleitung | 386 | ||
| bbb) Der „gewollte und gezielte" Eingriff | 390 | ||
| ccc) Die „Unmittelbarkeit" des Eingriffs | 393 | ||
| bb) Eingriffsqualifikation und Folgeschäden | 401 | ||
| 2. Die Wertungsgesichtspunkte des Nachbarrechts als Abgrenzungskriterien zwischen entschädigungslosem und entschädigungspflichtigem Eingriff in Rechtspositionen | 418 | ||
| a) Entschädigungslose Duldungspflicht bei ortsüblichen Eingriffen | 418 | ||
| b) Entschädigungsauslösende Duldungspflicht bei ortsüblichen Eingriffen | 427 | ||
| c) Entschädigungslose Duldungspflicht bei unwesentlichen Beeinträchtigungen | 428 | ||
| d) Entschädigungsauslösende Duldungspflicht bei ortsunüblichen Eingriffen | 429 | ||
| e) Der eigene Vorschlag: Abgrenzung zwischen entschädigungsloser Eigentumsbeschränkung und entschädigungspflichtiger Enteignung | 430 | ||
| Dritter Teil: Die Erläuterung der Unterscheidungskriterien zwischen Enteignung und Eigentumsbeschränkung am Beispiel der Raumplanung (unter besonderer Berücksichtigung der Fragen der Bebauung) | 431 | ||
| I. Die eigentumsrechtliche Relevanz von Landesraumplänen und örtlichen Raumplänen | 431 | ||
| II. Die Enteignungsproblematik bei Landesraumplänen im Hinblick auf die Verbauung | 439 | ||
| III. Die Enteignungsproblematik bei Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen | 442 | ||
| A. Vorbemerkung | 442 | ||
| B. Flächenwidmungsplan und Bausperre | 442 | ||
| C. Flächenwidmungsplan und planabhängiger Verwaltungsakt | 443 | ||
| D. Die Entschädigungsproblematik bei Flächenwidmungsplänen in Judikatur und Lehre | 448 | ||
| 1. Die Judikatur des VerfGH | 448 | ||
| 2. Die Lehre | 451 | ||
| E. Entschädigungspflichtige und entschädigungslose Raumordnungsmaßnahmen | 459 | ||
| 1. Erstmalige Planerlassung | 459 | ||
| 2. Spätere Planänderung | 462 | ||
| F. Überblick über die Entschädigungsregelung in den einzelnen Landesraumordnungsgesetzen | 465 | ||
| G. Kritik der divergierenden Entschädigungsregelungen | 467 | ||
| IV. Die Enteignungsproblematik bei „befristeten Bausperren | 471 | ||
| Literaturverzeichnis | 478 |
