Der Vertrauensschutz im deutschen Straßenverkehrsrecht
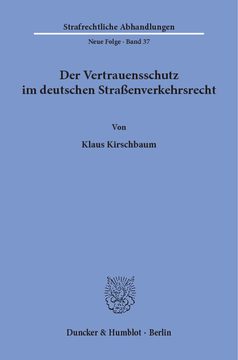
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der Vertrauensschutz im deutschen Straßenverkehrsrecht
Strafrechtliche Abhandlungen. Neue Folge, Vol. 37
(1980)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Die »Strafrechtlichen Abhandlungen - Neue Folge« wurden 1957 von Eberhard Schmidhäuser in Zusammenarbeit mit den deutschen Strafrechtslehrern in der Nachfolge der von Hans Bennecke begründeten »Strafrechtlichen Abhandlungen« (1896 bis 1942) eröffnet. Ihr Ziel ist es, wie das ihrer Vorgängerin, hervorragenden Arbeiten des strafrechtswissenschaftlichen Nachwuchses eine angemessene Veröffentlichung zu sichern. Aufgenommen werden ausgezeichnete Dissertationen und Habilitationen zum Strafrecht und Strafprozessrecht sowie zur Straftheorie. 1986 wurde Friedrich-Christian Schroeder (Regensburg) zum Herausgeber bestellt, 2007 trat Andreas Hoyer (Kiel) als weiterer Herausgeber an die Stelle des verstorbenen Eberhard Schmidhäuser. Die Aufnahme in die Reihe erfolgt auf Vorschlag eines Strafrechtslehrers.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungen | 12 | ||
| Einleitung | 15 | ||
| Erster Teil: Von der Überwindung des „Mißtrauensaxioms" Anfang der 30er Jahre zum Stand des Vertrauensschutzes am Ende des zweiten Weltkrieges | 18 | ||
| I. Definition des „Vertrauensgrundsatzës" und seine Anerkennung in § 11 Abs. 2 StVO | 18 | ||
| II. Die Grundregel (§ 25 RStVO 1934, heute § 1 Abs. 2 StVO) und der Vertrauensschutz | 20 | ||
| 1. Das „Vorgarten-Urteil" vom 13. Februar 1931 und der Gedanke der Verkehrssicherheit | 21 | ||
| 2. Der auf das „Vorgarten-Urteil" folgende Meinungsstreit | 27 | ||
| 3. Die RStVO 1934 und die „Gemeinschaft aller Verkehrsteilnehmer" | 37 | ||
| 4. Güldes Ansätze zur Herausarbeitung eines „Vertrauensgrundsatzes" | 42 | ||
| a) Die ideologische Absicherung | 42 | ||
| b) Das „Recht des Schwächeren" | 46 | ||
| 5. Die Stellung von Rechtslehre und Rechtsprechung zum Vertrauensschutz | 49 | ||
| a) Die Rechtslehre | 50 | ||
| b) Die Rechtsprechung | 52 | ||
| III. „Vertrauensgrundsatz" und nationalsozialistisches Rechtsdenken | 53 | ||
| 1. „Vertrauensgrundsatz" und „technisches Denken" | 55 | ||
| 2. Vertrauens-„Grundsatz" und Vertrauens-„Schutz" | 56 | ||
| 3. Das „Vertrauen" im „Vertrauensgrundsatz" | 60 | ||
| Zweiter Teil: Die Zeit vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Beschluß der Vereinigten Großen Senate vom 1. Juli 1961 zum Sichtfahrgebot auf Autobahnen | 65 | ||
| I. Vertrauensschutz und „Lebenserfahrung" | 65 | ||
| II. Vertrauensschutz und Schnellverkehr | 69 | ||
| III. Die Rechtsprechung zum Vertrauensschutz | 72 | ||
| 1. Vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Beginn der 50er Jahre | 72 | ||
| 2. Der Beschluß der Vereinigten Großen Senate vom 12. Juli 1954 zum Vorfahrtrecht | 72 | ||
| 3. Der Beschluß der Vereinigten Großen Senate vom 1. Juli 1961 zum Sichtfahrgebot auf Autobahnen | 75 | ||
| 4. Vergleich beider Beschlüsse | 77 | ||
| 5. Die Rechtsprechung des 4. Strafsenats | 80 | ||
| Dritter Teil: Der Streit um den „Vertrauensgrundsatz" und das „defensive Fahren" in den 60er Jahren | 83 | ||
| I. Die Angriffe Krummes gegen die Rechtsprechung des 4. Strafsenats | 83 | ||
| II. Die weitere Entwicklung der Rechtsprechung zum Vertrauensschutz | 87 | ||
| III. Vorschläge zur Ersetzung oder Beschneidung des „Vertrauensgrundsatzes" | 89 | ||
| 1. Die Stellung des StVO-Entwurfs von 1963 | 89 | ||
| 2. Die Untersuchungen von Meyer / Jacobi / Stiefel | 89 | ||
| 3. Der Referentenentwurf 1964 zur StVO | 94 | ||
| 4. Forderungen nach völliger Abschaffung des „Vertrauensgrundsatzes" | 95 | ||
| 5. Forderungen nach Zurückdrängung des „Vertrauensgrundsatzes" | 95 | ||
| 6. Die Problematik einer „Rechtspflicht" zu „defensivem Fahren" | 97 | ||
| Vierter Teil: Die Reichweite des Vertrauensschutzes im Straßenverkehr. Eine Übersicht über den Stand der Rechtsprechung | 104 | ||
| I. Positive Entscheidungen zum Vertrauensschutz und der Gedanke der Verkehrssicherheit | 104 | ||
| II. Negative Entscheidungen zum Vertrauensschutz | 113 | ||
| 1. Kein Vertrauensschutz bei erkennbar verkehrswidrigem Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer | 113 | ||
| 2. Kein Vertrauen auf das Unterbleiben verkehrsgerechter Verhaltensweisen | 114 | ||
| a) Vertrauensschutz und Sichtfahrgebot | 115 | ||
| b) Vertrauensschutz und Einsatzfahrzeuge | 116 | ||
| 3. Kein Vertrauensschutz bei eigenem verkehrswidrigem Verhalten | 118 | ||
| a) Verantwortlichkeit für die Folgen fremden Fehlverhaltens | 118 | ||
| b) Vertrauensschutz als „Prämie für eigenes Wohlverhalten im Verkehr" | 120 | ||
| c) Die Ansicht von der „Teilbarkeit des Vertrauensgrundsatzes" | 122 | ||
| d) Vertrauensschutz und Vorhersehbarkeit | 123 | ||
| aa) Vertrauensschutz und „Ursächlichkeit" des Verkehrsverstoßes | 124 | ||
| bb) Vertrauensschutz und „Schutzzweck" der verletzten Norm | 132 | ||
| cc) Vertrauensschutz und rechtmäßiges Alternativverhalten | 136 | ||
| dd) Vertrauensschutz und verkehrswidriges Verhalten des Vorfahrtberechtigten | 147 | ||
| e) Unsicherheiten in der Rechtsprechung hinsichtlich der Folgen eigenen Fehlverhaltens | 150 | ||
| 4. Kein Vertrauensschutz in „besonderen Verkehrslagen" | 151 | ||
| 5. Kein Vertrauensschutz in „unklaren Verkehrslagen" | 156 | ||
| a) Abgrenzungsprobleme | 158 | ||
| b) Erkennbar verkehrswidriges Verhalten Dritter | 159 | ||
| aa) Die Reaktion auf Verkehrswidrigkeiten im zeitlichen Ablauf | 162 | ||
| bb) Die Schreckzeit | 166 | ||
| 6. Kein Vertrauensschutz gegenüber „typischen Verkehrswidrigkeiten" | 167 | ||
| a) Die „Verkehrs- und Lebenserfahrung" | 167 | ||
| aa) „Typische Verkehrswidrigkeiten" und erkennbar verkehrswidriges Verhalten Dritter | 168 | ||
| bb) „Typische Verkehrs Widrigkeiten" und Sichtfahrgebot | 169 | ||
| cc) „Typische Verkehrswidrigkeiten" — Einzelfälle | 170 | ||
| dd) „Typische Verkehrswidrigkeiten" und die „zunehmende Verkehrserziehung" | 173 | ||
| b) Die Kritik Jaguschs an der Rechtsprechung | 174 | ||
| c) „Typische Verkehrswidrigkeiten" und der „Kernbereich" der Verkehrsordnung | 177 | ||
| aa) Vertrauensschutz und 50 km/h-Grenze | 177 | ||
| bb) Vertrauensschutz in Vorfahrtfällen | 180 | ||
| III. Vertrauensschutz und „gerechte Risikoverteilung" | 182 | ||
| 1. Die Entscheidung für die doppelte Umschaupflicht des Linksabbiegers | 184 | ||
| 2. „Gerechte Risikoverteilung" und „Zumutbarkeit" | 185 | ||
| a) Qualitative Gesichtspunkte bei der Bestimmung der „Verkehrsund Lebenserfahrung" | 185 | ||
| b) Fußgängerverkehr und Kraftverkehr | 187 | ||
| aa) Betreten der Fahrbahn vom Bürgersteig oder von einer Haltestelleninsel aus | 187 | ||
| bb) Das Verhalten des Kraftfahrers an Omnibushaltestellen | 189 | ||
| 3. Die Appellfunktion von Entscheidungen | 193 | ||
| IV. Einzelprobleme des Vertrauensschutzes | 197 | ||
| 1. Vertrauensschutz und Verkehrssicherheit | 197 | ||
| 2. „Neuralgische Anwendungsfälle" bei der Bemessung des Vertrauensschutzes? | 198 | ||
| a) Abgrenzungsschwierigkeiten in Einzelfällen | 198 | ||
| b) Vertrauensschutz, „typische Verkehrswidrigkeiten" und „gerechte Risikoverteilung" | 199 | ||
| 3. Verzicht auf den Vertrauens-„Grundsatz" | 204 | ||
| V. Rechtsnatur und systematische Stellung des Vertrauensschutzes im Straßenverkehr | 208 | ||
| 1. Rechtsnatur des „Verträuensgrundsatzes" | 208 | ||
| 2. Vertrauensschutz und „erlaubtes Risiko" | 209 | ||
| a) Vertrauensschutz und das Prinzip der „Eigenverantwortlichkeit" | 209 | ||
| b) Vertrauensschutz und verkehrsgerechtes Verhalten | 213 | ||
| c) Vertrauensschutz, und die „ im Verkehr erforderliche Sorgfalt" | 216 | ||
| 3. Vertrauensschutz und „gerechte Risikoverteilung" | 220 | ||
| Fünfter Teil: Vertrauensschutz gegenüber Fußgängern, Radfahrern und anderen Gruppen „schwächerer" Verkehrsteilnehmer | 223 | ||
| I. Einschränkung des Vertrauensschutzes gegenüber schwächer motorisierten Verkehrsteilnehmern? | 223 | ||
| II. Einschränkung oder Versagung des Vertraüensschützes gegenüber nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmern? | 225 | ||
| 1. Forderungen nach Versagung des Vertrauensschutzes gegenüber Fußgängern und Radfahrern | 225 | ||
| a) Fußgänger im Straßenverkehr | 229 | ||
| aa) Die Stellung der Rechtsprechung zum Vertrauensschutz gegenüber Fußgängern | 229 | ||
| bb) Das Verhalten von Kraftfahrern gegenüber Fußgängern unter dem Gesichtspunkt einer „gerechten Risikoverteilung" | 232 | ||
| b) Radfahrer im Straßenverkehr | 234 | ||
| aa) Die Stellung der Rechtsprechung zum Vertrauensschutz gegenüber Radfahrern | 234 | ||
| bb) Lkw-Verkehr und Radfahrer: Die „Lückenfälle" | 236 | ||
| 2. Vertrauensschutz und verkehrsungewandte Personen | 239 | ||
| a) Kinder im Straßenverkehr | 239 | ||
| aa) Plötzliches Auftauchen von vorher verdeckten Kindern | 239 | ||
| bb) Verhalten gegenüber rechtzeitig vorher sichtbaren Kindern verschiedenen Alters | 244 | ||
| b) Ältere Fußgänger im Straßenverkehr | 254 | ||
| aa) Verhalten gegenüber rechtzeitig vorher sichtbaren älteren Fußgängern | 254 | ||
| bb) Plötzliches Auftauchen vorher verdeckter älterer Fußgänger | 259 | ||
| Zusammenfassung | 261 | ||
| Literaturverzeichnis | 264 |
