Die Zweckmäßigkeit der Ermessensausübung als verwaltungsrechtliches Rechtsprinzip
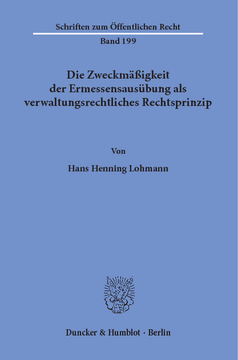
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Zweckmäßigkeit der Ermessensausübung als verwaltungsrechtliches Rechtsprinzip
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 199
(1972)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 10 | ||
| Einleitung | 15 | ||
| § 1 Das Problem zweckmäßiger Ermessensausübung und seine rechtliche Behandlung im Rahmen der verschiedenen Ermessenskonzeptionen | 19 | ||
| § 2 Die rechtliche Determinierung der Ermessensentscheidung durch das Rechtsprinzip relativer Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns | 24 | ||
| I. Die Differenzierung nach Zweckmäßigkeitsgraden | 24 | ||
| II. Die Unterscheidung zwischen relativer und absoluter Zweckmäßigkeit in der Verwaltungsrechtslehre | 24 | ||
| 1. Das Rechtsprinzip der Zwecktauglichkeit | 26 | ||
| 2. Das Rechtsprinzip der Zulänglichkeit | 26 | ||
| 3. Das Rechtsprinzip der Erforderlichkeit | 27 | ||
| 4. Das Rechtsprinzip der Verhältnismäßigkeit | 28 | ||
| III. Die Konsequenzen für das Ermessen | 29 | ||
| § 3 Das Problem der absoluten Zweckmäßigkeit bei der Ermessensentscheidung | 32 | ||
| I. Der innenrechtliche Aspekt der absoluten Zweckmäßigkeit von Ermessensentscheidungen | 33 | ||
| 1. Die Dienstpflicht des Beamten | 33 | ||
| 2. Die behördliche Zweckmäßigkeitsaufsicht | 34 | ||
| II. Der außenrechtliche Aspekt | 35 | ||
| 1. Die Amtspflicht gegenüber einem Dritten (§ 839 BGB) | 36 | ||
| 2. Die Überprüfung der Zweckmäßigkeit im Widerspruchsverfahren nach §§68 ff. VwGO | 38 | ||
| § 4 Die Vereinbarkeit von Freiheitsspielraum und immanenten Ermessensschranken | 41 | ||
| I. Die Lehre von den immanenten Schranken des Ermessens | 41 | ||
| II. Die Rechtsgrundlage der immanenten Schranken | 43 | ||
| 1. Organwalterpflicht | 43 | ||
| 2. Die Lehre vom „détournement de pouvoir" | 44 | ||
| III. Kritik an der Lehre von den immanenten Schranken und eigenes Lösungsmodell | 45 | ||
| 1. Die Terminologie | 45 | ||
| 2. Das Problem des Ausmaßes gesetzlicher Gebundenheit beim Ermessen | 46 | ||
| a) Die Einwirkung des Normzwecks auf die Ermessensausübung | 47 | ||
| b) Die verschiedenen Theorien zur Wirkungsweise des Normzwecks, verdeutlicht am praktischen Beispiel | 49 | ||
| 3. Die Wirkungsweise des Normzwecks nach §§ 114 2. A l t . VwGO, 163 S. 1 2. Alt. BBauG und 102 FGO | 51 | ||
| 4. Das Argument autonomer Ermessensdeterminanten (verwaltungsmäßiger Zweckmäßigkeit) bei der Ermessensausübung | 53 | ||
| a) Problemstellung und Meinungsstand | 53 | ||
| aa) Die überlieferte Lehre | 53 | ||
| bb) Abweichende Ansichten | 55 | ||
| b) Die verfassungsrechtliche Analyse | 59 | ||
| aa) Autonome Ermessensdeterminanten und Gesetzmäßigkeitsprinzip | 60 | ||
| bb) Autonome Ermessensdeterminanten und Bestimmtheitsgrundsatz | 65 | ||
| cc) Autonome Ermessensdeterminanten und Gewaltenteilungsprinzip | 65 | ||
| dd) Autonome Ermessensdeterminanten und Rechtsschutzgarantie | 66 | ||
| c) Das Ergebnis in der Frage der Ermessensdeterminanten | 66 | ||
| 5. Grenzen verwaltungsgerichtlicher Kontrolle als materiellrechtliche Argumentationsbasis | 68 | ||
| a) Die gerichtliche Praxis | 69 | ||
| b) Die „Lähmungstheorie" | 70 | ||
| c) Das Argument der „Doppelverwaltung" | 70 | ||
| d) Das Argument vorgegebener Erkenntnisgrenzen | 72 | ||
| e) Die „subjektive Schwankungsbreite" der möglichen Meinungen als Argument | 72 | ||
| f) Der Sachverstand der Verwaltung als Argument | 73 | ||
| 6. Die Bedeutung von Motivationsmängeln bei gleichzeitiger rechtlicher Gebundenheit im objektiven Bereich | 74 | ||
| § 5 Ermessensfreiheit und unbestimmter Rechtsbegriff | 77 | ||
| I. Die Ausklammerung der unbestimmten Rechtsbegriffe aus dem Ermessen | 77 | ||
| II. Der Grund für die Ausklammerung der unbestimmten Rechtsbegriffe aus dem Ermessen und die dadurch entstehende Problematik | 80 | ||
| III. Vergleich von Ermessen und unbestimmtem Rechtsbegriff | 82 | ||
| 1. Die deflatorische Gleichsetzung in der älteren Lehre und die gesetzgeberische Motivationslage | 82 | ||
| 2. Strukturanalyse | 87 | ||
| a) Der Gegensatz kognitiv — volitiv als Kriterium | 87 | ||
| b) Das Problem der rechtlichen „Verknüpfung" | 88 | ||
| § 6 Die prozessualen Konsequenzen | 91 | ||
| I. Richterliche Zweckmäßigkeitskontrolle als Konsequenz | 91 | ||
| II. Die Anforderungen an die Zweckmäßigkeitskontrolle | 93 | ||
| 1. Die Theorie vom richterlichen Takt | 94 | ||
| 2. Die Bindung richterlicher Überzeugungsbildung durch die Vermutung der Rechtmäßigkeit vertretbarer Ermessensentscheidungen | 94 | ||
| III. Die Vorteile der „prozessualen Lösung" gegenüber der herrschenden Lehre | 99 | ||
| 1. Die rechtliche Behandlung der evident unzweckmäßigen (unvertretbaren) Ermessensentscheidung | 99 | ||
| 2. Die rechtliche Behandlung der objektiv zweckmäßigen oder vertretbaren Ermessensentscheidung | 101 | ||
| a) Das Problem des „Nachschiebens von Gründen" bei Ermessensentscheidungen | 101 | ||
| b) Das Problem des „Vorwandes" | 102 | ||
| § 7 Ergebnis der Untersuchung und Ausblick auf die rechtliche Bedeutung der Zweckmäßigkeit im Bereich des „ius strictum" | 104 | ||
| I. Ermessen als besonderer Fall gebundenen Gesetzesvollzugs | 104 | ||
| II. Die rechtliche Bedeutung der Zweckmäßigkeit beim gebundenen Gesetzesvollzug im übrigen (ius strictum im engeren Sinne) | 106 | ||
| Schrifttumsverzeichnis | 109 |
