Management und Kontrolle
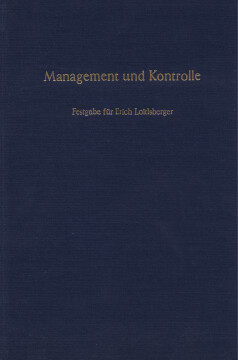
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Management und Kontrolle
Festgabe für Erich Loitlsberger zum 60. Geburtstag
Editors: Seicht, Gerhard
(1981)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| I. Theorie der Prüfung | 11 | ||
| Robert Buchner/Eva Breith: Das Problem der optimalen Allokation von Urteilsbildungsbeiträgen unter Kostenaspekt im Rahmen einer Buchprüfung | 13 | ||
| Inhalt | 13 | ||
| A. Problemstellung und Gang der Untersuchung | 14 | ||
| B. Das Problem der optimalen Allokation von Urteilsbildungsbeiträgen unter Kostenaspekt | 15 | ||
| I. Die Optimierung der Allokation von Urteilsbildungsbeiträgen mit Hilfe der Differentialrechnung | 15 | ||
| 1. Darstellung und Analyse bisheriger Lösungsansätze | 15 | ||
| a) Die Optimierung der Allokation von Urteilsbildungsbeiträgen im Rahmen der heterograden Statistik | 16 | ||
| aa) Die Lösungsansätze | 16 | ||
| ab) Der Aussagebereich der Lösungsansätze | 20 | ||
| b) Die Optimierung der Allokation von Urteilsbildungsbeiträgen im Rahmen der homograden Statistik | 21 | ||
| ba) Die Lösungsansätze | 21 | ||
| bb) Der Aussagebereich der Lösungsansätze | 24 | ||
| 2. Kritische Würdigung der Lösungsansätze zur Optimierung der Allokation von Urteilsbildungsbeiträgen mit Hilfe der Differentialrechnung | 24 | ||
| a) Vergleichende Analyse der dargestellten Lösungsansätze | 24 | ||
| b) Ein Zahlenbeispiel | 29 | ||
| c) Grenzen der Lösungsansätze | 32 | ||
| II. Zur Lösung des Optimierungsproblems im Urteilsbildungsprozeß mit Hilfe der dynamischen Programmierung | 33 | ||
| 1. Der Lösungsansatz | 33 | ||
| a) Das Modell und die allgemeine Formulierung des Lösungsweges | 33 | ||
| 2. Kritische Würdigung des Lösungsansatzes zur Optimierung der Allokation von Urteilsbildungsbeiträgen mit Hilfe der dynamischen Programmierung | 46 | ||
| Karl Lechner: Reine und/oder empirisch-kognitive Theorie der Prüfung? | 47 | ||
| Inhalt | 47 | ||
| A. Das Problem | 47 | ||
| B. Die Untersuchung | 48 | ||
| I. Der Methoden- und Theorienstreit und sein Aussagewert für das zu lösende Problem | 48 | ||
| II. Wissenschaftstheorie und Prüfungstheorie | 51 | ||
| 1. Prüfungstheorie und ihre Einordnung in das System der Wissenschaften | 51 | ||
| 2. Prüfungstheorie und realwissenschaftliches Denken | 52 | ||
| 3. Prüfungstheorie und Forschungsaspekte | 53 | ||
| 4. Reine Theorie und empirisch-kognitive Theorie: Inhalte | 55 | ||
| 5. Reine Theorie und empirisch-kognitive Theorie: Gegensatz oder Ergänzung? | 57 | ||
| C. Das Ergebnis | 59 | ||
| Ulrich Leffson/Franz J. Bönkhoff: Zu Materiality-Entscheidungen bei Jahresabschlußprüfungen | 61 | ||
| Inhalt | 61 | ||
| A. Informationsvermittlung und -begrenzung | 61 | ||
| B. Mögliche Beeinträchtigung des Informationsgehalts des Jahresabschlusses | 64 | ||
| C. Die Beurteilung von Fehlern | 68 | ||
| I. Ableitung von Materiality-Hypothesen | 68 | ||
| II. Analyse der einzelnen Fehlermöglichkeiten | 70 | ||
| D. Quantitative Materiality-Grenzen | 72 | ||
| I. Die Materiality-Grenze in Hinblick auf die Aussage des Periodenerfolges | 72 | ||
| 1. Das Problem der Festlegung einer Materiality-Grenze für Fehler analog zur Vorschrift des § 160 Abs. 2 Satz 5 AktG 65 | 72 | ||
| 2. Die Wirkung einer Materiality-Grenze von 10 % des Jahresüberschusses für gesetzlich tolerierte Beeinträchtigungen | 73 | ||
| 3. Die Übertragung der gesetzlichen Materiality-Grenze auf andere Fehler | 74 | ||
| II. Die Materiality-Grenze in Hinblick auf die Aussagefähigkeit einzelner Bilanzpositionen | 75 | ||
| III. Aggregation und Kompensation gewinnerhöhender und gewinnmindender Fehler | 76 | ||
| E. Schlußbemerkung | 77 | ||
| Peter Swoboda: Die Notwendigkeit von Pflichtprüfungen von Publikumsaktiengesellschaften aus der Sicht der neueren kapitaltheoretischen Forschung | 79 | ||
| Inhalt | 79 | ||
| A. Problemstellung | 80 | ||
| B. Aktienrechtliche Pflichtprüfungen unter dem Aspekt der Information des Kapitalmarkts | 80 | ||
| I. Bedingungen für die Notwendigkeit von Pflichtprüfungen | 80 | ||
| II. Aktienrechtliche Pflichtprüfung und Informationseffizienz des Kapitalmarkts | 81 | ||
| 1. Grade der Informationseffizienz | 81 | ||
| 2. Implikationen für Pflichtprüfungen | 81 | ||
| III. Freiwillige Information versus Pflichtpublikation und -prüfung | 83 | ||
| 1. Die Vorschläge von Ross und Haugen / Senbet | 83 | ||
| 2. Implikationen für Pflichtprüfungen | 85 | ||
| C. Aktienrechtliche Pflichtprüfungen unter dem Aspekt der Einflüsse der Kapitalstruktur auf Entscheidungen der Geschäftsführung | 86 | ||
| I. Auswirkungen der Kapitalstruktur auf Entscheidungen der Geschäftsführung | 86 | ||
| 1. Die Prämissen des Theorems von der Irrelevanz der Kapitalstruktur | 86 | ||
| 2. Mögliche Verstöße gegen die für den Irrelevanzbeweis wichtige Annahme, daß die Entscheidungen der Geschäftsführung von der Kapitalstruktur unabhängig sind (im Zusammenhang mit heterogener Information) | 87 | ||
| a) Konkurswahrscheinlichkeit und optimale Kapitalstruktur | 87 | ||
| b) Maßnahmen der Vermeidung finanzieller Schwierigkeiten und optimale Kapitalstruktur | 89 | ||
| c) Investitionsentscheidungen und optimale Kapitalstruktur | 89 | ||
| d) Agency Costs und optimale Kapitalstruktur | 90 | ||
| e) Die Einbeziehung heterogener Informationen in die Analyse | 91 | ||
| II. Implikationen für Pflichtprüfungen | 92 | ||
| D. Zusammenfassung | 95 | ||
| Karl Vodrazka: Ist die Unterscheidung zwischen formeller und materieller Prüfung noch aktuell? | 97 | ||
| Inhalt | 97 | ||
| A. Einleitung und Problemstellung | 97 | ||
| B. Die formelle und materielle Prüfung bei einigen Autoren | 97 | ||
| C. Versuch einer Zusammenfassung und Vorschläge für Definitionen der daraus resultierenden Begriffe | 109 | ||
| II. Instrumente der Prüfung | 119 | ||
| Jörg Baetge/Heiner Meyer zu Lösebeck: Starre oder flexible Prüfungsplanung? | 121 | ||
| Inhalt | 121 | ||
| A. Problemstellung | 122 | ||
| B. Grundlagen | 124 | ||
| I. Zielsetzung und Planungshorizont | 124 | ||
| II. Begriffe der starren und flexiblen Planung | 125 | ||
| C. Starre und flexible Planung im Einperiodenfall | 127 | ||
| I. Einführung | 127 | ||
| II. Fallbeispiel zur Vollprüfung | 128 | ||
| III. Fallbeispiel zur Auswahlprüfung | 132 | ||
| IV. Ergebnis | 134 | ||
| D. Starre und flexible Planung im Mehrperiodenfall | 134 | ||
| I. Fallbeispiel der Vollprüfung | 134 | ||
| 1. Entscheidungssituation | 134 | ||
| 2. Mehrperiodige starre Planung | 135 | ||
| 3. Flexible Planung | 137 | ||
| 4. Ergebnis | 140 | ||
| II. Fallbeispiel mit Systemprüfung | 141 | ||
| 1. Entscheidungssituation | 141 | ||
| 2. Starre Planung | 143 | ||
| a) Anfangsentscheidung | 143 | ||
| b) Plankorrekturen | 145 | ||
| 3. Flexible Planung | 146 | ||
| a) Lösung nach dem Roll-Back-Verfahren und Darstellung im Entscheidungsbaum | 146 | ||
| b) Lösung mit der Entscheidungsmatrix | 148 | ||
| 4. Ergebnis | 151 | ||
| E. Zusammenfassendes Fallbeispiel mit Systemprüfung und Auswahl- oder Vollprüfung | 152 | ||
| F. Ergebnis, Ausblick und Würdigung des starren und des flexiblen Planungskonzeptes | 158 | ||
| Gerwald Mandl: Zur Auswahl statistischer Stichprobenverfahren im heterograden Fall der Buchprüfung | 173 | ||
| Inhalt | 173 | ||
| A. Problemstellung und Gang der Untersuchung | 174 | ||
| B. Schätzverfahren | 175 | ||
| I. Punkt- und Intervallschätzung | 175 | ||
| II. Einfache Schätzverfahren | 176 | ||
| 1. Beschreibung der einfachen Schätzverfahren | 176 | ||
| III. Geschichtete Schätzverfahren | 177 | ||
| 1. Beschreibung geschichteter Schätzverfahren | 177 | ||
| 2. Die Berechnung des Stichprobenumfanges | 178 | ||
| IV. Die Beurteilung eines Prüffeldes bei Schätzverfahren | 179 | ||
| V. Die Eigenschaften der beschriebenen Schätzverfahren | 180 | ||
| 1. Die Genauigkeit der Punktschätzung | 180 | ||
| 2. Die Zuverlässigkeit der Beurteilung | 181 | ||
| 3. Die Genauigkeit der Intervallschätzung | 183 | ||
| 4. Die Berechenbarkeit des Stichprobenumfanges | 183 | ||
| 5. Der rechnerische und organisatorische Aufwand | 185 | ||
| C. Testverfahren | 186 | ||
| I. Beschreibung eines einstufigen Testverfahrens | 186 | ||
| II. Die Beurteilung eines Prüffeldes auf Grund eines Schätz- bzw. Testverfahrens | 187 | ||
| D. Das Dollar-Unit Sampling (DUS) | 187 | ||
| I. Beschreibung des Dollar-Unit Sampling | 187 | ||
| II. Die Berechnung des Stichprobenumfanges | 189 | ||
| III. Die Eigenschaften des Dollar-Unit Sampling | 189 | ||
| E. Die Auswahl von Stichprobenverfahren bei einer Prüfung | 191 | ||
| I. Die Gewichtung der Eigenschaften von Stichprobenverfahren für die Auswahl | 191 | ||
| II. Die Auswahl von Stichprobenverfahren bei Vorinformationen | 191 | ||
| III. Die Auswahl von Stichprobenverfahren ohne Vorinformation | 193 | ||
| F. Zusammenfassung | 194 | ||
| Anhang | 195 | ||
| Symbolverzeichnis | 195 | ||
| Josef Mugler: Die Risikoüberwachung als Führungsinstrument in Klein- und Mittelbetrieben | 197 | ||
| Inhalt | 197 | ||
| A. Problemstellung | 197 | ||
| B. Risiko und Risikopolitik der Unternehmung | 199 | ||
| C. Zur Risikosituation kleinerer Unternehmungen | 204 | ||
| D. Die Risikoüberwachung im System der Risikopolitik | 205 | ||
| E. Die Methoden der Risikoüberwachung | 209 | ||
| I. Die Soll-Objekt-Ermittlung | 210 | ||
| II. Die Ist-Objekt-Ermittlung | 212 | ||
| F. Programmatische Ansatzpunkte zur praktischen Durchsetzung der Risikoüberwachung in Klein- und Mittelbetrieben | 215 | ||
| Johann Risak: Interne Revision – Ein Instrument zur Unternehmungsentwicklung? | 219 | ||
| Inhalt | 219 | ||
| Vorbemerkungen | 219 | ||
| A. Die Ausgangslage | 220 | ||
| I. Die Interne Revision – Anspruch | 220 | ||
| II. Das Prüfungsobjekt Unternehmung | 221 | ||
| 1. Die Dynamik des Umfeldes | 221 | ||
| 2. Der Entwicklungsstand von Planung, Organisation und Information | 222 | ||
| 3. Der Zusammenhang von Entwicklungsstand und Anpassungsbereitschaft | 224 | ||
| III. Anspruch und Realität | 225 | ||
| B. Die Istzustandserhebung als entwicklungsadäquater Ansatzpunkt | 225 | ||
| I. Istzustand und allgemeine Sollvorstellungen | 225 | ||
| II. Istzustand und Stand von Wissenschaft und Technik | 227 | ||
| C. Vier Grundfragen für den Ansatz der Istzustandserhebung | 228 | ||
| D. Hinweise zur aktivitätsorientierten Information über den Istzustand | 229 | ||
| E. Abschaffen versus Innovation | 231 | ||
| F. Die Interne Revision kann ein Instrument zur Unternehmungsentwicklung sein, wenn ... | 232 | ||
| Hanns Martin W. Schoenfeld: Die Weiterentwicklung der Internen Revision | 235 | ||
| Inhalt | 235 | ||
| A. Entwicklung und Wandel der internen Revision | 235 | ||
| B. Einflüsse des Management Accounting | 238 | ||
| C. Neue Ansatzpunkte der internen Revision | 241 | ||
| I. Schwerpunktbereiche der Prüfung | 241 | ||
| II. Effizienz, Effektivität und Slack | 244 | ||
| D. Verbesserte Prüfmethoden der internen Revision | 246 | ||
| I. Effektivitätsstandards | 246 | ||
| II. Methoden der Organisationsprüfung | 246 | ||
| III. Systemanalyse | 247 | ||
| IV. Wertanalysen | 249 | ||
| V. Cost-Benefit Analysen | 249 | ||
| E. Auswirkungen auf die Stellung der internen Revision | 251 | ||
| Franz Silbermayr: Die Zeit als Kontrollmaß und Rechnungseinheit der betrieblichen Leistungserstellung | 255 | ||
| Inhalt | 255 | ||
| A. Die Zeit als Kontrollmaß | 257 | ||
| I. Optimales Bezugsverfahren | 257 | ||
| II. Optimales Fertigungsverfahren | 258 | ||
| Darstellung 1 | 259 | ||
| Verfahrensrelevante Kosten | 259 | ||
| Darstellung 2 | 260 | ||
| Fertigungsverfahren | 260 | ||
| III. Optimale Produktionsgeschwindigkeit | 261 | ||
| IV. Optimale Bestände | 264 | ||
| B. Die Zeit als Rechnungseinheit | 264 | ||
| I. Aktiva als Zeitvorrat, Passiva als Zeitverpflichtung | 266 | ||
| 1. Reproduktions-Konzeption | 266 | ||
| 2. Tauschwert-Konzeption | 267 | ||
| 3. Reichweiten-Konzeption | 267 | ||
| II. Aufwand als Zeitverbrauch, Ertrag als Zeiterwerb | 267 | ||
| C. Zusammenfassung | 268 | ||
| Anhang I | 269 | ||
| Anhang II | 271 | ||
| Klaus v. Wysocki: Überlegungen zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Stichproben-Inventur | 273 | ||
| Inhalt | 273 | ||
| A. Die Regelung der Stichproben-Inventurverfahren in der Bundesrepublik durch § 39 Abs. 2 a HGB | 273 | ||
| B. Grundsätze für die Aufstellung des Inventars mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden | 274 | ||
| I. Verwendung anerkannter mathematisch-statistischer Methoden | 274 | ||
| II. Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung | 276 | ||
| 1. Der Inventurgrundsatz der Vollständigkeit | 277 | ||
| 2. Der Inventurgrundsatz der Richtigkeit | 278 | ||
| 3. Der Inventurgrundsatz der Nachprüfbarkeit | 279 | ||
| III. Das Postulat der Aussageäquivalenz | 279 | ||
| 1. Aussageäquivalenz im Hinblick auf den Gesamtwert des Inventars | 280 | ||
| a) Zur Auslegung des Gesetzes | 280 | ||
| b) Zur Bestimmung der erforderlichen Sicherheit und Genauigkeit der statistischen Aussagen | 281 | ||
| 2. Aussageäquivalenz im Hinblick auf die Gliederung des Inventars | 283 | ||
| a) Umschreibung des Problems | 283 | ||
| b) Zur Überleitung des globalen Inventarschätzwertes in das Inventar | 285 | ||
| ba) Die Berücksichtigung von Inventurdifferenzen im Rahmen der Stichproben-Inventur | 285 | ||
| bb) Qualitätsanforderungen an die Lagerbuchführung | 289 | ||
| C. Die Überleitung des Inventars auf die Bilanz | 290 | ||
| D. Schlußbemerkungen und Zusammenfassung | 291 | ||
| III. Anwendungsgebiete der Prüfung | 293 | ||
| Robert Denk: Unterangebote und ruinöser Wettbewerb im Lichte alternativer Leitbilder der Wettbewerbspolitik. Zur Frage der Preiskontrolle in Submissionsverfahren öffentlich nachgefragter Bauleistungen | 295 | ||
| Inhalt | 295 | ||
| A. Problemstellung | 295 | ||
| B. Zur inhaltlichen Klarstellung des Begriffes „Unterangebot“ | 296 | ||
| C. Die Problematik des staatlichen Eingriffes in die Preispolitik der Bauunternehmungen | 300 | ||
| D. Ausgewählte Wettbewerbsleitbilder und ihre Konsequenzen für die Preiskontrolle und Unterangebotsfeststellung bei öffentlichen Bauaufträgen | 301 | ||
| I. Zwei Grundtypen der Wettbewerbsleitbilder | 301 | ||
| II. Der vollständige Wettbewerb | 301 | ||
| III. Das Konzept des funktionsfähigen Wettbewerbs | 302 | ||
| IV. Das Konzept der optimalen Wettbewerbsintensität | 303 | ||
| V. Das neoliberale Konzept des funktionsfähigen Wettbewerbs | 308 | ||
| E. Zusammenfassung | 317 | ||
| Konrad Fuchs/Reinhard Ortner: Vergleichende Analyse der externen Gewinn- und Verlustrechnung von Kreditunternehmungen zum Zwecke des Gläubigerschutzes | 321 | ||
| Inhalt | 321 | ||
| A. Einleitung und Problemstellung | 321 | ||
| B. Argumente für und gegen größere G + V-Rechnungstransparenz | 323 | ||
| C. Möglichkeiten zur Beeinflussung des Jahresergebnisses | 326 | ||
| I. Ergebnisregulierung vor dem Bilanzstichtag | 327 | ||
| II. Ergebnisregulierung nach dem Bilanzstichtag | 327 | ||
| D. Entwicklungstrends der G + V-Publizität bei österreichischen Aktienbanken | 328 | ||
| I. Bilanz 1910 | 328 | ||
| II. Bilanz 1936 | 329 | ||
| III. Bilanz 1978 (Rechtsgrundlage KWG 1939 und Aktiengesetz 1965) | 329 | ||
| IV. Bilanz 1979 (Rechtsgrundlage KWG 1979) | 330 | ||
| E. Querschnittsvergleich der gegenwärtigen G + V-Publizität in ausgewählten Ländern inkl. der EG-Empfehlungen | 331 | ||
| I. Aktienbanken-BRD (Rechtsgrundlage Aktiengesetz 1965 und Verordnung über Formblätter von 1967) | 331 | ||
| II. Aktienbanken-Schweiz | 333 | ||
| III. Börsennotierte Aktienbanken-USA (Staffelmethode) | 333 | ||
| IV. Vorschläge einer Studiengruppe bezüglich der Richtlinien für Jahresabschlüsse von Banken gemäß der 4. gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie vom 27.7.78 | 334 | ||
| F. Zusammenfassung | 335 | ||
| Herbert Hax: Die arbeitsgeleitete Unternehmung – Probleme der Unternehmensführung und Überwachung | 337 | ||
| Inhalt | 337 | ||
| A. Das Modell der arbeitsgeleiteten Unternehmung | 337 | ||
| B. Ausgestaltung und Bedeutung von Eigentumsrechten in der arbeitsgeleiteten Unternehmung | 341 | ||
| I. Ausgestaltung der Eigentumsrechte | 341 | ||
| II. Eigentumsrechte, Vertragsbeziehungen und Interessendurchsetzung | 343 | ||
| III. Eigentumsrechte und Arbeitsbedingungen | 344 | ||
| C. Die Politik der arbeitsgeleiteten Unternehmung | 347 | ||
| I. Ziele der arbeitsgeleiteten Unternehmung | 347 | ||
| II. Die Gewinnaufteilung und ihr Konsequenzen für die Unternehmungspolitik | 349 | ||
| III. Der Planungshorizont in der arbeitsgeleiteten Unternehmung | 354 | ||
| IV. Finanzierungsprobleme | 356 | ||
| D. Die Überwachung der Unternehmungsleitung | 358 | ||
| I. Überwachung durch die Arbeitnehmer | 358 | ||
| II. Die Rolle der Gewerkschaften | 361 | ||
| III. Überwachung durch die Kreditgeber | 362 | ||
| E. Zusammenfassung | 364 | ||
| Gerhard Knolmayer: Die Beurteilung von Leistungen des dispositiven Faktors durch Prüfungen höherer Ordnung | 365 | ||
| Inhalt | 365 | ||
| A. Problemstellung und Gang der Untersuchung | 366 | ||
| B. Rechtsgrundlagen und Vorschläge für Prüfungen höherer Ordnung | 367 | ||
| I. Rechtsgrundlagen für Prüfungen höherer Ordnung | 367 | ||
| 1. Die genossenschaftliche Pflichtprüfung | 367 | ||
| 2. Die Prüfung von Wirtschaftsbetrieben der öffentlichen Hand | 371 | ||
| 3. Die Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat | 373 | ||
| 4. Weitere Rechtsvorschriften | 374 | ||
| II. Vorschläge zum Ausbau der Prüfungen höherer Ordung | 374 | ||
| C. Die Problematik der Prüfung von Entscheidungen | 375 | ||
| I. Das Problem | 375 | ||
| II. Entscheidungsprozesse aus der Sicht der normativen Entscheidungstheorie | 375 | ||
| III. Entscheidungsprozesse aus der Sicht der deskriptiven Entscheidungstheorie | 378 | ||
| D. Die Bestimmung von Soll-Objekten als zentrales Problem von Prüfungen höherer Ordnung | 379 | ||
| I. Die Bedeutung der Bestimmung von Soll-Objekten | 379 | ||
| II. Die Bestimmung von Soll-Objekten in Teilbereichen von Prüfungen höherer Ordnung | 380 | ||
| 1. Die Bestimmung von Soll-Objekten bei Prognoseprüfungen | 380 | ||
| 2. Die Bestimmung von Soll-Objekten bei Zielprüfungen | 383 | ||
| 3. Die Bestimmung von Soll-Objekten bei Verfahrensprüfungen | 386 | ||
| 4. Die Bestimmung von Soll-Objekten für die in der normativen Entscheidungstheorie nicht erfaßten Sachverhalte | 388 | ||
| E. Zusammenfassung | 390 | ||
| Franz-Gerhard Kolarik: Überlegungen zum Profitcenter-Konzept im Bankbetrieb | 391 | ||
| Inhalt | 391 | ||
| A. Einleitung | 391 | ||
| B. Zielsetzung und Gang der Untersuchung | 392 | ||
| C. Möglichkeiten der Bildung von Erfolgsbereichen im bankbetrieblichen Rechnungswesen | 393 | ||
| D. Bestimmungsgründe für die Verwendung von Erfolgsbereichen als Profitcenter im Bankbetrieb | 396 | ||
| E. Die Eignung der im bankbetrieblichen Rechnungswesen entwickelten Erfolgsbereiche für das Profitcenter-Konzept | 397 | ||
| I. Die Eignung produktbezogener Geschäftssparten für das Profitcenter-Konzept | 397 | ||
| II. Die Eignung regionaler Ergebnisbereiche für das Profitcenter-Konzept | 398 | ||
| III. Die Eignung der Kunden (Kundengruppen) als Ergebnisbereiche für das Profitcenter-Konzept | 400 | ||
| F. Der Zusammenhang zwischen Außenstellenergebnissen und Kundenergebnissen | 401 | ||
| G. Zusammenfassung | 406 | ||
| Adolf Moxter: Wirtschaftsprüfer und Unternehmensbewertung | 409 | ||
| Inhalt | 409 | ||
| A. Das Problem | 409 | ||
| B. Wirtschaftsprüfer und Unternehmensbewertung | 411 | ||
| I. Die Orientierung am „nachhaltigen“ Erfolg | 411 | ||
| II. Die Orientierung am Substanzwert | 417 | ||
| C. Zusammenfassung | 425 | ||
| Dieter Rückle: Gestaltung und Prüfung externer Prognosen | 431 | ||
| Inhalt | 431 | ||
| A. Einführung | 432 | ||
| I. Zum Begriff der „externen Prognose“ | 432 | ||
| II. Anlässe externer Prognosen | 434 | ||
| III. Offene Fragen von Prognoseerstellung und -prüfung | 437 | ||
| B. Zur Frage der Zweckmäßigkeit externer Prognosen | 438 | ||
| I. Die Förderung der Interessen von Prognoseadressaten durch Prognosen im Vergleich zu vergangenheitsorientierten Informationen | 438 | ||
| 1. Argumente für und gegen eine zukunftsorientierte Berichterstattung im Vergleich zur vergangenheitsorientierten Rechnungslegung | 438 | ||
| 2. Die Prognoseeignung vergangenheitsorientierter Informationen als Argument gegen die Publikation originärer Prognosen | 439 | ||
| 3. Empirische Befunde zur Verläßlichkeit, Manipulationsanfälligkeit und Nützlichkeit von Prognosen | 442 | ||
| II. Freiwillige oder verpflichtende externe Prognosen? | 443 | ||
| C. Die Gestaltung externer Prognosen | 446 | ||
| I. Inhalt und Form von Prognosen | 446 | ||
| II. Explizite Angabe von Randbedingungen und Modellstruktur | 448 | ||
| III. Punktuelle Prognosen und Intervallprognosen | 451 | ||
| IV. Grundsätze ordnungsmäßiger Prognose (GoProg) | 455 | ||
| 1. Bedeutung und Gewinnungsmöglichkeit von GoProg | 455 | ||
| 2. Zur inhaltlichen Fixierung von Grundsätzen ordnungsmäßiger externer Prognose | 458 | ||
| D. Probleme der Prognoseprüfung | 460 | ||
| I. Zum Begriff der „Prognoseprüfung“ | 460 | ||
| II. Mögliche Haltungen gegenüber der Prognoseprüfung | 461 | ||
| III. Zur Gestaltung von Prognoseprüfungen | 466 | ||
| Gerhard Seicht: Die Kontrolle der Kapitalerhaltung | 469 | ||
| Inhalt | 469 | ||
| A. Einleitung und Problemstellung | 470 | ||
| B. Kaufmännische Jahresabschlußrechnung, Kapitaldefinitionen (Erhaltungspostulate) und Gewinnbegriffe | 476 | ||
| I. Grundsätzliche Überlegungen zur kaufmännischen Buchhaltung und Bilanzierung | 476 | ||
| 1. Aufgaben und Ziele des Jahresabschlusses | 476 | ||
| 2. Kaufmännische Buchhaltung und Bilanzierung als eine Rechnung über Werte und Kaufkraft | 476 | ||
| 3. Kaufmännische Buchhaltung und Bilanzierung als eine Rechnung über Geld und Geldwerdungsprozesse | 477 | ||
| 4. Gewinnbegriff und bilanzmäßige Gewinnermittlung | 479 | ||
| II. Die formellen Auswirkungen der Geldwertverdünnung auf die Jahresabschlußrechnung | 486 | ||
| 1. Auswirkungen auf den Vermögensausweis | 486 | ||
| 2. Auswirkungen auf den Gewinnausweis | 487 | ||
| C. Mögliche Adjustierungsrechnungen | 488 | ||
| I. Geldwertkorrektur oder Preiskorrektur? | 488 | ||
| II. Inflationierung oder Deflationierung? | 491 | ||
| III. Bestandskorrektur und Umsatzkorrektur | 494 | ||
| IV. Bruttorechnung oder Nettorechnung? | 495 | ||
| V. Systematische oder kasuistische Adjustierungsmaßnahmen? | 499 | ||
| D. Kapitalerhaltung und Besteuerung | 501 | ||
| I. Das Wesen der Scheingewinnbesteuerung | 501 | ||
| II. Die imparitätische Scheingewinnsteuerwirkung | 503 | ||
| E. Zusammenfassung und Ausblick | 505 | ||
| Kurt Stöber: Finanzierungsleasing, wirtschaftliche Betrachtungsweise und Bilanzierung. Zur einzelwirtschaftlichen Kontrolle der Gleichmäßigkeit der Besteuerung | 507 | ||
| Inhalt | 507 | ||
| A. Problemstellung | 507 | ||
| B. Finanzierungsleasing aus betriebswirtschaftlicher Sicht | 509 | ||
| I. Begriff und Formen des Finanzierungsleasings | 509 | ||
| II. Finanzierungsleasing als Investitionsfinanzierung | 510 | ||
| C. Finanzierungsleasing in der Steuerbilanz | 514 | ||
| I. Die „wirtschaftliche Betrachtungsweise“ als obligatorisches Beurteilungskriterium | 515 | ||
| II. Die steuerrechtliche Beurteilung des Finanzierungsleasings | 516 | ||
| 1. Grundlagen | 516 | ||
| 2. Die steuerliche Diskriminierung dies Leasingnehmers | 518 | ||
| a) Grundlagen | 518 | ||
| b) Modell I | 521 | ||
| c) Modell II | 523 | ||
| d) Modell III | 524 | ||
| e) Modell IV | 524 | ||
| f) Modell V | 525 | ||
| g) Abschließende Beurteilung der Modellergebnisse | 526 | ||
| D. Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse und Vorschlag zur Bilanzierung in der Steuerbilanz | 527 | ||
| Helmut Uhlir: Portefeuillemanagement und Anlageerfolgsbeurteilung Zum gegenwärtigen Stand der Performancemessung | 529 | ||
| Inhalt | 529 | ||
| A. Einführung | 530 | ||
| B. Problemstellung | 532 | ||
| I. Szenarium | 532 | ||
| II. Problemaufriß | 534 | ||
| C. Traditionelle theoriegeleitete Performancemaße | 536 | ||
| I. Beurteilung der Anlageerfolge durch Ertrag und Risiko | 536 | ||
| II. Gemeinsame theoretische Basis: das „Capital-Asset-Pricing“-Modell (CAPM) | 538 | ||
| III. Die akzeptierten Performancemaße im Überblick | 540 | ||
| 1. Das Kriterium von Jensen | 540 | ||
| IV. Der Zusammenhang zwischen den vorgestellten Performancemaßen | 543 | ||
| D. Erheblich eingeschränkte Brauchbarkeit der „Capital-Asset-Pricing“-Theorie zur Performancebeurteilung | 545 | ||
| I. Konzeptionsbedingte Bedenken | 545 | ||
| 1. Zweifel an der Testbarkeit des CAPM | 545 | ||
| 2. Zweifel an der Verwendbarkeit des CAPM als „Partialmodell“ | 546 | ||
| II. Eindeutige Klassifikation und Rangreihenbildung von Anlageerfolgen durch das „SML“-Kriterium nicht gewährleistet | 547 | ||
| 1. Das Äquivalenztheorem | 547 | ||
| 2. Konsequenzen für die Performancebeurteilung | 548 | ||
| 3. Demonstrationsbeispiel | 549 | ||
| III. Schlußfolgerungen | 556 | ||
| E. CAPM-unabhängige Performancemaße als Ausweg | 557 | ||
| I. Systematisierung der alternativen Ansätze | 557 | ||
| II. Die „Reward-to-Variability-Ratio“ | 559 | ||
| III. Der Performancetest von Cornell | 561 | ||
| 1. Darstellung | 561 | ||
| 2. Demonstrationsbeispiel | 563 | ||
| F. Zusammenfassung | 567 | ||
| Verzeichnis der wichtigsten Publikationen von Erich Loitlsberger | 571 | ||
| a) Monographien | 571 | ||
| b) Beiträge in Zeitschriften und Sammelwerken | 571 | ||
| c) Herausgeberschaft | 574 | ||
| Verzeichnis der Autoren | 575 |
