Der Wesensgehalt der Eigentumsgewährleistung
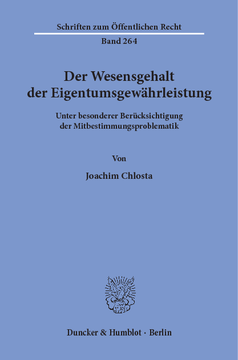
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der Wesensgehalt der Eigentumsgewährleistung
Unter besonderer Berücksichtigung der Mitbestimmungsproblematik
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 264
(1975)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 11 | ||
| Einleitung: Das Problem eines verfassungsrechtlichen Eigentumsbegriffs | 13 | ||
| A. Die Grundstruktur der Eigentumsgewährleistung des Art. 14 GG | 17 | ||
| I. Der Gegenstand der Gewährleistung | 17 | ||
| 1. „Eigentum" im natürlichen Wortsinn | 17 | ||
| 2. „Eigentum" im staatsrechtlichen Sinn | 17 | ||
| a) Begriffsumfang | 17 | ||
| b) öffentl.-rechtl. Charakter | 18 | ||
| c) Schutzrichtungen | 19 | ||
| d) Gewährleistungsfunktionen | 20 | ||
| 3. Notwendige Begriffselemente | 22 | ||
| II. Der Regelungsvorbehalt des Art 14 Abs. 1 S. 2 GG | 24 | ||
| 1. Die Bindung des Gesetzgebers an bisheriges Recht | 24 | ||
| 2. Die Ausgestaltungsrichtlinie des Art. 14 Abs. 2 GG | 28 | ||
| 3. Die Unterscheidung zwischen Inhalts- und Schrankenbestimmung | 31 | ||
| 4. Der Gesetzesbegriff in Art 14 Abs. 1 S. 2 GG | 33 | ||
| a) Gesetz im materiellen Sinne | 33 | ||
| b) Satzungsermessen | 35 | ||
| c) Verwaltungsermessen | 36 | ||
| III. Zwischenergebnis | 38 | ||
| B. Das Problem der Wesensgehaltsbestimmung | 39 | ||
| I. Das Schutzobjekt der Wesensgehaltsgarantie | 39 | ||
| II. Der Inhalt der Wesensgehaltsgarantie | 43 | ||
| 1. Formale Wesensgehaltstheorien | 44 | ||
| 2. Grundrechtssystematischer Ansatz | 47 | ||
| 3. Wertsystematischer Ansatz | 49 | ||
| 4. Wesensgehalt und institutionelles Rechtsdenken | 54 | ||
| 5. Wesensgehalt und liberal-rechtsstaatlicher Ansatz | 62 | ||
| 6. Enteignungsrechtsprechung und Wesensgehalt des Eigentums | 67 | ||
| a) Zivilgerichte | 67 | ||
| b) Verwaltungsgerichte | 72 | ||
| III. Ergebnis und Folgerungen für die Wesensgehaltsbestimmung der Eigentumsgewährleistung | 75 | ||
| C. Sinnermittlung des Kernbereichs von Art 14 GG | 79 | ||
| I. Der objektive Sinngehalt der Eigentumsgewährleistung | 79 | ||
| 1. Allgemein anerkannte Kriterien | 79 | ||
| a) Herrschaftsbefugnisse des Rechtsinhabers | 79 | ||
| b) Verfügungsmacht und Vertragsrecht | 82 | ||
| 2. Systematische Interpretation | 84 | ||
| a) Eigentumsgewährleistung als Wertentscheidung | 84 | ||
| b) Eigentumsgewährleistung und Wirtschaftsordnung | 85 | ||
| c) Eigentumsgewährleistung und Sozialisierungsvorbehalt | 86 | ||
| II. Die streitige Mindestfunktion der Eigentumsgewährleistung | 89 | ||
| 1. Ausgangslage | 89 | ||
| 2. Kooperationsformen zwischen Eigentümer und Dritten | 90 | ||
| a) Arbeitsverhältnis | 90 | ||
| b) Werkverträge | 90 | ||
| c) Gesellschaftsverhältnis | 91 | ||
| 3. Soziale Übermacht des Eigentümers | 92 | ||
| 4. Eigentum und Unternehmerfunktion | 93 | ||
| 5. Eigentum und Risiko | 94 | ||
| 6. Kapital und Arbeit | 95 | ||
| 7. Lösungsmöglichkeiten des Interessenkonflikts | 97 | ||
| a) Vorrangigkeit der Kapitalinteressen | 97 | ||
| b) Nachrangigkeit der Kapitalinteressen | 99 | ||
| c) Nichtüberstimmbarkeit der Kapitalinteressen | 101 | ||
| III. Die historisch-geistesgeschichtliche Ergänzung der Sinnermittlung | 103 | ||
| 1. Die unmittelbare Vorgeschichte der Grundgesetzgebung | 103 | ||
| 2. Die Haltung der Parteien in der Eigentumsfrage zwischen 1945 und 1949 | 104 | ||
| a) bürgerliche Parteien | 104 | ||
| b) Arbeiterparteien | 107 | ||
| 3. Das Eigentumsgrundrecht im Parlamentarischen Rat | 109 | ||
| 4. Mitbestimmungsfrage und Grundgesetzgebung | 112 | ||
| 5. Die historische Entwicklung des Eigentumsrechts bis zum Bürgerlichen Gesetzbuch | 115 | ||
| a) Privateigentum in der Neuzeit | 115 | ||
| aa) Entwicklungstendenzen im Naturrecht | 115 | ||
| bb) Eigentum und Positivismus | 116 | ||
| cc) Eigentum als Basis des Liberalismus | 117 | ||
| b) Privateigentum an Produktionsmitteln | 118 | ||
| c) Theorien zur Rechtfertigung des Eigentums | 120 | ||
| aa) Ableitung aus der menschlichen Natur | 120 | ||
| bb) Ableitung aus der Erwerbsart | 121 | ||
| cc) Kritik | 121 | ||
| d) Karl Marx und das Privateigentum | 124 | ||
| aa) Seine Wirtschaftstheorie | 124 | ||
| bb) Wirkung auf die Zeitgenossen | 125 | ||
| cc) Bleibende Wirkung | 129 | ||
| 6. Privateigentum und Weimarer Reichsverfassung | 131 | ||
| a) verfassungrechtliche Neuorientierung | 131 | ||
| b) Widerstände der Praxis | 133 | ||
| c) Haltung der Rechtslehre | 135 | ||
| 7. Privateigentum im Dritten Reich | 138 | ||
| a) Umwertung des Rechts zur Pflicht | 138 | ||
| b) Verborgener Fortschritt | 139 | ||
| IV. Das Ergebnis der Sinnermittlung | 140 | ||
| 1. Eigentum als komplexer Zielbegriff | 140 | ||
| 2. Stufen der Eigentümermacht | 142 | ||
| a) statisches Eigentum | 142 | ||
| b) Eigentum im Tauschverkehr | 142 | ||
| c) Eigentum im Produktivbereich | 143 | ||
| 3. Legitimationsgrundlagen | 143 | ||
| 4. Regelungsmaximen des Gesetzgebers | 145 | ||
| D. Konkretisierung der Eigentumsgewährleistung in der Mitbestimmungsfrage | 148 | ||
| I. Eingrenzung der Mitbestimmungsproblematik | 148 | ||
| 1. Mitbestimmung als Entscheidungsteilhabe | 148 | ||
| 2. Mitbestimmung und Vermögensbildung | 150 | ||
| II. Die aktive wirtschaftspolitische Rolle des Staates | 152 | ||
| 1. Das Recht zur Marktbeeinflussung | 152 | ||
| 2. Risikominderung durch Konjunkturpolitik | 155 | ||
| III. Die Rolle des Eigentümers im Unternehmen | 159 | ||
| 1. Der Eigentümer-Unternehmer | 160 | ||
| 2. Das Großunternehmen | 161 | ||
| a) Machtprobleme | 161 | ||
| b) Organisationsstrukturen | 163 | ||
| c) Aktionärsverhalten | 165 | ||
| d) Vorteile der Funktionentrennung | 168 | ||
| e) Unternehmenskonzentrationen | 170 | ||
| f) Aktionärsfunktionen | 172 | ||
| IV. Die rechtlichen Folgerungen | 174 | ||
| 1. Fähigkeit zur Funktionswahrnehmung | 175 | ||
| a) Eigentümer-Unternehmer | 175 | ||
| b) Aktionäre | 175 | ||
| 2. Funktionsvereitelung durch Mitbestimmung? | 176 | ||
| a) Aktionäre | 176 | ||
| b) Eigentümer-Unternehmer | 178 | ||
| c) Ermessensspielraum des Gesetzgebers | 179 | ||
| Schluß: Wesensgehalt, Enteignung und Vergesellschaftung | 180 | ||
| Literaturverzeichnis | 183 |
