Ausgewählte Schriften
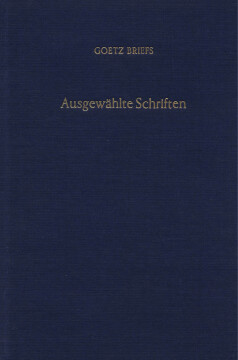
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Ausgewählte Schriften
2 Halbbde. I. Bd.: Mensch und Gesellschaft; II. Bd.: Wirtschaftsordnung und Sozialpartnerschaft. Hrsg. von Heinrich Basilius Streithofen / Rüdiger von Voss
Editors: Streithofen, Heinrich Basilius | Voss, Rüdiger von
(1980)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Erster Band: Mensch und Gesellschaft | 3 | ||
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung | 9 | ||
| I. | 9 | ||
| II. | 11 | ||
| III. | 19 | ||
| Nachweise | 25 | ||
| Erstes Kapitel: Person und Ethos | 29 | ||
| Person und Individuum im Denken Europas | 29 | ||
| Das „Soziale“ und die „Gemeinschaft“ | 29 | ||
| I. Das „Soziale“ im griechischen und römischen Denken | 29 | ||
| II. Eigenständiger christlicher Ansatz für das „Soziale“ | 30 | ||
| 1. Der Person-Begriff | 30 | ||
| 2. Von Theologie und Ethik geprägter Gesellschaftsbegriff | 31 | ||
| III. Das „Soziale“ im heutigen Verständnis | 33 | ||
| 1. Die Ära der Sozialphilosophien | 33 | ||
| 2. Das „Soziale“ als neuer Gesellschaftsbegriff | 34 | ||
| Das Ethos in der pluralistischen Gesellschaft von heute | 36 | ||
| Zum Problem der „Grenzmoral“ | 51 | ||
| I. Begriffe und Abgrenzungen | 51 | ||
| II. „Grenzmoral“ und die großen Wirtschaftsverbände | 53 | ||
| 1. Die Dynamik submarginalen Drucks | 53 | ||
| 2. Widerstand gegen submarginalen Druck | 55 | ||
| III. Zur Beurteilung des submarginalen Drucks und der Gegenwehr der Verbände | 57 | ||
| 1. Zwei Arten submarginalen Drucks | 57 | ||
| 2. Die Verbände operieren vor allem zu Lasten der Verbraucher | 58 | ||
| 3. Verdeckung des submarginalen Drucks der Verbände | 59 | ||
| IV. Submarginales Verhalten als Ausdruck der Freiheit des Menschen | 60 | ||
| Grenzmoral in der pluralistischen Gesellschaft | 62 | ||
| I. | 62 | ||
| II. | 64 | ||
| III. | 65 | ||
| IV. | 67 | ||
| V. | 70 | ||
| VI. | 72 | ||
| VII. | 74 | ||
| Vom Sinn der Arbeit | 75 | ||
| Zweites Kapitel: Kirche und Gesellschaft | 79 | ||
| Die wirtschafts- und sozialpolitischen Ideen des Katholizismus | 79 | ||
| Grundsätzliches zur Frage Christentum und Sozialismus | 109 | ||
| Kapitalismus, soziale Frage und Kirche | 116 | ||
| Katholische Soziallehre, Laissez-faire-Liberalismus und soziale Marktwirtschaft | 125 | ||
| Fragwürdigkeiten eines Programms | 138 | ||
| Bedenkliches in der „Offenburger Erklärung“ der CDU-Sozialausschüsse | 138 | ||
| 1. Der katholische Hintergrund der „Offenburger Erklärung“ | 138 | ||
| 2. Zum Leitsatz: Der Mensch ist wichtiger als die Sache | 140 | ||
| 3. Zum Leitbild der offenen Gesellschaft | 141 | ||
| 4. Zur These vom Vorrang der Arbeit vor allen anderen Werten | 143 | ||
| Ein bemerkenswerter Brief | 146 | ||
| Drittes Kapitel: Demokratietheorie | 151 | ||
| Gesellschaft und Staat | 151 | ||
| Die Dialektik zwischen Liberalismus und Totalitarismus | 154 | ||
| Zur Soziologie der Demokratie | 162 | ||
| Gesellschaft und Staat in ihrer Wechselwirkung | 162 | ||
| Moderne Demokratie und liberale Weltanschauung | 163 | ||
| Gesetz der Wandlungen und Entfaltung der Demokratie | 164 | ||
| Die neue Basis des Gesellschaftsvertrages | 165 | ||
| Kompetenz der tragenden Gemeinschaften – Gefahr ihres Verfalls | 165 | ||
| Überzeugung von moderner pragmatischer Demokratie und Kollektivismus – Die Rolle des Organisationswesens | 167 | ||
| Forderung der Stunde | 169 | ||
| Forderungen ohne Maß | 171 | ||
| Versorgungsstaat und Demokratismus | 171 | ||
| Zum Begriff des Pluralismus | 181 | ||
| Der Begriff des Pluralismus | 181 | ||
| „Wahrer“ und „falscher“ Pluralismus | 183 | ||
| Die doppelte Front des Pluralismus der Gegenwart | 185 | ||
| Die Merkmale des Pluralismus der Gegenwart | 186 | ||
| Der Pluralismus als Phase des Liberalismus | 187 | ||
| Verbände und Laissez-faire-Pluralismus | 189 | ||
| Demokratie ohne Interessenverbände? | 189 | ||
| Die Aufhebung des Laissez-faire | 190 | ||
| Consensus als Grundsatz der Integration? | 192 | ||
| Die politische Entscheidung | 197 | ||
| Die Revision des Gesetzes des Antritts der Verbände | 201 | ||
| Das amerikanische Jahrhundert? | 202 | ||
| I. | 202 | ||
| II. | 203 | ||
| III. | 205 | ||
| V. | 209 | ||
| Viertes Kapitel: Kapitalismus zwischen Liberalismus und Sozialismus | 211 | ||
| Das gewerbliche Proletariat | 211 | ||
| Vorbemerkung zur Literatur | 211 | ||
| Vorbemerkung | 213 | ||
| Einleitung: Die antagonistischen Figuren Kapital und Arbeit | 213 | ||
| I. Kapitel: Die Grundlagen des proletarischen Verhältnisses in der Wirtschafts- und Gesellschaftsverfassung des Kapitalismus | 214 | ||
| II. Kapitel: Der Begriff des Proletariats | 220 | ||
| III. Kapitel: Zur Dogmengeschichte des Begriffs | 239 | ||
| IV. Kapitel: Die proletarische Bewußtseinsbildung | 260 | ||
| V. Kapitel: Die Herkunft des Proletariats | 268 | ||
| VI. Kapitel: Die Bewegung des Proletariats | 276 | ||
| VII. Kapitel: Das proletarische Lebensschicksal | 300 | ||
| 1. Das gemeinproletarische Lebensschicksal | 301 | ||
| 2. Das historische proletarische Lebensschicksal | 308 | ||
| VIII. Kapitel: Expansion und Differenzierung des Proletariats | 311 | ||
| 1. Die Expansion | 311 | ||
| 2. Die Differenzierung | 313 | ||
| Lösungsentwürfe des proletarischen Problems | 328 | ||
| Das allgemeine Sozialproblem und der ‚proletarische Sozialismus‘ | 352 | ||
| Der klassische Liberalismus | 376 | ||
| Das neue soziale und wirtschaftliche Werden | 407 | ||
| Heilserwartung und Kollektivismus | 431 | ||
| Das neue Zeitalter der Religionskriege | 453 | ||
| Zweiter Band: Wirtschaftsordnung und Sozialpartnerschaft | III | ||
| Inhaltsverzeichnis | V | ||
| Fünftes Kapitel: Wirtschaft und Betrieb | 459 | ||
| Elemente der Weltanschauung in der Formation des Wirtschaftsdenkens | 459 | ||
| Automation und ihre Grenzen | 470 | ||
| Der verkannte Unternehmer | 483 | ||
| Unternehmer in Inflation und Stagnation | 491 | ||
| Falsche Thesen über den Manager | 492 | ||
| Die Idee der permanenten Hochkonjunktur | 493 | ||
| Keynes wurde mißverstanden | 494 | ||
| Das Ethos des Sozialen ist undefinierbar | 496 | ||
| Der Staat soll zuerst an den Verbraucher denken | 497 | ||
| Eigentumsbildung der Arbeiterschaft | 499 | ||
| I. | 499 | ||
| II. | 504 | ||
| III. | 508 | ||
| IV. | 516 | ||
| Wirtschaft zwischen Ordnung und Anarchie | 520 | ||
| Sechstes Kapitel: Gewerkschaftstheorie | 547 | ||
| Zur Kritik der klassischen Gewerkschaftstheorie | 547 | ||
| Gewerkschaftswesen und Gewerkschaftspolitik | 557 | ||
| 1. Das Wesen des Lohnsystems | 557 | ||
| 2. Gewerkschaft als proletarische Institution des Lohnsystems | 560 | ||
| 3. Theoretische Grundlegung der Gewerkschaft | 565 | ||
| 4. Bedingungen und Wirkungen der Gewerkschaften | 575 | ||
| 5. Das Verhältnis der Gewerkschaftsbewegung zu den anderen Richtungen der Arbeiterbewegung | 579 | ||
| 6. Die gewerkschaftlichen Zweckkreise | 592 | ||
| 7. Aufbau, Verfassung und Verwaltung der Gewerkschaften | 611 | ||
| 8. Die Bedeutung der Gewerkschaften | 625 | ||
| Arbeiter und Arbeiterbewegung | 634 | ||
| Literatur | 646 | ||
| Die Gewerkschaften am Scheideweg | 648 | ||
| Gewerkschaft und Arbeiterbewegung | 656 | ||
| I. | 656 | ||
| II. | 658 | ||
| III. | 661 | ||
| IV. | 665 | ||
| V. | 668 | ||
| VI. | 670 | ||
| VII. | 675 | ||
| Das Streikproblem gestern und heute | 679 | ||
| I. | 679 | ||
| II. | 684 | ||
| III. | 688 | ||
| IV. | 692 | ||
| V. | 696 | ||
| VI. | 700 | ||
| Closed Shop. Amerikas Gewerkschaften drängen zum Monopol | 703 | ||
| I. | 703 | ||
| II. | 705 | ||
| III. | 709 | ||
| Die Freiheit der Gewerkschaften steht auf dem Spiel | 714 | ||
| Kritische Bemerkungen zum Entwurf des DGB-Grundsatzprogramms 1963 | 721 | ||
| I. Notwendige Anpassung der Gewerkschaften an die Erfordernisse der gesellschaftlichen Wandlung des 20. Jahrhunderts | 721 | ||
| 1. Der säkulare Horizont der Anpassungsprobleme | 721 | ||
| 2. Die Schwierigkeiten der Gewerkschaften heute | 722 | ||
| II. Zum Versuch einer Anpassung im DGB-Entwurf eines neuen Grundsatzprogramms | 727 | ||
| III. Der DGB als Subjekt der Forderungen | 729 | ||
| IV. Der Verbraucher als eigentlicher Adressat der DGB-Forderungen | 734 | ||
| 1. Der Unternehmer als primärer Adressat | 734 | ||
| 2. Der Mythos von der „Gesellschaft“ als Adressat | 736 | ||
| 3. Der Staat als Adressat | 737 | ||
| 4. Der anonyme Verbraucher als der eigentliche Adressat | 738 | ||
| V. Begründung der DGB-Forderungen | 739 | ||
| 1. Begründung aus dem Naturrecht | 740 | ||
| 2. Begründung aus dem „Unrecht schlechthin“ an der Arbeiterschaft | 742 | ||
| 3. Begründung aus mangelndem Selbstverständnis der Gewerkschaften | 743 | ||
| 4. Begründung aus den Folgen gewerkschaftlicher Wohlfahrtspolitik | 745 | ||
| VI. Das mögliche Verhalten der Gewerkschaften | 746 | ||
| Epilog | 757 | ||
| Die Grenzen der Tarifautonomie | 758 | ||
| Im Rhythmus der Wirtschaft | 759 | ||
| Zum Nutzen der Gewerkschaften | 760 | ||
| Die privilegierten Verbände | 763 | ||
| Sieben Einwände gegen die paritätische Mitbestimmung der Gewerkschaften | 766 | ||
| Theorie der Gewerkschaften | 778 | ||
| 1. Begriff | 778 | ||
| 2. Grundlegung der dynamischen Gewerkschaftstheorie | 779 | ||
| 3. Gewerkschafts- und Wirtschaftsordnung | 786 | ||
| 4. Das Integrationsproblem | 786 | ||
| 5. Die Fraglichkeit der Integration | 796 | ||
| 6. Von der klassischen zur befestigten Gewerkschaft | 798 | ||
| 7. Probleme der gewerkschaftlichen Funktionsgrenze | 803 | ||
| 8. Die Dialektik der befestigten Gewerkschaft | 805 | ||
| 9. Die gewerkschaftliche Alternative | 807 | ||
| Gewerkschaftslogik und Mitbestimmung | 810 | ||
| I. | 810 | ||
| II. | 815 | ||
| III. | 818 | ||
| IV. | 818 | ||
| V. | 823 | ||
| VI. | 824 | ||
| VII. | 828 | ||
| VIII. | 832 | ||
| Zwischen Logik und Dialektik der wirtschaftlichen Mitbestimmung | 834 | ||
| 1. | 837 | ||
| 2. | 839 | ||
| 3. | 843 | ||
| 4. | 846 | ||
| 5. | 848 | ||
| 6. | 851 | ||
| 8. | 857 | ||
| 9. | 861 | ||
| 10. | 862 | ||
| Epilog | 868 |
