Rechtliche Grenzen der Provokation von Straftaten
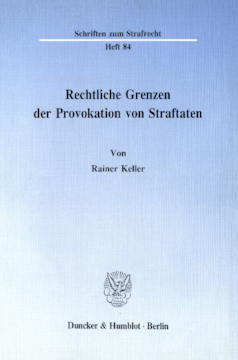
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Rechtliche Grenzen der Provokation von Straftaten
Schriften zum Strafrecht, Vol. 84
(1989)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorbemerkung | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung | 13 | ||
| 1. Definitionen | 13 | ||
| 2. Tatsächliche Entwicklung und herkömmliche Bewertung der Deliktsprovokation | 15 | ||
| 3. Zum historischen und soziologischen Verständnis von Deliktsprovokationen | 19 | ||
| 4. Polizeiliche Deliktsprovokation und innere Sicherheit | 21 | ||
| 5. Gang der Untersuchung | 26 | ||
| Teil 1: Normative Schranken der Deliktsprovokation | 27 | ||
| A. Spezifisch den Staat bindende Normen | 27 | ||
| I. Gesetzesbindung, Legalitätsprinzip und öffentliche Sicherheit | 29 | ||
| 1. Bindung an Sekundärnormen | 29 | ||
| 2. Entsprechungen im materiellen Strafrecht | 32 | ||
| 3. Gesetzesbindung, Vertrauensschutz und scheinbar privates Handeln | 33 | ||
| 4. Gesetzesbindung unzuständiger Behörden | 34 | ||
| 5. Gesetzesbindung staatlich beauftragter Privater | 36 | ||
| 6. Fazit | 37 | ||
| II. Tatstrafrecht versus Stigmatisierung von Tätern | 39 | ||
| 1. Täterbezug der Provokation | 40 | ||
| 2. Tatprinzip als Garantie sozialer Freiheit | 41 | ||
| 3. Bindung von Exekutivbehörden und richterliche Unabhängigkeit | 44 | ||
| 4. Das Prinzip des Tatstrafrechts nicht tangierende Provokationsarten | 45 | ||
| III. Schuldprinzip | 46 | ||
| IV. Grenzen strafprozessualer Ermittlungen und kompetenzielle Zuordnung der Provokation | 47 | ||
| V. Koppelungsverbot und Gewaltenteilung | 50 | ||
| VI. Zusammenfassung und Vergleich mit der Rechtsprechung | 57 | ||
| B. Elemente des allgemeinen Persönlichkeitsrechts als Grenze der Deliktsprovokation | 59 | ||
| I. Überblick zu den möglichen Beeinträchtigungen | 59 | ||
| II. Bisherige Fassung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und seine Erweiterung | 65 | ||
| 1. Zur Bedeutung und Begründung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts | 65 | ||
| 2. Bewertung der Deliktsprovokation nach der Sphärentheorie | 69 | ||
| 3. Probleme der Sphärentheorie | 72 | ||
| 4. Erweiterung des Persönlichkeitsschutzes durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung | 75 | ||
| a) Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Deliktsprovokation | 75 | ||
| b) Begründung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung | 77 | ||
| c) Privatisierung der Öffentlichkeit und Begrenzung der Verantwortung? | 79 | ||
| d) Unübersichtlichkeit der differenzierten Gesellschaft als Legitimation von Kontrolle? | 81 | ||
| e) Verrechtlichung von Freiheit – subjektives Recht und objektive Gerechtigkeit | 82 | ||
| 5. Erweiterung des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes jenseits informationeller Selbstbestimmung? | 85 | ||
| III. Schutz vor sozialer Desintegration | 87 | ||
| 1. Verhältnis zwischen Bürgern und Selbstverantwortung | 88 | ||
| 2. Das Verhältnis des Bürgers zum Staat | 92 | ||
| 3. Stellungnahmen der Rechtsprechung und Alternativen der polizeilichen Deliktsprovokation | 95 | ||
| 4. Rechtsstaatliche Normen als Verbot der Desintegration durch den Staat | 99 | ||
| IV. Schutz vor Vertrauensmißbrauch | 99 | ||
| 1. Vertrauensschutz und Selbstverantwortung im Verhältnis zwischen Bürgern | 101 | ||
| a) Die Aufforderung, ein Delikt zu begehen | 101 | ||
| b) Die vertrauenswidrige Anzeige | 104 | ||
| c) Die Provokation | 104 | ||
| d) Schädigungsabsicht und Zweckverfehlung als mögliche Gründe des Mißbrauchsverbots | 106 | ||
| e) Mißbrauchsverbote in Sonderverhältnissen | 111 | ||
| f) Soziales Vertrauen und bürokratische Generalisierung | 113 | ||
| 2. Vertrauensschutz im Verhältnis zum Staat | 114 | ||
| 3. § 136a StPO | 116 | ||
| a) Beschuldigter, Zeuge und Vorstadium des Strafprozesses | 117 | ||
| b) Vernehmung | 120 | ||
| c) Täuschung | 123 | ||
| V. Nemo tenetur se ipsum prodere und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung | 128 | ||
| 1. Schutz von Informationen über rechtswidriges Verhalten | 128 | ||
| 2. Zusammenhang der informationellen Selbstbestimmung mit dem nemo tenetur-Grundsatz | 131 | ||
| 3. Verstoß gegen den nemo tenetur-Grundsatz durch Täuschung? | 133 | ||
| 4. Differenzierung des Schutzes von Beschuldigten und Nichtbeschuldigten | 137 | ||
| 5. Geltung des nemo tenetur-Grundsatzes außerhalb des Strafverfahrens | 139 | ||
| a) Alltäglicher Zwang zur Selbstbelastung und Verteilung des informationellen Risikos | 139 | ||
| b) Bedeutung der sozial gesonderten Sphäre der Öffentlichkeit für Freiheit und Zurechnung | 142 | ||
| c) Überlagerung der Öffentlichkeit und rechtliche Trennung | 144 | ||
| 6. Zusammenfassung | 147 | ||
| 7. Zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung gegenüber Privaten | 148 | ||
| VI. Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Deliktsprovokation – Zusammenfassung | 149 | ||
| C. Zurechnung von Normverstößen zum Staat | 151 | ||
| D. Von der provozierten Tat betroffene Normen nichtstrafrechtlicher Art | 158 | ||
| E. Strafrechtliche Grenzen der Deliktsprovokation | 160 | ||
| I. Provokation des Versuchs durch Teilnahme | 161 | ||
| 1. Teilnahme als Delikt gegen den Täter (Schuldteilnahmelehre und Modifikation) | 161 | ||
| 2. Unrechtsteilnahme oder eigener Rechtsgutsangriff | 165 | ||
| 3. Das Verhältnis von Delikts – und Ergänzungstatbeständen | 173 | ||
| a) Grenzen der Modifikation des Deliktstatbestandes bei Versuch und Teilnahme | 175 | ||
| b) Tatsächlicher Bezug des Teilnehmerverhaltens zum deliktstatbestandlichen Verhalten | 177 | ||
| c) Versuch des Versuchs | 178 | ||
| d) Bezug der Teilnahme auf das deliktstatbestandliche Verhalten bei der Kettenteilnahme | 180 | ||
| e) Bezug des strafbaren Unterlassens auf den Deliktstatbestand | 190 | ||
| f) Selbständiger Unwert des Versuchs? | 191 | ||
| g) Teilnahme am Versuch und Akzessorietät – Ergebnis | 191 | ||
| 4. Provokation durch Beihilfe | 194 | ||
| 5. Resümee | 195 | ||
| II. Provokation des vollendeten Delikts durch Teilnahme | 195 | ||
| 1. Anwendbarkeit der materiellen Kriterien | 198 | ||
| a) Abstrakte Gefährdungsdelikte | 198 | ||
| b) Konkrete Gefährdungsdelikte und Dauerdelikte | 201 | ||
| c) Absichts – und Unternehmensdelikte | 202 | ||
| d) Rechtspolitische Erwägungen | 204 | ||
| 2. Kritik der materiellen Kriterien | 205 | ||
| a) Materielle und gesetzliche Bestimmung von Rechtsgütern | 205 | ||
| b) Rechtsgüter und Verkehrsformen | 208 | ||
| c) Grenzen der Wertung und des Schuldprinzips | 211 | ||
| 3. Analogie von Absichtsdelikt und Versuch | 212 | ||
| a) Politische Absichtsdelikte als Beispiel | 213 | ||
| b) Begründung der Analogie | 215 | ||
| c) Verhältnis von Vorsatz und Absicht | 218 | ||
| d) Verhältnis von Tätervorsatz und Teilnehmervorsatz | 219 | ||
| e) Formale Bedeutung der Akzessorietät | 224 | ||
| f) Materielle Bedeutung der Akzessorietät | 225 | ||
| g) Anwendbarkeit der §§ 28, 29 StGB | 228 | ||
| h) Schuldprinzip und Forderung nach Individualisierung | 230 | ||
| i) Vergleich mit notwendiger Teilnahme | 232 | ||
| k) Wertungswidersprüche | 234 | ||
| l) Vernachlässigung des Rechtsgüterschutzes oder Gesinnungshaftung | 235 | ||
| 4. Provokation von Tendenz- und Unternehmensdelikten | 236 | ||
| 5. Analogie zum Rücktritt und polizeiliche Interessen an Straffreiheit | 238 | ||
| III. Provokation durch Mittäterschaft | 246 | ||
| IV. Straffreie Mittel der Provokation | 250 | ||
| 1. Besondere Mittel der Anstiftung | 250 | ||
| 2. Sozialadäquanz als Grenze der Teilnehmerhaftung | 252 | ||
| 3. Subjektive Freiheitsrechte als Grenze der Teilnehmerhaftung | 254 | ||
| 4. Parallelen in anderen Rechtsgebieten | 257 | ||
| 5. Objektive oder subjektive Kriterien der subjektiven Rechte | 259 | ||
| 6. Zusammenfassung | 262 | ||
| V. Besonderheiten der staatlichen Provokation (Pflichtdelikte) | 262 | ||
| 1. Allgemeine Delikte und staatliche Sonderpflichten | 263 | ||
| a) Öffentliche Sicherheit und Garantenpflicht | 264 | ||
| b) Der polizeiliche Provokateur als Täter | 268 | ||
| c) Garantenpflichten für Kollektivrechtsgüter | 270 | ||
| 2. Besondere Pflichtdelikte | 273 | ||
| 3. Haftung Privater als Amtsträger | 275 | ||
| VI. Zusammenfassung der strafrechtlichen Grenzen der Deliktsprovokation | 276 | ||
| Teil 2: Möglichkeiten der Rechtfertigung und Begründung von Deliktsprovokationen | 277 | ||
| A. Rechtfertigung privater Provokationen gemäß § 34 StGB | 277 | ||
| I. Provokation zwecks Ahndung vergangener Straftaten | 278 | ||
| 1. Schutz von Kollektivrechtsgütern – subjektives Recht und objektive Gerechtigkeit | 279 | ||
| 2. Konkretisierung und Gesetzesbindung des Rechtsguts | 284 | ||
| 3. Formales Recht und materiales Rechtsgut | 286 | ||
| 4. Rechtsgut und Prozeß | 287 | ||
| II. Provokation zwecks Gefahrenabwehr durch Strafe | 291 | ||
| III. Sicherheit der Volksgesundheit als Beispiel eines Kollektivrechtsgutes | 294 | ||
| IV. Gefährdung von Rechtsgütern und Erforderlichkeit von Schutzmaßnahmen | 296 | ||
| V. Beeinträchtigte Rechtsgüter und Abwägung | 300 | ||
| VI. Probleme der Angemessenheit und Kommensurabilität des Mittels der Provokation | 306 | ||
| 1. Verbot, auf die Seite des Unrechts zu treten? | 308 | ||
| 2. Unzuständigkeit Privater beim Schutz von Kollektivrechtsgütern? | 311 | ||
| 3. Begrenzung privater Nothilfe gemäß den staatlichen Befugnissen? | 315 | ||
| 4. Vorrang rechtlich geordneter Verfahren | 317 | ||
| a) Strikter oder relativer Vorrang von Verfahren | 318 | ||
| b) Stellungnahmen von Rechtsprechung und Literatur | 319 | ||
| c) Verhältnis von polizeilichen Verfahren und privatem Eingriff | 323 | ||
| d) Die Phase staatlich organisierter Gefahrenabwehr | 326 | ||
| e) Fazit | 329 | ||
| B. Einverständnis und Einwilligung | 330 | ||
| C. Öffentlichrechtliche Begründungen der staatlichen Deliktsprovokation | 331 | ||
| I. Strafprozeßrecht | 331 | ||
| II. Polizeirecht, Gefahrenabwehr und Gefahrenvorsorge | 331 | ||
| 1. Konkrete Gefahr, Gefahrverdacht, Gefahrenvorsorge | 331 | ||
| 2. Polizeipflichtigkeit | 335 | ||
| 3. Geeignetheit und rechtliche Unmöglichkeit | 336 | ||
| 4. Gesetzesbindung | 337 | ||
| 5. Geringstmöglicher Eingriff und Verhältnismäßigkeit | 343 | ||
| 6. Fazit | 344 | ||
| III. Verfassungsschutzrechtliche Gefahrenvorsorge als Begründung der Deliktsprovokation | 345 | ||
| IV. Präventive Verbote, gesetzliche Befreiungen und behördliche Erlaubnisse | 348 | ||
| D. Begründung staatlicher Deliktsprovokationen durch § 34 StGB | 354 | ||
| I. Eingriffe in Individualrechtsgüter | 355 | ||
| 1. Argumente für die Anwendung des § 34 StGB auf hoheitliche Eingriffe | 355 | ||
| 2. Kritik der Ausweitung des § 34 StGB | 358 | ||
| 3. Grenzen der Legitimation von Mitteln durch Zwecke | 361 | ||
| 4. Begründung staatlicher Eingriffe durch rechtlich geordnete Verfahren | 363 | ||
| 5. Empirische Differenzen von privatem und staatlichem Handeln | 364 | ||
| 6. Allgemeine Rechtsgedanken und Analogie | 365 | ||
| 7. Ausnahmezustand und Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege | 367 | ||
| II. Eingriffe in Rechtsgüter der Allgemeinheit | 369 | ||
| 1. Erweiterter Vorbehalt des Gesetzes und Primat parlamentarischer Entscheidung | 371 | ||
| 2. Vorrang des Gesetzes, öffentliches und Privatinteresse | 374 | ||
| E. Rechtswidrige staatliche Deliktsprovokation und Ausschluß des Strafunrechts gemäß § 34 StGB | 377 | ||
| I. Allgemeine Erwägungen | 378 | ||
| II. Die Bedeutung des Handlungsunwerts für das Strafrecht | 380 | ||
| III. Die Bedeutung von Rollenpflichten für das Strafrecht | 381 | ||
| IV. Sozialethik als Kriterium | 384 | ||
| V. Die Bedeutung des Rechtsgüterschutzes für das Strafrecht | 386 | ||
| VI. Konkurrenz der Rechtfertigungsgründe | 388 | ||
| VII. Ungleichheit und Rollenverteilung | 392 | ||
| VIII. Normzweckerwägungen | 392 | ||
| 1. Schutz der Rechtsstaatlichkeit | 393 | ||
| 2. Zweck von Kompetenzregelungen | 394 | ||
| 3. Hypothetischer Kausalverlauf, rechtmäßiges Alternativverhalten | 396 | ||
| 4. Gesonderte Bewertung von Kompetenzanmaßungen? | 397 | ||
| 5. Die Rettungstendenz der Amtshandlung | 398 | ||
| 6. Vergleich mit anderen Regelungen | 401 | ||
| IX. Teilweise Rechtfertigung, Analogie und Verhältnismäßigkeitserwägungen | 404 | ||
| X. Fazit zum Strafunrechtsausschluß | 409 | ||
| Ergebnis der gesamten Untersuchung | 410 | ||
| Literaturverzeichnis | 414 |
