Möglichkeiten betriebswirtschaftlicher Beurteilung privater Kapitalanlagen
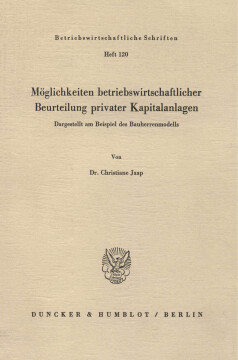
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Möglichkeiten betriebswirtschaftlicher Beurteilung privater Kapitalanlagen
Dargestellt am Beispiel des Bauherrenmodells
Betriebswirtschaftliche Schriften, Vol. 120
(1986)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Geleitwort | V | ||
| Inhalt | VII | ||
| Abkürzungsverzeichis | XII | ||
| Symbolverzeichnis | XVI | ||
| 1. Problemstellung, Abgrenzung und Gang der Untersuchung | 1 | ||
| 2. Entwicklung eines Grundmodells zur betriebswirtschaftlichen Beurteilung privater Kapitalanlagen | 8 | ||
| 2.1. Grundlagen | 8 | ||
| 2.1.1. Kriterien der Modellbildung | 8 | ||
| 2.1.2. Grundlegende Annahmen | 10 | ||
| 2.1.3. Zahlungen | 13 | ||
| 2.1.3.1. Begriffsbestimmungen | 13 | ||
| 2.1.3.2. Einzubeziehende Zahlungen | 16 | ||
| 2.1.3.3. Zahlungszeitpunkte | 21 | ||
| 2.1.4. Abgrenzung zwischen modellexogenen und modellendogenen, unabhängigen und abhängigen sowie personenbezogenen und objektbezogenen Größen | 23 | ||
| 2.1.5. Länge des Planungszeitraums | 26 | ||
| 2.2. Ermittlungsrechnung | 29 | ||
| 2.2.1. Entscheidungskalkül | 29 | ||
| 2.2.1.1. Grundsätzliche Überlegungen zu den Ergänzungsmaßnahmen | 31 | ||
| 2.2.1.2. Ausgewählte Ansätze in der Literatur | 34 | ||
| 2.2.1.3. Beschreibung des angewendeten Entscheidungskalküls | 40 | ||
| 2.2.1.3.1. Quantifizierung der derivativen Zahlungen und Begründung für die Wahl eines kombinatorischen Partialmodells | 40 | ||
| 2.2.1.3.2. Konkretisierung der Zielgröße ‘Gewinnmaximierung’ sowie Überlegungen zu den Konsumentnahmen | 42 | ||
| 2.2.1.3.3. Mögliche Modellerweiterungen | 44 | ||
| 2.2.1.3.4. Zusammenstellung der Prämissen zum Entscheidungskalkül | 45 | ||
| 2.2.2. Ermittlung der Steuerzahlungen | 48 | ||
| 2.2.2.1. Veranlagungssimulation versus Teilsteuerrechnung | 48 | ||
| 2.2.2.2. Steuerarten mit zum Teil derivativen Zahlungen | 55 | ||
| 2.2.2.2.1. Einkommensteuer und Kirchensteuer | 57 | ||
| 2.2.2.2.1.1. Berechnung bei Vernachlässigung von Verlustabzügen | 57 | ||
| 2.2.2.2.1.2. Einbeziehung von Verlustabzügen | 60 | ||
| 2.2.2.2.2. Vermögensteuer | 69 | ||
| 2.2.2.3. Ableitung von Differenzsteuersätzen | 70 | ||
| 2.2.3. Ermittlung der optimalen Nutzungsdauer | 76 | ||
| 2.3. Analyserechnungen | 78 | ||
| 2.3.1. Globalanalyse | 78 | ||
| 2.3.2. Ursachenanalyse | 80 | ||
| 2.4. Zusammenfassung | 85 | ||
| 2.4.1. Zusammenstellung der Prämissen des Grundmodells | 85 | ||
| 2.4.2. Beschreibung des Grundmodells im Zusammenhang | 89 | ||
| 3. Anwendung des Grundmodells auf die Anlagemöglichkeit ‘Bauherrenmodell’ | 97 | ||
| 3.1. Begriff, Konzeption und Risiken des Bauherrenmodells | 97 | ||
| 3.2. Einige Probleme in den Literaturbeiträgen zur betriebswirtschaftlichen Beurteilung des Bauherrenmodells und Einordnung des eigenen Ansatzes | 103 | ||
| 3.3. Konkretisierungen und Erweiterungen zum Grundmodell | 115 | ||
| 3.3.1. Teilung des Planungszeitraums | 116 | ||
| 3.3.2. Ermittlung der Periodenergebnisse | 118 | ||
| 3.3.2.1. Kalkulierter und tatsächlicher Gesamtaufwand sowie betriebswirtschaftliche Gesamtkosten | 118 | ||
| 3.3.2.2. Einzelheiten zu den Projektzahlungen | 120 | ||
| 3.3.2.3. Einzelheiten zu den ausschließlich originären Steuerzahlungen | 128 | ||
| 3.3.2.3.1. Grunderwerbsteuer und Umsatzsteuer | 129 | ||
| 3.3.2.3.2. Grundsteuer | 136 | ||
| 3.3.3. Ermittlung der Veränderungen des zu versteuernden Einkommens | 141 | ||
| 3.3.3.1. Anschaffungskosten, Herstellungskosten und in der Bauphase sofort abzugsfähige Werbungskosten | 143 | ||
| 3.3.3.2. Abschreibungen | 150 | ||
| 3.3.4. Ermittlung der Veränderungen des steuerpflichtigen Vermögens | 151 | ||
| 3.3.5. Ermittlung der optimalen Abschreibungsalternative | 153 | ||
| 3.3.6. Besonderheiten bei der Ermittlung der optimalen Nutzungsdauer | 161 | ||
| 3.3.7. Zusammenstellung der speziell für die Anlagemöglichkeit ‘Bauherrenmodell’ geltenden Prämissen | 162 | ||
| 3.4. Anwendungsbeispiel | 168 | ||
| 3.4.1. Ausgangsdaten | 168 | ||
| 3.4.2. Ermittlungsrechnung | 176 | ||
| 3.4.3. Ursachenanalyse und Interpretation der Ergebnisse | 186 | ||
| 3.5. Ableitung tendenzieller Aussagen zum Einfluß ausgewählter exogener Größen auf die Ergebnisgrößen mit Hilfe der Analyserechnungen | 199 | ||
| 3.5.1. Begrenzung der Untersuchung durch Begrenzung der Schwankungsbereiche bzw. Festlegung der Werte exogener Größen | 200 | ||
| 3.5.1.1. Grundlagen der Festlegung der Schwankungsbereiche exogener Größen | 201 | ||
| 3.5.1.2. Abbildung von Abhängigkeiten zwischen einzelnen exogenen Größen | 202 | ||
| 3.5.1.3. Festlegung der Schwankungsbereiche bzw. der Werte im einzelnen | 203 | ||
| 3.5.1.4. Zusammenstellung der Prämissen zu den Schwankungsbereichen und zu den Werten exogener Größen | 215 | ||
| 3.5.2. Weitere Begrenzung der Untersuchung durch Ausschluß bestimmter Kombinationen von Werten exogener Größen | 216 | ||
| 3.5.3. Einflüsse ausgewählter objektbezogener Größen auf die Ergebnisgrößen bei ausgewählten Kombinationen zwischen den subjektbezogenen Größen | 221 | ||
| 3.5.3.1. Überblick | 221 | ||
| 3.5.3.2. Variation 1: Hohes Basiseinkommen, hohes Basisvermögen und niedriger Bruttokalkulationszinsfuß | 223 | ||
| 3.5.3.3. Variation 2: Hohes Basiseinkommen, hohes Basisvermögen und hoher Bruttokalkulationszinsfuß | 240 | ||
| 3.5.3.4. Variation 3: Niedriges Basiseinkommen, hohes Basisvermögen und niedriger Bruttokalkulationszinsfuß | 257 | ||
| 3.5.3.5. Variation 4: Hohes Basiseinkommen, niedriges Basisvermögen und niedriger Bruttokalkulationszinsfuß | 267 | ||
| 3.5.3.6. Zusammenfassung der Ergebnisse der Variationen | 272 | ||
| 4. Schlußbetrachtung | 282 | ||
| Anlagen | 285 | ||
| – Anlage 1: Variation 1 – Ergebnisse der Variationsrechnungen | 285 | ||
| – Anlage 2: Variationen – Beispiel 8: Grundlagen zur Zerlegung der absoluten Wirkung einer Verringerung des Basiseinkommens | 302 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 305 | ||
| Tabellenverzeichnis | 307 | ||
| Literaturverzeichnis | 309 |
