Gleichgewicht, Entwicklung und soziale Bedingungen der Wirtschaft
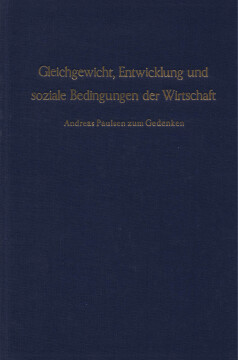
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Gleichgewicht, Entwicklung und soziale Bedingungen der Wirtschaft
Andreas Paulsen zum Gedenken anläßlich seines 80. Geburtstages mit einer Auswahl von Schriften aus seinem Nachlaß
Editors: Ollenburg, Günter | Wedig, Wilhelm
(1979)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Zum Geleit | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| Günter Ollenburg, Berlin: Andreas Paulsen: Mensch, Wissenschaftler und Lehrer | 11 | ||
| I. Schriften aus dem Nachlaß von Andreas Paulsen | 21 | ||
| Zu den Schriften aus dem Nachlaß von Andreas Paulsen | 23 | ||
| Mensch und Industrie | 27 | ||
| Auftrag und Bewährung einer freien Wirtschaft | 39 | ||
| Verkehrswirtschaftliche und kommunistische Wirtschaftsordnung als Leitbilder der Wirtschaftspolitik | 51 | ||
| Das Geld und sein Wert | 59 | ||
| Einleitung | 59 | ||
| I. Begriff „Wert“ als Kaufkraft des Geldes | 59 | ||
| II. Was bestimmt den Geldwert? Die „Verkehrsgleichung“ | 61 | ||
| III. Die Beeinflussung des Geldwertes | 63 | ||
| IV. Schluß | 67 | ||
| Die Inflationsgefahr im wirtschaftlichen Wachstum | 71 | ||
| I. | 71 | ||
| II. | 72 | ||
| III. | 72 | ||
| IV. | 73 | ||
| V. | 75 | ||
| VI. | 77 | ||
| VII. | 78 | ||
| VIII. | 79 | ||
| IX. | 80 | ||
| Möglichkeiten geldpolitischer Beeinflussung der Konjunktur | 83 | ||
| Vorbemerkung | 83 | ||
| Voraussetzungen [geldpolitischer Aktivitäten] | 85 | ||
| Mittel der Konjunkturpolitik | 85 | ||
| Ziele der Geldpolitik | 86 | ||
| Ziele der Konjunkturpolitik | 86 | ||
| Konformität der Geld- und Fiskalpolitik als Mittel | 86 | ||
| Mitteleinsatz und Ziele der Geldpolitik | 88 | ||
| Inflation und Depression | 90 | ||
| Schleichende Inflation und Vielecks-Problem | 92 | ||
| Geistige und philosophische Aspekte der Welt von morgen | 95 | ||
| Einführung | 95 | ||
| Zeitwende | 95 | ||
| Abendländisches Menschentum | 97 | ||
| Person und Gesellschaft | 98 | ||
| Grenzfall: Absolutierung des Kollektivums | 99 | ||
| Geist und Freiheit | 100 | ||
| Möglichkeiten und Grenzen der Wissenschaft | 101 | ||
| Treue zur Vernunft | 104 | ||
| Gesellschaft | 104 | ||
| Zwischenstaatliche Beziehungen | 106 | ||
| Schluß | 107 | ||
| II. Wachstum und Konjunktur: Reale und monetäre Probleme in nach-Keynes’scher Sicht | 109 | ||
| Karl C. Thalheim, Berlin: Wirtschaftswachstum in sich wandelnder Welt | 111 | ||
| Rolf Krengel, Berlin: Keynes 1979? Ein Vergleich der wirtschaftlichen Lage im Deutschen Reich 1929–1933 mit der Bundesrepublik Deutschland 1974–1978 | 131 | ||
| Die Ausgangsthese der Untersuchung | 131 | ||
| Sozialprodukt | 131 | ||
| Privater Verbrauch | 132 | ||
| Öffentlicher Verbrauch | 133 | ||
| Anlage-Investitionen | 134 | ||
| Außenhandelsvolumen | 134 | ||
| Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenquote | 135 | ||
| Das industrielle Produktionspotential und seine Auslastung | 136 | ||
| Gesamtwirtschaftliches Preisniveau | 138 | ||
| Zwischenbilanz | 138 | ||
| Begründung für ein Investitionsprogramm | 139 | ||
| Zusammenfassung der Ergebnisse | 141 | ||
| Wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen | 141 | ||
| Horst Seidler, Berlin: Für Rückzug des Staates aus der Wirtschaft? Wirtschaftspolitische Überlegungen zum 15. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung | 145 | ||
| Günter Ollenburg, Berlin: Bemerkungen zu Problemen der Rohstoffversorgung | 153 | ||
| Weitere Literaturhinweise | 159 | ||
| Manfred Liebrucks/Jochen Hintze, Berlin: Über die Vorräte von mineralischen Rohstoffen aus traditioneller und theoretischer Sicht | 161 | ||
| 1. Einleitung | 161 | ||
| 2. Definitionen | 161 | ||
| 3. Die traditionelle Vorratsermittlung | 162 | ||
| 4. Die Ermittlung der theoretischen Vorräte | 163 | ||
| Manfred Neldner, Bochum und Siegen: Die Nachfrage der westdeutschen Banken nach freien Liquiditätsreserven. Alternative Hypothesen und einige empirische Resultate | 173 | ||
| I. Einleitung | 173 | ||
| II. Die freien Liquiditätsreserven der Banken in theoretischer Sicht | 175 | ||
| 1. Der portfolio-theoretische Ansatz | 175 | ||
| 2. Der bedarfs-theoretische Ansatz | 180 | ||
| III. Die Ergebnisse der Schätzungen | 182 | ||
| 1. Die Gesamtperiode im Überblick | 182 | ||
| 2. Die Expansionsphase Januar 1974 bis April 1976 | 187 | ||
| 3. Die Phase relativ hoher Liquidität Oktober 1974 bis März 1977 | 190 | ||
| 4. Die Rolle der Bankkreditnachfrage | 193 | ||
| IV. Schlußfolgerungen | 195 | ||
| Anhang (Symbolverzeichnis) | 197 | ||
| Dietrich Beier/Günter Wölke, Berlin: Das Europäische Währungssystem – beschäftigungs- und geldpolitische Aspekte | 199 | ||
| Zwang zur Restriktionspolitik versus Inflationsimport | 199 | ||
| Trotz allgemeiner Rückkehr zur Stabilitätspolitik Grad der erforderlichen Währungsdisziplin umstritten | 200 | ||
| Ein Kompromiß ohne feste Konturen | 204 | ||
| Der Weg zum Erfolg – eine Gratwanderung | 206 | ||
| III. Die Gleichgewichtsidee und ökonomisches Verhalten: Bewährung und Kritik | 211 | ||
| Klaus Jaeger, Berlin: Wer zahlt was im langfristigen Gleichgewicht? Zur langfristigen Gültigkeit des COASE-Theorems | 213 | ||
| Literatur | 240 | ||
| Horst Georg Koblitz/Heinz Rieter, Bochum: Wirtschaftliches Gleichgewicht – zum ‚Glanz-Verfall‘ der zentralen Konzeption der theoretischen Ökonomie | 243 | ||
| I. Gleichgewichtskonzeption und wirtschaftliches Gleichgewicht | 243 | ||
| II. Die traditionelle Kritik an der Gleichgewichtsökonomik | 247 | ||
| III. Die neue, fundamentale Kritik an der Gleichgewichtsidee: «Ordnung durch Ungleichgewicht» | 257 | ||
| IV. Ausblick auf Konsequenzen für die Wirtschaftstheorie | 264 | ||
| Verzeichnis der zitierten Literatur | 270 | ||
| Klaus-Dieter Jacob, Hagen: Transmission monetärer Impulse und Theorie der relativen Preise: Eine Relativierung | 273 | ||
| Günter Ollenburg, Berlin: Rationalität, Zeit und Unsicherheit: homo oeconomicus versus homo socialis? | 289 | ||
| I. | 289 | ||
| II. | 291 | ||
| III. | 294 | ||
| IV. | 302 | ||
| V. | 307 | ||
| a) Handlungsmaxime: | 308 | ||
| b) Handlungsrationalität: | 308 | ||
| c) Sachlicher Entscheidungshorizont: | 309 | ||
| d) Zeitlicher Entscheidungshorizont: | 310 | ||
| e) Information und Autonomie: | 312 | ||
| VI. | 315 | ||
| VII. | 321 | ||
| VIII. | 327 | ||
| Sigvard Clasen, Pforzheim: Gleichgewicht – ein Zielbegriff der Unternehmensführung | 331 | ||
| 1. Idee des unternehmerischen Gleichgewichts | 332 | ||
| 2. Führungsphilosophische Konkretisierung des Gleichgewichtsgedankens | 334 | ||
| 2.1 Rentabilität | 336 | ||
| 2.2 Marktstellung | 336 | ||
| 2.3 Produktivität | 337 | ||
| 2.4 Produktführerschaft | 337 | ||
| 2.5 Mitarbeiterverhalten, Mitarbeiterförderung | 337 | ||
| 2.6 Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit | 340 | ||
| 3. Gleichgewichtsbelastungen sind eine Dauererscheinung | 342 | ||
| Heinz Langen, Tübingen: Leitlinien einer Theorie der Potentialbilanzen | 345 | ||
| 1. Grundprobleme der Bilanzierung | 345 | ||
| 2. Der betriebswirtschaftliche Potentialbegriff | 348 | ||
| Einige Konsequenzen des Potentialbegriffs | 352 | ||
| 3. Erstes Toleranzprinzip der Bilanzierung: Freiheit der Disposition über Leistungspotentiale | 355 | ||
| 4. Wirtschaftliches Eigentum | 357 | ||
| 5. Eine genetische Bilanzdarstellung | 357 | ||
| 6. Das Potentialmengen-Inventar | 360 | ||
| 7. Zweites Toleranzprinzip: Freiheit der Bewertungswahl – Leitende Gesichtspunkte der Bewertung | 360 | ||
| 8. Potential-Erfolgsbilanz | 362 | ||
| 9. Die Potential-Erfolgsrechnung: die uneingeschränkte Bruttoerfolgsrechnung | 364 | ||
| 10. Einige abschließende Überlegungen | 368 | ||
| IV. Mensch und Arbeit: Ökonomische, soziale und kulturelle Bedingungen | 373 | ||
| Fritz Gründger, Berlin: Die Arbeitsangebotskurve. Ein historisch-theoretischer Diskurs | 375 | ||
| I. Die Fragestellung | 375 | ||
| II. Die Entwicklung einer Diskussion | 377 | ||
| 1. Die Ursprünge (Merkantilisten und Klassiker) | 377 | ||
| 2. Der Anfang (Wilhelm Launhardt) | 378 | ||
| 3. Der Wegbereiter (Alfred Marshall) | 380 | ||
| 4. Begründete Zweifel | 380 | ||
| a) Ragnar Frisch | 381 | ||
| b) Lionel Robbins | 383 | ||
| 5. Die elegante Begründung (John R. Hicks) | 385 | ||
| 6. Ein neues Fundament (Gary S. Becker) | 386 | ||
| III. Der Versuch einer Synthese | 387 | ||
| 1. Die Struktur des Modells | 387 | ||
| 2. Das Beispiel einer Lohnerhöhung | 389 | ||
| 3. Alternative Anwendungen | 392 | ||
| IV. Zur Ausweitung des Beckerschen Ansatzes | 393 | ||
| V. Perspektiven | 394 | ||
| Literatur | 395 | ||
| Gerhard Zeitel, Mannheim: Besteuerung und Arbeitszeit | 399 | ||
| I. | 399 | ||
| II. | 400 | ||
| III. | 405 | ||
| Wilhelm Wedig, Berlin: Die Vermögensbildung der Arbeitnehmer und ihre Wirkung auf die Beschäftigungssituation | 415 | ||
| I | 145 | ||
| II | 416 | ||
| III | 418 | ||
| IV | 422 | ||
| V. | 427 | ||
| Jürgen Zerche, Köln: Alternative oder ergänzende Strategien zur Vermögensverteilungspolitik: Mitbestimmung, Soziale Sicherung und Bildungspolitik | 431 | ||
| 1. Einführung in den Problembereich | 431 | ||
| 2. Mitbestimmungspolitik | 433 | ||
| 2.1. Mitbestimmung und Machtkontrolle | 433 | ||
| 2.2. Die Montan-Mitbestimmung | 434 | ||
| 2.3. Das Betriebsverfassungsgesetz von 1972 | 435 | ||
| 2.4. Das Mitbestimmungsgesetz von 1976 | 435 | ||
| 2.5. Kritische Würdigung | 436 | ||
| 3. Soziale Sicherung als Eigentumsersatz | 437 | ||
| 3.1. Die gewandelte Stellung von Eigentum und Sozialeinkommen | 437 | ||
| 3.2. Das Grundprinzip der sozialen Sicherung | 439 | ||
| 3.3. Leistungen der Sozialversicherung | 440 | ||
| 3.4. Das Sozialversicherungs „sparen“ | 442 | ||
| 4. Bildungspolitik und Verteilungspolitik | 443 | ||
| Erich Klinkmüller, Berlin: Die Nachfrage nach Krankenversorgungsgütern. Welche Gründe veranlassen die privaten Haushalte, von der Krankenversorgungsindustrie angebotene Güter nachzufragen? | 447 | ||
| Gliederung | 447 | ||
| I. | 447 | ||
| II. | 449 | ||
| III. | 451 | ||
| IV. | 454 | ||
| V. | 458 | ||
| Michael Bohnet, Bonn: Einkommensverteilung in Entwicklungsländern | 461 | ||
| 1. Darstellung und Interpretation der Daten zur Einkommensverteilung in Entwicklungsländern | 462 | ||
| 1.1. Die Messung der Einkommenskonzentration | 462 | ||
| 1.2. Darstellung der Daten zur Einkommensverteilung in Entwicklungsländern | 462 | ||
| 1.3. Interpretation der Einkommensverteilungsdaten | 473 | ||
| 2. Die Beziehungen zwischen Einkommensverteilung und sozio-ökonomischer Entwicklung | 477 | ||
| 2.1. Die Adelman/Morris-Studie | 477 | ||
| a) Erklärungsfaktoren für die Einkommensanteile der unteren 60 % der Einkommensbezieher | 481 | ||
| b) Erklärungsfaktoren für die Einkommensanteile der oberen 5 % der Einkommensbezieher | 481 | ||
| c) Erklärungsfaktoren für die Einkommensanteile der „Mittelklasse“ (40–60 %) | 481 | ||
| d) Zusammenstellung der wichtigsten Erklärungsfaktoren für die Einkommensverteilung | 481 | ||
| 2.2. Die Weltbankstudie | 482 | ||
| 2.3. Die Zusammenhänge zwischen Wachstum und Einkommensverteilung am Beispiel ausgewählter Entwicklungsländer | 484 | ||
| 2.3.1. Sri Lanka | 485 | ||
| 2.3.2. Kenia | 485 | ||
| 2.3.3. Brasilien | 486 | ||
| 2.3.4. VR China | 486 | ||
| 2.3.5. Kuba | 487 | ||
| 3. Entwicklungspolitische Schlußfolgerungen | 488 | ||
| 3.1. Maßnahmenkatalog zur Erreichung einer gerechteren Einkommensverteilung | 488 | ||
| 3.2. Berücksichtigung der Verteilungskomponente bei der Planung deutscher Entwicklungshilfeprojekte | 488 | ||
| 3.2.1. Der „naive“ und „detaillierte“ Weltbankansatz | 488 | ||
| 3.2.2. Die verteilungsorientierte Prüfung von Entwicklungshilfeprojekten | 491 | ||
| Gesamtprüfung des Projektes | 491 | ||
| Werner Jung, Berlin: Kritisches zur Kulturkritik | 495 | ||
| Bibliographie Andreas Paulsen | 513 | ||
| Bücher | 513 | ||
| Beiträge zu Sammelwerken | 514 | ||
| Aufsätze in Zeitschriften | 514 | ||
| Mitherausgeberschaft | 516 | ||
| Eine Kadenz zur wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnis | 517 | ||
| Verzeichnis der Mitarbeiter | 519 |
