Wirtschaftspolitik in weltoffener Wirtschaft
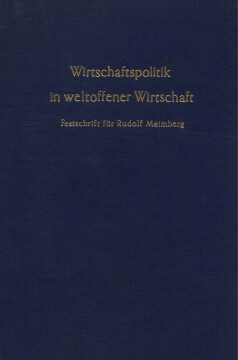
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Wirtschaftspolitik in weltoffener Wirtschaft
Festschrift zum siebzigsten Geburtstag von Rudolf Meimberg
Editors: Feldsieper, Manfred | Groß, Richard
(1983)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Rudolf Meimberg zum 70. Geburtstag | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Währungs- und Geldpolitik in weltoffener Wirtschaft | 13 | ||
| Klaus Rose/Karlhans Sauernheimer: Zur Theorie eines „Mischwechselkurssystems“ | 15 | ||
| A. Einleitung | 15 | ||
| B. Das Modell | 16 | ||
| C. Eine geometrische Darstellung | 17 | ||
| D. Datenänderungen | 19 | ||
| I. Fiskalpolitik | 19 | ||
| II. Geldpolitik | 21 | ||
| III. Steigende Drittlandeinkommen | 22 | ||
| IV. Steigende Drittlandzinsen | 23 | ||
| V. Adaptive Erwartungen | 24 | ||
| E. Vorläufige Zusammenfassung und Kritik | 25 | ||
| F. Flexible Preise | 26 | ||
| G. Geldpolitische Autonomie | 27 | ||
| Literaturhinweise | 28 | ||
| Dieter Bender: Nettoinvestition, Lohnbildung und Beschäftigung bei flexiblen Wechselkursen | 29 | ||
| A. Problemstellung | 29 | ||
| B. Nettoinvestition, Produktionspotential und Beschäftigung | 30 | ||
| C. Wechselkurs, Arbeitsmarkt und Beschäftigung | 32 | ||
| I. Nominallohnstarrheit | 33 | ||
| II. Nominallohnbeweglichkeit | 34 | ||
| D. Lohn- und Beschäftigungswirkungen der Nettoinvestition in einer kleinen offenen Volkswirtschaft | 38 | ||
| I. Nettoinvestition, Wechselkurs und Beschäftigung bei starrem Nominallohn | 40 | ||
| II. Nettoinvestition, Wechselkurs und Beschäftigung bei beweglichem Nominallohn | 41 | ||
| E. Zusammenfassung und wirtschaftliche Implikationen der Ergebnisse | 44 | ||
| Literaturhinweise | 45 | ||
| Manfred Feldsieper: Zum Begriff und zur Messung der realen Bewertung einer Währung | 47 | ||
| A. Zum Begriff der realen Bewertung einer Währung | 47 | ||
| B. Zur Messung der realen Bewertung einer Währung | 50 | ||
| I. Die Wahl der geeigneten korrelaten Indikatoren | 50 | ||
| II. Die Wahl des geeigneten Gewichtungsverfahrense | 52 | ||
| 1. Bilaterales Gewichtungsverfahren | 54 | ||
| 2. Globales Gewichtungsverfahren | 55 | ||
| 3. Doppelgewichtung | 56 | ||
| III. Empirische Ergebnisse zur realen Bewertung der D-Mark | 58 | ||
| C. Zusammenfassende Beurteilung | 63 | ||
| Literaturhinweise | 64 | ||
| Herbert H. Jacobi: Außenwirtschaftliche Einflüsse auf die nationale Wirtschaftspolitik – und einige Konsequenzen für das Bankgeschäft | 65 | ||
| A. Die Bundesrepublik Deutschland als weltoffener Wirtschaftsraum | 65 | ||
| I. Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik – das Dimensionierungsproblem | 67 | ||
| 1. Außenwirtschaftliche Grenzen für die Geldpolitik | 68 | ||
| 2. Der internationale Zinszusammenhang als limitierender Faktor | 70 | ||
| 3. Spezielle Probleme aus der Reservewährungsfunktion | 71 | ||
| III. Auswirkungen auf das Bankgeschäft | 72 | ||
| IV. Außenwirtschaftliche Probleme auch für die Strukturpolitik | 74 | ||
| V. Nochmals: Auswirkungen auf das Bankgeschäft | 75 | ||
| VI. Außenwirtschaftliche Grenzen für die Handelspolitik | 76 | ||
| VII. Ein drittes Mal: Auswirkungen auf das Bankgeschäft | 79 | ||
| B. Die Interdependenz zwischen Wirtschaftspolitik und Bankgeschäft | 80 | ||
| Werner Becker: Die Neuorientierung bei der Offenmarktpolitik der Bundesbank | 83 | ||
| Literaturhinweise | 95 | ||
| Michael E. Coridaß: Wohnungsbaukredit und europäische Integration. Bausparkassen zwischen nationalem Markt und grenzüberschreitender Tätigkeit | 97 | ||
| A. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit | 97 | ||
| I. Zielsetzung des EWG-Vertrages | 97 | ||
| II. Bausparsysteme in Europa | 101 | ||
| III. Restriktionen der nationalen Gesetzgebung | 104 | ||
| IV. Ökonomische Probleme | 104 | ||
| B. Ansätze zur Harmonisierung des Wohnungsbaukredits | 105 | ||
| I. Allgemeine Bankrechtskoordinierung | 105 | ||
| II. Spezialregelungen für den Wohnungsbaukredit | 106 | ||
| C. Möglichkeiten und Chancen eines liberalisierten Bausparmarktes | 106 | ||
| Literaturhinweise | 109 | ||
| Brigitte Hewel: Indexklauseln am Kapitalmarkt – ein Beitrag zur Geldwertstabilisierung? | 111 | ||
| A. Das Problem | 111 | ||
| B. Indexklauseln und Zinsniveau | 113 | ||
| C. Angebots- und Nachfragewirkungen von Indexklauseln | 117 | ||
| D. Indexklauseln und Stabilisierungspolitik | 120 | ||
| Literaturhinweise | 122 | ||
| Außenhandel und Politik | 123 | ||
| Francesca Schinzinger: Die Rolle der Zölle in den Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und seinen Kolonien | 125 | ||
| A. Einleitung | 125 | ||
| B. Außenhandel und Zölle zwischen dem Deutschen Reich und seinen Kolonien | 125 | ||
| I. Rechtliche Grundlagen | 125 | ||
| II. Zölle in den Kolonien | 126 | ||
| a) Ausfuhrzölle | 126 | ||
| b) Einfuhrzölle | 127 | ||
| III. Zölle des Deutschen Reiches gegenüber den deutschen Kolonien | 127 | ||
| IV. Warenimport und -export | 128 | ||
| a) Probleme der Handelsstatistik | 128 | ||
| b) Export der Kolonien in das Deutsche Reich | 129 | ||
| c) Exporte des Deutschen Reiches in die Kolonien | 130 | ||
| C. Zölle als Instrumente der Kolonialpolitik – Probleme aus der Sicht des Deutschen Reiches und der Kolonien | 134 | ||
| I. Zölle als Hindernis für die Beziehungen zwischen Mutterland und Kolonien | 134 | ||
| II. Zölle und ihre Wirkungen auf die Haushalte der Kolonien und des Deutschen Reiches | 139 | ||
| a) Zölle als Einnahmequellen der Kolonien | 139 | ||
| b) Kolonien und Reichszuschüsse | 140 | ||
| D. Schlußbemerkungen | 141 | ||
| Literaturhinweise | 142 | ||
| Werner Zohlnhöfer: Zur politischen Ökonomie des neuen Protektionismus. Ein Beitrag zur Theorie der Außenwirtschaft in der Demokratie | 143 | ||
| A. Das Phänomen des neuen Protektionismus | 144 | ||
| B. Zum Stand der relevanten Theorie | 145 | ||
| C. Anpassungshemmnisse als Ursachen protektionistischer Forderungen | 148 | ||
| I. Determinanten des Anpassungsbedarfs | 148 | ||
| II. Voraussetzungen marktwirtschaftlicher Anpassung und die Bedingungen der Wirtschaftswirklichkeit | 150 | ||
| D. Zur politischen Durchsetzbarkeit protektionistischer Forderungen bei demokratischer Willensbildung | 152 | ||
| I. Grundsätzliches zur Handelspolitik in der Demokratie | 152 | ||
| II. Liberalisierungschancen bei Wachstum und Vollbeschäftigung | 157 | ||
| III. Neuer Protektionismus und Wachstumsschwäche | 158 | ||
| E. Überwindung oder Wachstum des Protektionismus? | 162 | ||
| Literaturhinweise | 163 | ||
| Walter Paul: Internationale Abkommen über Mindestzinsen und Höchstlaufzeiten in der staatlich unterstützten Exportfinanzierung | 165 | ||
| A. Die Ausgangslage | 165 | ||
| B. Wesentliche Aspekte der Absprachen und der Entwicklung seither | 167 | ||
| C. Künftig marktnähere Finanzierungsangebote für Exportgeschäfte? | 171 | ||
| D. Ist ein voller Subventionsabbau realistisch? | 174 | ||
| Literaturhinweise | 177 | ||
| Reinhard Rasch: Probleme im internationalen Geschäft – dargestellt am Beispiel der Hoechst Aktiengesellschaft | 179 | ||
| A. Die Bedeutung des internationalen Geschäfts der Hoechst AG | 179 | ||
| B. Die Entwicklung der Auslandsorganisation | 180 | ||
| C. Zur Frage der Höhe der Beteiligung an Auslandsgesellschaften | 180 | ||
| D. Aspekte der regionalen Verteilung der Auslandsaktivitäten – Industrie-/Entwicklungsländer | 181 | ||
| E. Kategorisierung der Auslandsgesellschaften nach ihrem Entwicklungsstand | 183 | ||
| F. Aufgaben und Organisation der Auslandsgesellschaften | 184 | ||
| G. Zusammenarbeit zwischen der Mutter und der ausländischen Beteiligungsgesellschaft | 184 | ||
| I. Ergebnisverantwortung | 184 | ||
| II. Investitionen in Sachanlagen im Ausland | 185 | ||
| III. Finanzierung | 186 | ||
| IV. Rohstoffversorgung | 187 | ||
| V. Transferpreise | 187 | ||
| VI. Exporte der Auslandsgesellschaften | 188 | ||
| VII. Personaldisposition | 180 | ||
| H. Ausblick | 180 | ||
| Gerhard Schmitt-Rink: Inter- versus intra-industrieller Handel: Ein Vergleich von Meßkonzepten | 182 | ||
| Literaturhinweise | 198 | ||
| Weltwirtschaftliche Integration und Entwicklungsländer | 201 | ||
| Harald Winkel: Zur Übertragbarkeit des Industrialisierungsprozesses: Ein historischer Vergleich England–Kontinentaleuropa–Entwicklungsländer | 203 | ||
| Literaturhinweise | 219 | ||
| Karl Georg Zinn: Eurozentrismus und Dritte Welt | 221 | ||
| A. Die ideologischen Folgen der Befreiung außereuropäischer Länder | 221 | ||
| B. Der Eurozentrismus in der ökonomischen Theorie | 224 | ||
| C. Erkenntnisdefizite bewirken Fehlentscheidungen | 228 | ||
| D. Das eurozentristische Moment in der Technik | 230 | ||
| E. Der Widerspruch liegt in den Dingen | 233 | ||
| Literaturhinweise | 240 | ||
| Hans-Rimbert Hemmer: Binnenwirtschaftliche Ursachen des Kapitalmangels in Entwicklungsländern | 243 | ||
| A. Kreislauftheoretische Grundlagen der Kapitalbildung | 243 | ||
| B. Kapitalmangel als Folge einer unzureichenden Ersparnisbildung | 246 | ||
| I. Kapitalmangel als Folge einer unzureichenden Sparfähigkeit | 246 | ||
| II. Kapitalmangel als Folge einer unzureichenden Sparbereitschaft | 247 | ||
| C. Kapitalmangel als Folge unzureichender produktiver Investitionen | 250 | ||
| I. Kapitalmangel als Folge einer unzureichenden Investitionsfähigkeit | 251 | ||
| II. Kapitalmangel als Folge einer unzureichenden Investitionsbereitschaft | 252 | ||
| D. Kapitalmangel als Folge institutioneller Hemmnisse | 252 | ||
| E. Investitionsabhängige Kapitalbildung versus produktiver Konsum | 255 | ||
| F. Fazit | 256 | ||
| Literaturhinweise | 257 | ||
| Fathy Batah: Zur Problematik soziokultureller Beeinflussung der Enwicklung im ländlichen Raum. Erörtert am Beispiel eines Selbsthilfeprojektes der Friedrich-Naumann-Stiftung in Ismailiya/Ägypten | 259 | ||
| Arbeitsmarktprobleme bei gebremstem Wachstum | 267 | ||
| Wolfgang Hielscher: Berufliche Qualifikation und wirtschaftlicher Strukturwandel | 269 | ||
| A. Beziehungen zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem | 269 | ||
| B. Generelle Entwicklung der Qualifikationsanforderungen | 273 | ||
| C. Veränderung der Berufsstrukturen | 277 | ||
| D. Einfluß neuer Technologien auf die Qualifikationsanforderungen | 278 | ||
| E. Struktur der Bildungsabschlüsse | 279 | ||
| F. Berufswechsel und berufliche Flexibilität | 282 | ||
| G. Bildungspolitische Schlußfolgerungen | 285 | ||
| Literaturhinweise | 286 | ||
| Richard Groß: Teilzeitbeschäftigung und Arbeitslosigkeit | 289 | ||
| A. Teilzeitarbeit: Rezept für alle Gelegenheiten? | 289 | ||
| B. Begleiterscheinungen steigender Frauenerwerbstätigkeit | 290 | ||
| C. Für flexiblere Arbeitszeitformen | 293 | ||
| D. Zur Teilbarkeit von Arbeitsplätzen | 294 | ||
| E. Teilzeitarbeit in der betrieblichen Praxis | 296 | ||
| 1. Beschäftigungserfolg des Modellversuchs | 298 | ||
| 2. Teilzeitarbeit im Urteil der Teilzeitbeschäftigten | 298 | ||
| 3. Zusatzkosten und Zusatznutzen der Teilzeitbeschäftigung | 299 | ||
| 4. Beurteilung durch Vorgesetzte, Unternehmensleitungen und Betriebsräte | 301 | ||
| 5. Folgerungen aus dem Modellversuch | 303 | ||
| F. Zur weiteren Entwicklung der Teilzeitarbeit | 304 | ||
| Literaturhinweise | 306 | ||
| Hubert Klein/Jürgen Schröder: Risikotausch und Versicherung am Arbeitsmarkt – Einige Bemerkungen zur Kontrakttheorie | 307 | ||
| A. Die Kontrakttheorie als neuere Entwicklung der Arbeitsmarkttheorie | 307 | ||
| I. Die Trennung in mikroökonomische „klassische“ und makroökonomische „keynesianische“ Modelle des Arbeitsmarktes | 307 | ||
| II. Die Kontrakttheorie als Ergebnis der Bemühungen um eine Integration von klassischen und keynesianischen Arbeitsmarktmodellen | 309 | ||
| B. Der Risikotausch auf dem Arbeitsmarkt als zentrales Kennzeichen der Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 312 | ||
| I. Der Risikotauschgedanke bei Knight | 312 | ||
| II. Der optimale Risikotausch auf Märkten: allgemeine Darstellung | 313 | ||
| III. Die Ergebnisse optimalen Risikotauschs in einem einfachen kontrakttheoretischen Arbeitsmarktmodell | 316 | ||
| C. Die Interpretation der Risikoaustauschbeziehung auf dem Arbeitsmarkt als Versicherung | 320 | ||
| I. Begriff und Kennzeichen eines Versicherungsverhältnisses | 320 | ||
| II. Die kontrakttheoretische Behandlung des Risikotauschs auf dem Arbeitsmarkt und dessen Versicherungseigenschaft | 321 | ||
| Literaturhinweise | 323 | ||
| Hartwig Bartling: Wettbewerbliche Ausnahmebereiche – Rechtfertigungen und Identifizierung | 325 | ||
| A. Problemstellung | 325 | ||
| B. Ursachen für wettbewerbliche Ausnahmebereiche | 326 | ||
| I. Scheinprobleme | 326 | ||
| 1. Eindimensionalität der Verrechnungseinheit „Geld“ | 326 | ||
| 2. Fehlende Wettbewerbsgesinnung | 327 | ||
| II. Relevante, aber nicht hinreichende Bedingungsfaktoren | 328 | ||
| 1. Nichtrivalität beim Konsum bzw. Grenzkosten von Null | 328 | ||
| 2. Korrekturbedürftiges Nachfrageverhalten | 329 | ||
| 3. Zielkonflikte zwischen Allokationseffizienz und anderen Zielen wie egalitäre Verteilung oder Kleingewerbeschutz | 330 | ||
| 4. Externe Effekte bei möglichem Ausschlußprinzip | 330 | ||
| III. Wettbewerbspathologische Faktoren | 332 | ||
| 1. Fehlendes Ausschlußprinzip | 332 | ||
| 2. Inverses Angebotsverhalten mit der Folge labiler Marktgleichgewichte | 333 | ||
| 3. Wettbewerbszerstörende Economies of Scale | 334 | ||
| 4. Hohe Marktaustrittsschranken in Verbindung mit chronischen Überkapazitäten | 335 | ||
| C. Verfahrensvorschläge für Schaffung und Abbau wettbewerblicher Ausnahmebereiche | 337 | ||
| I. Bezug zur bisherigen Wettbewerbspolitik | 337 | ||
| II. Institutionelle Lösung | 342 | ||
| Literaturhinweise | 345 | ||
| Klaus Mackscheidt: Die Anerkennung von Familienleistungen im Rentenrecht und ihre Finanzierungsmöglichkeiten | 347 | ||
| A. Diskutierte Modelle für die Anerkennung von Familienleistungen | 347 | ||
| I. Drei grundsätzliche Varianten | 347 | ||
| II: Modell I: Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung für die Kindererziehung | 347 | ||
| III. Modell II: Erziehungsgelder | 347 | ||
| IV. Modell III: Erziehungsgelder und Beitragszeiten | 347 | ||
| B. Der Finanzierungsbedarf | 348 | ||
| C. Finanzierungsquellen außerhalb der Rentenversicherung | 350 | ||
| I. Zur Ablehnung einer rentenversicherungsinternen Finanzierung | 350 | ||
| II. Finanzierung aus externen Ressorts | 351 | ||
| III. Die partielle Umwidmung des Splitting-Vorteils bei der Einkommensteuer | 351 | ||
| Literaturhinweise | 361 | ||
| Anhang | 363 | ||
| Verzeichnis der wichtigsten Veröffentlichungen von Rudolf Meimberg | 365 | ||
| Zusammengestellt von Johannes Kleinz | 365 | ||
| A. Bücher und Broschüren | 365 | ||
| B. Beiträge in Sammelwerken | 366 | ||
| C. Aufsätze | 366 | ||
| Biographische Daten | 368 | ||
| Mitarbeiterverzeichnis | 369 |
