Der Streitgegenstand im Steuerprozeß
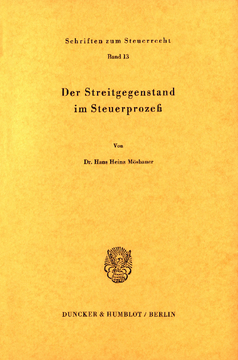
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der Streitgegenstand im Steuerprozeß
Schriften zum Steuerrecht, Vol. 13
(1975)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Seit dem Erscheinen des ersten Bandes im Jahre 1965 hat sich die älteste lebende Schriftenreihe auf dem Gebiet des Steuerrechts ein hohes Ansehen erworben. Prominente Universitätsprofessoren und Steuerpraktiker haben ihre frühen Arbeiten (insb. Dissertationen) mit wegweisenden Erkenntnissen in den »Schriften zum Steuerrecht« veröffentlicht.Steuerrechtswissenschaft ist eine in hohem Maße praktische Wissenschaft. Während sich die Steuergesetzgebung im Widerstreit fiskalischer und privater Interessen immer weiter von einer Ordnung des Rechts entfernt, begegnet die Rechtswissenschaft stets neuen Herausforderungen, das Steuerrecht dogmatisch zu strukturieren und für die Steuerpraxis handhabbar zu machen. Dazu leisten die »Schriften zum Steuerrecht« einen wichtigen Beitrag.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Einleitung | 1 | ||
| § 1 Rechtfertigung der Untersuchung | 1 | ||
| I. Die Erforschung des Streitgegenstandsproblems als Hauptaufgabe der Steuerprozeßrechtswissenschaft | 1 | ||
| 1. Die zentrale Bedeutung des Streitgegenstandsproblems | 1 | ||
| 2. Das wachsende Interesse an den dem allgemeinen materiellen und prozessualen Steuerrecht immanenten Zentralproblemen | 3 | ||
| a) Der Wandel des wissenschaftlichen Interesses | 3 | ||
| b) Die Überwindung der verabsolutierten Eigenständigkeit | 4 | ||
| c) Die Aufgabe der „in dubio pro fisco“ – Interessenjurisprudenz | 5 | ||
| d) Die dogmatische Öffnung zum Privatrecht | 5 | ||
| e) Das Neuverständnis des Verhältnisses zwischen Steuergläubiger und Steuerschuldner | 6 | ||
| f) Die Integration des Steuerrechts in das System der Gesamtrechtsordnung | 8 | ||
| 3. Die Orientierung des allgemeinen Steuerrechts am allgemeinen Verwaltungsrecht | 8 | ||
| a) Die steuerrechtliche Orientierungstendenz | 8 | ||
| b) Die Überführung der „Steuergerichtsbarkeit“ in ein echtes Gerichtsverfahren | 9 | ||
| c) Der Ursprung der Entwicklung | 10 | ||
| d) Die Rückbesinnung auf die Idee der Einheit der Rechtsordnung | 11 | ||
| 4. Die wachsende Aktualität des Streitgegenstandsproblems | 11 | ||
| a) Die Verpflichtung zu gesteigertem wissenschaftlichem Interesse | 11 | ||
| b) Die Typisierung der Verwaltungstätigkeit | 12 | ||
| c) Die Funktionserweiterung des Steuerrechts | 12 | ||
| d) Der Wandel der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse | 13 | ||
| e) Die Frage nach dem Prozeßverhalten des Klägers | 14 | ||
| Erster Teil: Die Bedeutung des Streitgegenstandes | 16 | ||
| § 2 Die Bedeutung des Streitgegenstandes für die Rechtspraxis | 16 | ||
| I. Der Streitgegenstand als ein dem gesamten Prozeßrecht eigentümlicher Begriff | 16 | ||
| 1. Die Finanzgerichtsbarkeit als funktionelle Rechtsschutzeinrichtung | 16 | ||
| 2. Die „Mehrdeutigkeit“ des Begriffs Streitgegenstand | 16 | ||
| a) nach der ZPO und VwGO | 17 | ||
| b) nach der FGO | 17 | ||
| II. Der Streitgegenstand als Voraussetzung zur Erreichung eines Höchstmaßes an Rechtsschutz | 18 | ||
| 1. Das Rechtsschutzproblem | 18 | ||
| a) Der Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung | 19 | ||
| b) Die Geordnetheit des Steuerverfahrens | 19 | ||
| c) Der Steuerprozeß als spezieller Rechtsschutz | 20 | ||
| III. Der Streitgegenstand als Voraussetzung zur Erreichung eines Mindestmaßes an Rechtssicherheit | 23 | ||
| 1. Die Begriffsunsicherheit und das rechtsstaatliche Postulat der Rechtssicherheit | 23 | ||
| 2. Rechtssicherheit und Vertrauensschutz | 25 | ||
| 3. Vertrauensschutz und Rechtsfriede | 27 | ||
| IV. Der Streitgegenstand als stabilisierendes Element der Rechtsprechung des BFH | 27 | ||
| 1. Der Wert der Stetigkeit höchstrichterlicher Rechtsprechung | 27 | ||
| 2. Die Begriffsunsicherheit als Widerspruch des verfassungsrechtlichen Dreigestirns Rechtssicherheit, Gleichbehandlung und Vertrauensschutz | 29 | ||
| V. Der Streitgegenstand als Mindestinhalt der finanzgerichtlichen Klage | 31 | ||
| 1. Dispositionsbefugnis und Streitgegenstand | 31 | ||
| 2. Klagebegehren und Rechtsschutzanspruch | 32 | ||
| VI. Der Streitgegenstand als Mittelpunkt des finanzgerichtlichen Verfahrens | 35 | ||
| 1. Das erstrebte Klageziel | 35 | ||
| 2. Die Bindung an das Klagebegehren | 36 | ||
| VII. Der Streitgegenstand als Grundlage für eine Reihe prozeßrechtlicher Institute | 36 | ||
| a) der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit des Gerichts | 36 | ||
| b) des Klagebegehrens | 36 | ||
| c) der Rechtshängigkeit der Streitsache | 36 | ||
| d) der objektiven Klagenhäufung | 36 | ||
| e) der Klageänderung | 36 | ||
| f) der teilweisen Zurücknahme der Klage | 36 | ||
| g) der Erforschung des Sachverhalts durch das Gericht | 37 | ||
| h) der Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache | 37 | ||
| i) der Vorabentscheidung über den Grund | 37 | ||
| k) der Bindung der Finanzbehörden an die rechtliche Beurteilung | 37 | ||
| l) des Teilurteils | 37 | ||
| m) der materiellen Rechtskraft | 37 | ||
| n) der einstweiligen Anordnung sowie | 37 | ||
| o) der Revision | 37 | ||
| VIII. Die prozeßrechtlichen Institute im einzelnen | 37 | ||
| IX. Der Streitgegenstand als Mittel zur Konkretisierung von Aktionen steuerpolitischer Gruppen- und Einzelinteressen | 38 | ||
| 1. Die fiskalische Funktion der Steuer | 38 | ||
| 2. Die ökonomische und sozialpolitische Funktion der Steuer | 38 | ||
| 3. Das Steuerrecht als Instrumentarium der Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik | 40 | ||
| § 3 Wesensmerkmale der verschiedenen Auffassungen | 41 | ||
| I. Die FGO und das Wesen des Steuerprozesses als Ausgangspunkte der Untersuchungen | 41 | ||
| 1. Der Streitgegenstand als der dem Gericht zur Entscheidung unterbreitete Sachverhalt | 41 | ||
| 2. Der Streitgegenstand als Rechtsbehauptung des Klägers | 42 | ||
| II. Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit den in der modernen Prozeßrechtswissenschaft vertretenen Haupttheorien | 42 | ||
| § 4 Der Weg zur Lösung des Problems | 43 | ||
| I. Der Streitgegenstand nach der ZPO, dem FGG, der StPO und der VwGO | 43 | ||
| II. Die Würdigung der bisherigen Lösungsversuche | 44 | ||
| III. Das eigene Verständnis des Streitgegenstandes im Steuerprozeß | 45 | ||
| Zweiter Teil: Der Streitgegenstand in den verschiedenen Gerichtszweigen | 46 | ||
| § 5 Der Streitgegenstand in den verschiedenen Gerichtszweigen | 46 | ||
| I. Bedeutung des prozessualen Begriffs | 46 | ||
| II. Rechtfertigung der vergleichenden und wertenden Darstellung | 47 | ||
| III. Der Wert synoptischer Darstellung | 48 | ||
| Einzeldarstellung | 50 | ||
| § 6 Der Streitgegenstand im Zivilprozeß – Darstellung und Wertung | 50 | ||
| I. Allgemeines | 50 | ||
| 1. Zur Bedeutung des Streitgegenstandes | 50 | ||
| 2. Ziel der Darstellung | 52 | ||
| II. Die ursprünglichen materiellrechtlichen Theorien | 53 | ||
| 1. Die Anspruchslehre | 53 | ||
| a) Die Identität von materiellrechtlichem Anspruch und Streitgegenstand | 53 | ||
| b) Die monistische Auffassung als Quelle der Anspruchslehre | 53 | ||
| c) Der materielle Anspruchsbegriff als Bestandteil der Rechtswissenschaft | 53 | ||
| d) Die modifizierte Anspruchslehre | 54 | ||
| 2. Die Ansicht von Bettermann | 55 | ||
| a) Der Streitgegenstand – der Aufhebungsklage – als das einzelne Aufhebungsrecht | 55 | ||
| b) Die Identität von Streitgegenstand und Gestaltungsrecht | 56 | ||
| c) Die Verbindung von Prozeß und materiellem Recht | 56 | ||
| 3. Die Theorie vom „Anspruch und Klagerecht“ | 56 | ||
| a) Die Einheit von Klagerecht und materiellem Recht | 56 | ||
| b) Die Klagebefugnis als Ausfluß des materiellen Rechts | 57 | ||
| c) Das Klagerecht als eine Kategorie des Bürgerlichen Rechts | 57 | ||
| d) Die These vom privatrechtlichen relativen Hilfsrecht auf Rechtsgestaltung | 57 | ||
| 4. Zusammenfassung und Kritik | 58 | ||
| III. Die prozessualen Theorien | 60 | ||
| 1. Die Lehre vom Rechtsschutzanspruch | 60 | ||
| a) Der Streitgegenstand als Rechtsschutzanspruch | 60 | ||
| b) Die dualistische Betrachtungsweise von materieller Rechtsordnung und Rechtsschutzordnung | 60 | ||
| c) Die Bedeutung der Lehre | 60 | ||
| 2. Die Lehre vom „Sachverhalt und Antrag als bestimmenden Elementen des Anspruchs“ | 61 | ||
| a) Der Streitgegenstand als Gebilde der prozessual gleichwertigen Faktoren Antrag und Sachverhalt | 61 | ||
| b) Der Streitgegenstand als Begehren des Klägers | 62 | ||
| c) Die prozessuale Natur des Streitgegenstandes | 62 | ||
| d) Der Streitgegenstand als Rechtsbehauptung | 63 | ||
| e) Die Bedeutung der Lehre | 64 | ||
| f) Die Kritik an der Lehre | 65 | ||
| 3. Der Antrag als bestimmendes Element des Streitgegenstandes | 65 | ||
| a) Der rein prozessuale Begriff des Streitgegenstandes | 65 | ||
| b) Die überragende Bedeutung des Antrags | 66 | ||
| c) Der Streitgegenstand als das Begehren auf die im Klageantrag bezeichnete Entscheidung | 67 | ||
| d) Der Streitgegenstand als entscheidungsfähige Rechtsbehauptung | 67 | ||
| e) Der Streitgegenstand als das Begehren der im Klageantrag bezeichneten Entscheidung | 68 | ||
| f) Der Streitgegenstand als das auf Grund eines bestimmten Sachverhalts erhobene Klagebegehren | 68 | ||
| g) Die Bedeutung der Lehre | 70 | ||
| h) Die Lehre als die heute herrschende Auffassung | 71 | ||
| IV. Die vermittelnden Theorien | 71 | ||
| 1. Allgemeines | 71 | ||
| 2. Der Streitgegenstand als die an Tatbestände des materiellen Rechts gebundene Rechtsbehauptung | 71 | ||
| 3. Der Streitgegenstand als ein konkret behauptetes Recht | 72 | ||
| V. Die neuen materiell-rechtlichen Theorien | 73 | ||
| § 7 Der Gegenstand des Streitverfahrens der Freiwilligen Gerichtsbarkeit – Darstellung und Wertung | 74 | ||
| I. Allgemeines | 74 | ||
| 1. Die echten Streitsachen | 74 | ||
| a) Der Rechtsstreit um subjektive Privatrechte | 74 | ||
| II. Der Gegenstand des Streitverfahrens | 77 | ||
| 1. Allgemeines | 77 | ||
| a) Die Frage nach der Existenz „echter Streitsachen“ | 77 | ||
| 2. Der Verfahrensgegenstand als die Rechtsbehauptung des Antragstellers | 77 | ||
| a) Die Ansicht von Habscheid | 77 | ||
| b) Der Verfahrensgegenstand und seine Erkenntnisquelle | 78 | ||
| c) Verfahrensbehauptung und Rechtsfolgenbehauptung als Faktoren der Rechtsbehauptung | 78 | ||
| d) Die Funktion des Verfahrens der Freiwilligen Gerichtsbarkeit | 78 | ||
| e) Die Bedeutung der Ansicht | 79 | ||
| § 8 Der „Streitgegenstand“ im Strafprozeß | 79 | ||
| I. Wesen und Aufgabe des Strafprozesses | 79 | ||
| II. Der „Strafanspruch“ als Gegenstand des Verfahrens | 80 | ||
| § 9 Der Streitgegenstand im Verwaltungsgerichtsprozeß – Darstellung und Wertung | 82 | ||
| I. Die veränderten Grundlagen des Verwaltungsrechts-Systems | 82 | ||
| 1. Allgemeines | 82 | ||
| 2. Die neue Rechtssituation | 83 | ||
| a) Die Erweiterung des Rechtsschutzes | 83 | ||
| b) Der absolutistische Charakter der Verwaltung | 84 | ||
| c) Die Ersetzung des Exklusivcharakters des subjektiv öffentlichen Rechts | 84 | ||
| 3. Der Zivilprozeß als Orientierungsdatum | 85 | ||
| II. Die Streitgegenstands-Theorien | 86 | ||
| 1. Allgemeines | 86 | ||
| 2. Der Streitgegenstand als die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes | 87 | ||
| a) Das Wesen der Lehre | 87 | ||
| b) Der Streitgegenstand als der angefochtene Verwaltungsakt und seine Gesetzlichkeit | 87 | ||
| 3. Der Streitgegenstand als das subjektive Recht auf Aufhebung eines Verwaltungsaktes | 91 | ||
| a) Das Wesen der Lehre | 91 | ||
| b) Die Identität des Streitgegenstandes mit dem Objekt der Rechtskraft | 91 | ||
| c) Die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes als Bestandteil des Streitgegenstandes | 94 | ||
| d) Der Streitgegenstand als Anspruch auf Aufhebung des angefochtenen Verwaltungsaktes | 94 | ||
| 4. Der Streitgegenstand als die Rechtsbehauptung oder das Rechtsbegehren des Klägers | 95 | ||
| a) Das Wesen der Lehre | 95 | ||
| b) Der Streitgegenstand als prozessualer Anspruch | 97 | ||
| c) Der Streitgegenstand als die (Rechtsfolge-) Behauptung der Rechtsverletzung | 99 | ||
| d) Der Streitgegenstand als die Behauptung eines subjektiv öffentlichen Rechts | 99 | ||
| 5. Der Streitgegenstand als das Begehren auf die im Klageantrag bezeichnete Entscheidung | 100 | ||
| a) Das Wesen der Lehre | 100 | ||
| b) Die Bestimmung des Streitgegenstandes durch das aus dem Klageantrag fließende Begehren | 100 | ||
| c) Der Streitgegenstand als das Begehren der Rechtsfolge | 101 | ||
| d) Der Streitgegenstand als das Begehren auf die im Klageantrag bezeichnete Entscheidung | 101 | ||
| Dritter Teil: Der Streitgegenstand im Steuerprozeß | 102 | ||
| § 10 Die Auffassungen vom Streitgegenstand im Steuerprozeß – Darstellung und Wertung | 102 | ||
| I. Der Wandel vom verlängerten Veranlagungsverfahren zum Rechtsschutzverfahren | 102 | ||
| 1. Das Berufungsverfahren als verlängertes Veranlagungsverfahren | 102 | ||
| 2. Der Rechtsschutzzweck des Finanzgerichtsverfahrens | 103 | ||
| § 11 Der Streitgegenstand als die vom Kläger aufgestellte Rechtsbehauptung, der angefochtene Verwaltungsakt sei rechtswidrig und verletze ihn in seinen Rechten | 107 | ||
| I. Das Klagebegehren, ein Element des Streitgegenstandes | 107 | ||
| 1. Der Streitgegenstand als die Rechtmäßigkeit des die Steuer festsetzenden Steuerbescheids | 107 | ||
| a) Der Streitgegenstandsbegriff der VwGO als Ausgangspunkt für die Bestimmung des Streitgegenstandes nach der FGO | 107 | ||
| b) Das öffentliche Interesse an einer richtigen Entscheidung im Verwaltungs- und Finanzgerichtsverfahren | 109 | ||
| c) Die wörtliche Übereinstimmung der für die Bestimmung des Streitgegenstandes maßgeblichen Vorschriften der VwGO und der FGO | 110 | ||
| d) Die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes als Mittelpunkt des finanzgerichtlichen Verfahrens | 110 | ||
| e) Die Besteuerungsgrundlage als bestimmendes Element des Streitgegenstandes? | 111 | ||
| f) Die Entstehungsgeschichte der FGO und der Wandel vom Veranlagungsverfahren zum finanzgerichtlichen Rechtsschutzverfahren | 114 | ||
| 2. Der Streitgegenstand als die vom Kläger aufgestellte Rechtsbehauptung unter Berücksichtigung des daraus hergeleiteten Klagebegehrens | 116 | ||
| 3. Das mit der Klage geltend gemachte Begehren als das wesentlich bestimmende Element des Streitgegenstandes | 118 | ||
| 4. Der Streitgegenstand als das Begehren auf die im Klageantrag bezeichnete gerichtliche Entscheidung | 121 | ||
| 5. Antrag und Klagebegründung als Elemente des Klagebegehrens | 122 | ||
| 6. Das Begehren auf richterliche Feststellung bestimmter Rechtsfolgen | 124 | ||
| 7. Der Streitgegenstand als das Klagebegehren, das der Kläger an das Gericht heranträgt | 125 | ||
| II. Das Klagebegehren, kein Element des Streitgegenstandes | 126 | ||
| 1. Der Streitgegenstand als die Rechtsfolgebehauptung des Klägers | 126 | ||
| a) Negative Qualifizierung des Klagebegehrens | 126 | ||
| b) Der Anspruch auf gerichtliche Rechtspflege | 126 | ||
| c) Das Verhältnis von Rechtsschutzanspruch und Klagebegehren | 127 | ||
| d) Das Verhältnis von Streitgegenstand und Anfechtungsgegenstand | 127 | ||
| e) Amtsermittlungspflicht und gesetzgeberische Intention | 128 | ||
| f) Zur Limitierung der klägerischen Rechtsbehauptung durch den Antrag | 129 | ||
| 2. Der obrigkeitliche Ausspruch als Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens | 131 | ||
| 3. Die Einheitlichkeit der Feststellung von Rechtswidrigkeit und Rechtmäßigkeit | 132 | ||
| 4. Der Streitgegenstand als die Rechtmäßigkeit des die Steuer (den Steuermeßbetrag) festsetzenden Steuerbescheids (Steuermeßbescheids) | 134 | ||
| a) Verböserungsverbot und Klagebegehren als Grenzen der gerichtlichen Entscheidungsbefugnis | 134 | ||
| b) Der Widerspruch zur Rechtsordnung als Friedensordnung | 135 | ||
| III. Klagebegehren und Sachverhalt als Elemente des Streitgegenstandes | 136 | ||
| § 12 Der Streitgegenstand als der vom Kläger zur Konkretisierung des Grundes seines Klagebegehrens dem Gericht unterbreitete Sachverhalt | 139 | ||
| I. Der Streitgegenstand als der dem Gericht zur Entscheidung unterbreitete Sachverhalt | 139 | ||
| II. Der Streitgegenstand als der anspruchsbegründende Tatbestand | 143 | ||
| III. Die Beschränkung des Streitgegenstandes auf einzelne Besteuerungsgrundlagen des angefochtenen Bescheides | 145 | ||
| Vierter Teil: Bestimmung des Streitgegenstandes | 148 | ||
| § 13 Die Methode der Bestimmung des Streitgegenstandes | 148 | ||
| I. Rechtstheoretische Grundlegung | 148 | ||
| 1. Das Recht als zentrales Ordnungsprinzip | 148 | ||
| 2. Rechtsbegriff und Rechtsbewußtsein | 149 | ||
| II. Funktion und Struktur des Rechtssatzes | 152 | ||
| 1. Funktion des Rechtssatzes | 152 | ||
| 2. Struktur des Rechtssatzes | 153 | ||
| III. Die Begriffsbildung und das System des Rechts | 156 | ||
| IV. Die Auslegung des Gesetzes | 157 | ||
| V. Rechtssatz und juristische Semantik | 159 | ||
| 1. Der Streitgegenstand als Verhältnis von sprachlichem Ausdruck und sprachlich Ausgedrücktem | 159 | ||
| 2. Zur rechtlichen Geltung des Streitgegenstandes | 159 | ||
| a) Bedeutet der Rechtsbegriff Streitgegenstand etwas? | 160 | ||
| b) Ist diese Bedeutung als rechtliche Bedeutung zu werten? | 160 | ||
| c) Sind Objekt und Relation existent? | 161 | ||
| d) Bedeutet der Rechtsbegriff Streitgegenstand etwas Rechtserhebliches? | 161 | ||
| e) § 65 FGO als imperativer Rechtssatz | 162 | ||
| § 14 Streitgegenstand und objektiver Wortsinn | 163 | ||
| I. Der Gesetzeswortlaut als Anhaltspunkt der Gesetzeserschließung | 163 | ||
| 1. Die isolierende Abstraktion als Beginn der Begriffsbildung | 165 | ||
| 2. Streitgegenstand und Sprachgebrauch | 166 | ||
| a) Allgemeiner Sprachgebrauch | 166 | ||
| b) Spezieller Sprachgebrauch | 168 | ||
| 3. Ergebnis | 169 | ||
| § 15 Der Sinnzusammenhang und das Wertsystem der FGO | 170 | ||
| I. Sinngehalt und Bedeutungszusammenhang | 170 | ||
| 1. Die Wechselbeziehung zwischen Rechtsbegriff und Rechtssatz | 170 | ||
| 2. Die teleologische Sinnbezogenheit der Rechtsbegriffe und Rechtssätze | 171 | ||
| II. Wertgehalt und Gesamtrechtsordnung | 173 | ||
| 1. Wertanspruch und Verwirklichung | 173 | ||
| 2. Das Bekenntnis zu einem lückenlosen verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Individualrechtsschutz | 175 | ||
| III. Wertgehalt und Finanzgerichtsordnung | 177 | ||
| 1. Der Streitgegenstand im Spannungsfeld eines dialektischen Prozesses | 177 | ||
| 2. Streitgegenstand und Untersuchungsgrundsatz | 180 | ||
| a) Die Herrschaft über den Prozeßstoff | 180 | ||
| b) Umfang der Sachaufklärungspflicht | 181 | ||
| aa) Die Bedeutung des klägerischen Rechtsschutzbegehrens | 181 | ||
| bb) Der Antrag als mittelbares Orientierungsdatum | 182 | ||
| cc) Die Überbewertung der im öffentlichen Gemeininteresse liegenden Notwendigkeiten der Finanzbehörden | 183 | ||
| dd) Die Beachtung zufällig bekannt gewordener neuer Tatsachen | 185 | ||
| ee) Die Mitverantwortung der Beteiligten für die Sachaufklärung | 185 | ||
| c) Die Beschränkung der Herrschaft über den Prozeßstoff | 187 | ||
| aa) Die Existenz von dispositiven Elementen | 187 | ||
| bb) Die Beschränkung der Ermittlung auf einzelne entscheidungserhebliche Besteuerungsgrundlagen | 188 | ||
| cc) Wesen des Untersuchungsgrundsatzes und Entscheidungserheblichkeit | 189 | ||
| dd) Die Aufgabennorm des § 204 Abs. 1 AO | 191 | ||
| ee) Die Befugnisgrenze gerichtlichen Handelns | 192 | ||
| d) Die Restriktion der gerichtlichen Ermittlungspflicht | 193 | ||
| aa) Die restriktiven Elemente | 193 | ||
| bb) Die Bezeichnung des Klägers und des Beklagten | 193 | ||
| cc) Die Beschwer als einschränkendes Element | 194 | ||
| dd) Die Bedeutung des Streitgegenstandes innerhalb des steuerrechtlich kontradiktorischen Prozeßverhältnisses | 194 | ||
| e) Das Rechtsschutzbegehren als Pflicht- und Befugnisgrenze | 196 | ||
| aa) Sachverhalt und Rechtsschutzbegehren | 196 | ||
| bb) Der Antrag als besondere Form der streitgegenstandsimmanenten Willensäußerung | 197 | ||
| cc) Die repressiv- und praeventivfinalen Elemente des Streitgegenstandes | 198 | ||
| 3. Streitgegenstand und Verböserungsverbot | 200 | ||
| a) Das Kassationsprinzip des § 100 Abs. 1 FGO und seine Durchbrechung | 200 | ||
| aa) Das Kassationsprinzip | 200 | ||
| bb) Das Verbot der reformatio in peius | 201 | ||
| b) Verböserungsverbot und Rechtsschutzgarantie | 202 | ||
| aa) Die Entstehungsgeschichte des § 100 Abs. 2 Satz 1 FGO | 202 | ||
| bb) Die Bipolarität von Verböserungsverbot und „Beanstandung“ der Steuer | 203 | ||
| cc) Der steuerprozessual-programmatische Charakter des Streitgegenstandes | 204 | ||
| 4. Streitgegenstand und richterliche Prozeßleitung | 205 | ||
| a) Die mitwirkende Verantwortung für das Ergebnis des finanzgerichtlichen Verfahrens | 205 | ||
| b) Der Streitgegenstand und seine Bedeutung in formeller Hinsicht | 206 | ||
| aa) Die Bedeutung für den Grundsatz der Öffentlichkeit der Verhandlung | 206 | ||
| bb) Die Bedeutung für die Frage nach dem gesetzlichen Richter | 207 | ||
| c) Der Streitgegenstand und seine Bedeutung in sachlicher Hinsicht | 207 | ||
| 5. Streitgegenstand und der Grundsatz des rechtlichen Gehörs | 208 | ||
| a) Die verfassungsrechtliche Anerkennung prozessualer Vorschriften | 208 | ||
| b) Die Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Minimalforderung des Art. 103 Abs. 1 GG durch § 96 Abs. 2 FGO | 210 | ||
| aa) § 96 Abs. 2 FGO als unmittelbarer Maßstab | 210 | ||
| bb) Die Frage nach dem Inhaber des Anspruchs auf rechtliches Gehör | 211 | ||
| cc) Die Frage nach dem Umfang des rechtlichen Gehörs | 212 | ||
| 6. Streitgegenstand und Grundsatz der Mündlichkeit der gerichtlichen Verhandlung | 213 | ||
| a) Der Grundsatz der Mündlichkeit des Verfahrens | 213 | ||
| b) Die Rechtshängigkeit als entscheidungserhebliche Vorform | 214 | ||
| c) Das Mündlichkeitsprinzip als Ergebnis einer Interessenbewertung | 215 | ||
| aa) Der Streitgegenstand und seine Bedeutung für die Interessenbewertung | 215 | ||
| bb) Der Streitgegenstand als einseitige prozessuale Behauptung | 216 | ||
| cc) Die Feststellung der objektiven Rechtswidrigkeit und subjektiven Verletzung als Ziel der klägerischen Behauptung | 216 | ||
| d) Das Begehren auf Beseitigung der Beeinträchtigung als Kern des eigentlichen Begehrens | 217 | ||
| aa) Die Rechtsbeeinträchtigung – Element der Zulässigkeit oder der Begründetheit der Klage? | 217 | ||
| bb) Die Rechtsbeeinträchtigung als Erfolgsvoraussetzung | 219 | ||
| e) Bestimmung des „Herrschaftsbereiches der gebotenen Mündlichkeit“ durch den Streitgegenstand | 221 | ||
| § 16 Die Entstehungsgeschichte der FGO und die Vorstellungen des Gesetzgebers | 222 | ||
| I. Der Verfassungsauftrag des Art. 108 Abs. 6 GG | 222 | ||
| II. Der Gesetzgeber und seine Vorstellungen | 223 | ||
| 1. Der – de iure – Gesetzgeber der Finanzgerichtsordnung | 223 | ||
| 2. Der – de facto – Gesetzgeber der Finanzgerichtsordnung | 224 | ||
| 3. Die Vorstellungen des Gesetzgebers | 225 | ||
| a) Die Grundprinzipien, Sachgesetzlichkeiten, Primärwertungen, Leitideen und Motivationen als Ergebnis des dialektischen Prozesses der Gesetzgebung | 225 | ||
| b) Die Bedeutung der außerparlamentarischen Normvorstellungen | 228 | ||
| c) Das Verfahren der FGO als echtes Gerichtsverfahren | 229 | ||
| d) Das Bestreben nach Einheit der rechtsprechenden Gewalt | 229 | ||
| e) Die Verstärkung des Rechtsschutzes durch stärkere justizförmliche Ausgestaltung des Finanzgerichtsverfahrens | 230 | ||
| III. Zur Entstehungsgeschichte der FGO | 231 | ||
| 1. Die gewollte Eigengesetzlichkeit des finanzgerichtlichen Verfahrens | 231 | ||
| a) „Billigkeit der Finanzverwaltung“ als klassischer Grundsatz der Steuerpolitik | 231 | ||
| b) Der Grundsatz der Prozeßwirtschaftlichkeit | 231 | ||
| c) Die Vermeidung einer übermäßigen Inanspruchnahme der Finanzgerichte | 233 | ||
| § 17 Der Zweck der FGO | 233 | ||
| I. Der Gesetzeszweck als Wahrscheinlichkeitswert | 233 | ||
| II. Die Verschiedenartigkeit der Zwecke | 234 | ||
| III. Der Wandel der Zwecke | 236 | ||
| § 18 „Die objektiv-teleologischen Kriterien“ | 237 | ||
| I. Die objektiv-teleologischen Kriterien und ihre Bedeutung für die Auslegung | 237 | ||
| II. Die „Natur der Sache“ als methodisches Prinzip | 237 | ||
| III. Die „Grundgedanken“ | 240 | ||
| IV. Die rechtsethischen „Prinzipien“ | 241 | ||
| V. Die Abkehr vom „Positivismus“ | 242 | ||
| § 19 Die Definition des Streitgegenstandes | 243 | ||
| I. Zusammenfassung | 243 | ||
| II. Definition | 246 | ||
| Fünfter Teil: Einzelprobleme | 248 | ||
| § 20 Die Frage, ob der gefundene Streitgegenstandsbegriff für die durch ihn „angesprochene Umwelt“ überzeugend oder wenigstens akzeptabel ist | 248 | ||
| § 21 Finanzrechtsweg und Zuständigkeit des Gerichts | 249 | ||
| § 22 Die Rechtshängigkeit der Streitsache | 251 | ||
| § 23 Die Klageänderung | 252 | ||
| § 24 Die materielle Rechtskraft | 253 | ||
| Literaturverzeichnis | 258 | ||
| Gerichtsentscheidungen | 283 |
