Allgemeine Soziologie
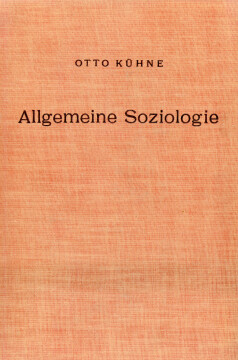
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Allgemeine Soziologie
Lebenswissenschaftlicher Aufriß ihrer Grundprobleme. 1. Halbbd.: Die Lehre vom sozialen Verhalten und von den sozialen Prozessen
(1958)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | V | ||
| Inhaltsverzeichnis | IX | ||
| Einleitung | 1 | ||
| A. Der Hauptinhalt unserer soziologischen Betrachtungen | 1 | ||
| B. Geschichtlicher Überblick über die bisherige Entwicklung der Soziologie zu einer selbständigen Wissenschaft | 6 | ||
| I. Die bisherige Entwicklung der Soziologie im Auslande | 6 | ||
| II. Die bisherige Entwicklung der Soziologie in Deutschland | 18 | ||
| III. Die jüngste Entwicklung der Soziologie in Deutschland | 25 | ||
| Erster Hauptteil: Die Lehre vom sozialen Verhalten | 35 | ||
| Erster Abschnitt: Grundlegung der Soziologie als gesellschaftliche Lebenslehrt | 35 | ||
| 1. Über die allgemeinen Voraussetzungen, Grundlagen und Prinzipien „richtigen" sozialen Denkens | 35 | ||
| 2. Der Polaritätscharakter alles gesellschaftlichen Lebens | 46 | ||
| 3. Der polare Sinn alles — insbesondere gesellschaftlichen — Lebens | 50 | ||
| 4. Zusammenfassende Darstellung unserer dualistischen (polaren bzw. dialektischen) Grundauffassung aller gesellschaftlichen Lebensvorgänge | 55 | ||
| a) Der Unterschied von monistischer und dualistischer Welt- und Lebensauffassung | 57 | ||
| b) Das Polaritätsverhältnis von gesellschaftlichen Lebensformen und Lebensinhalten als „Sinn"- und „Verstehens"grundlage | 68 | ||
| c) Theorie und Praxis im Gesellschaftsleben | 72 | ||
| 5. Die Polarität aller sozialen Auslese- und Anpassungsfaktoren im Gesellschaftsleben | 77 | ||
| a) Die Gestaltungskräfte der sozialen Auslese und sozialen Anpassung im Kulturleben | 77 | ||
| b) Die Gestaltungskräfte der sozialen Auslese und der sozialen Anpassung im Bevölkerungsleben | 82 | ||
| c) Die Gestaltungskräfte der sozialen Auslese und der sozialen Anpassung im Wirtschaftsleben | 85 | ||
| 6. Gesamtübersicht über die wichtigsten Gesellungs- und Lebenssphären im Gesellschaftsleben | 89 | ||
| Zweiter Abschnitt: Über Wesen, Aufgabe, Stellung und Abgrenzung der Soziologie als soziale Lebenskunstlehre und als selbständiger sozialwissenschaftlichen Disziplin | 96 | ||
| I. Vom Wesen unserer Lebenskunstlehre und ihrer Abgrenzung gegenüber benachbarten Wissenschaftsgebieten | 96 | ||
| 1. Soziale Lebenskunstlehre und Anthropologie | 99 | ||
| 2. Soziale Lebenskunstlehre und Geschichtswissenschaft | 102 | ||
| 3. Soziale Lebenskunstlehre und Philosophie | 104 | ||
| 4. Der „Soziologismus" in anderen Wissenschaftszweigen | 105 | ||
| 5. Soziale Lebenskujistlehre und sonstige sozialwissenschaftliche Disziplinen (Sozialethik, Sozialpsychologie usw.) | 108 | ||
| 6. Soziale Lebenskunstlehre und Gesellschafts-, insbesondere Sozialpolitik | 111 | ||
| 7. Individuale und soziale Lebenskunstlehre | 116 | ||
| Dritter Abschnitt: | 125 | ||
| A. Der Doppelcharakter der Sozialen Lebenskunstlehre als „Wissenschafts"- Lehre und als „Kunst"-Lehre | 125 | ||
| 1. Ihr zunehmender starker „Unbestimmtheits"-Charakter erschwert das „Fertigwerden" mit den heutigen gesellschaftlichen Lebenssituationen und erfordert zusätzlich eine besondere „Lebenskunst" unabhängig von den bisher üblichen „exakten" wissenschaftlichen Erkenntnis-, Verstehens- und Gestaltungsmethoden | 125 | ||
| 2. Die Kunst, das „Richtige" im „Spiel" der gesellschaftlichen Kräfte zu treffen | 146 | ||
| B. Hauptprinzip, Hauptziel und Sinn aller Sozialen Lebenskunst | 158 | ||
| 1. Die „Kunst", die sozial-kulturelle Rolle des „Überwiegend Menschlichen" bei allen gesellschaftlichen Ziel- und Wertsetzungen, insbesondere im Verhältnis von Mensch und Technik stets zu wahren | 158 | ||
| a) Technik und Lebensbedarf | 160 | ||
| b) Technik und Lebenseinstellung | 166 | ||
| c) Technokrate und soziale Lebenskunst | 177 | ||
| d) Soziale Wissenschaft — Soziale Lebenskunst in ihren sonstigen Zielsetzungen | 184 | ||
| 2. Soziale Lebenskunst und Lebenstechnik (Routine) | 188 | ||
| 3. Soziale Lebenskunst und Schöne Kunst | 191 | ||
| 4. Soziale Lebenskunst und Lebensweisheit | 199 | ||
| Vierter Abschnitt: Über die wichtigsten Richtungen und Methoden der Soziologie | 202 | ||
| 1. Über die Hauptrichtungen der Soziologie | 202 | ||
| 2. Über die wichtigsten Methoden der Soziologie | 212 | ||
| Fünfter Abschnitt: Über den Systemaufbau der Soziologie als selbständiger Disziplin | 252 | ||
| 1. Gegenstand und Umfang der gesellschaftlichen Beziehungen | 252 | ||
| 2. Die Gestaltung der gesellschaftlichen Beziehungen | 253 | ||
| 3. Die Inhalte, Kräfte und Ziele alles gesellschaftlichen Zusammenlebens: | 256 | ||
| a) Was ist der Inhalt alles Gesellschaftlichen (Sozialen)? | 256 | ||
| b) Die soziale Bedeutung der Ziele und Sachbereiche gesellschaftlichen Zusammenlebens | 263 | ||
| 4. Die grundlegenden Kategorien der Allgemeinen Soziologie | 267 | ||
| Sechster Abschnitt: Wesen und Bedeutung der einzelnen Gesellungs- und Lebenssphären | 281 | ||
| I. Die Lebenssphäre (1) der gesellschaftlichen (Daseins-)Sinnstruktur | 283 | ||
| 1. Die Lebenssphäre (1) der sachlichen Grundkräfte | 283 | ||
| a) Das Verhältnis der Natur- zu den Geistesfaktoren | 284 | ||
| b) Der „Sinn" alles sozialen Denkens und Handelns | 290 | ||
| c) Das Streben nach sozialem Lebensglück | 293 | ||
| d) Der Einfluß der Natur- und Geistesfaktoren auf die gesellschaftlichen Erscheinungen | 299 | ||
| e) Welche gesellschaftlichen Umwelt-, insbesondere Ideenerscheinungen beeinflussen das Natur- und Geistesleben? (Realismus und Idealismus) | 303 | ||
| f) Die Rolle der irrationalen Denk- und Handlungsweisen | 310 | ||
| a) Das magische und das „Enthüllungs"-Denken | 310 | ||
| β) Die Rolle von Hypothesen bei der Analyse und Vorhersage sozialen Verhaltens | 313 | ||
| 2. Die Lebenssphäre (1), insbesondere in Verbindung mit der Sphäre (2) der ich-umweltlichen Grundkräfte | 316 | ||
| a) Die Rolle der das soziale Ich-Umwelt-Verhältnis mitbestimmenden „seelischen" Haltungs- und Verhaltenskomponenten (Strebungen, Gefühle, Gesinnungen) | 319 | ||
| α) Die trennenden und verbindenden seelischen Wirkkräfte unseres gesellschaftlichen Lebens | 321 | ||
| β) Gibt es „geistige" Triebe? | 326 | ||
| 3. Die — besonders ethischen — Normen im Gesellschaftsleben | 329 | ||
| II. Die Lebenssphäre (2) der gesellschaftlichen „Gemeinsamkeits"- Struktur von Ich und Umwelt, insbesondere der persönlichen Gegebenheiten | 338 | ||
| 1. Wesen und Bedeutung des Ich als sozialer Persönlichkeit unter Berücksichtigung der wichtigsten Typen- und Schichtentheorien | 338 | ||
| a) Die Behavioristen | 342 | ||
| b) Die verschiedenen sozialen Rollen des Ich | 347 | ||
| 2. Das Verhältnis der männlichen zur weiblichen Sozialeinstellung | 351 | ||
| III. Die Lebenssphäre (3) der gesellschaftlichen Modalstruktur | 357 | ||
| 1. Das Verhältnis der Auslese- und Anpassungsmomente im gesellschaftlichen Leben, insbesondere in Verbindung mit den Naturund Geisteskräften der Sphäre (1) und den Ich-Umwelt-Einflüssen der Sphäre (2) | 357 | ||
| 2. Das „richtige" Menschenbild von heute | 361 | ||
| IV. Die Lebenssphäre (4) der gesellschaftlichen Gestaltungs-(Sinn-) Struktur | 363 | ||
| 1. Das Verhältnis der „richtig" zu gestaltenden Lebensformen und Lebensinhalte zueinander | 363 | ||
| 2. Das Verhältnis von Lebensstil, Lebensart und Lebensweise | 368 | ||
| 3. Der dahinschwindende Gemeinsinn und die zunehmende Dialektik zwischen Ich und Umwelt, vor allem auf Grund der überhandnehmenden kollektivistischen „Fortschritts"-Tendenzen | 372 | ||
| V. Die Lebenssphäre (3 a) der gesellschaftlichen Evidenzstruktur | 375 | ||
| 1. Die Rolle des Vertrauens im Gesellschaftsleben | 375 | ||
| 2. Die Rolle der Maske, überhaupt des Scheines bei der „richtigen" sozialen Verhaltensanalyse | 377 | ||
| VI. Die Lebenssphäre (5) der gesellschaftlichen Interessenstruktur | 387 | ||
| 1. Die dominierende Rolle der Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit im sozialen Verhalten | 389 | ||
| 2. Wie kommt man sich „menschlich näher"? | 392 | ||
| 3. Die entscheidenden „Menschlichkeits"-Merkmale bei sozialen Einstellungen | 396 | ||
| 4. Der Sinn des wahren „Menschseins" und seine bestmögliche Verwirklichung | 400 | ||
| 5. Menschlichkeit und Freiheit | 405 | ||
| 6. Menschlichkeit und Schicksal | 408 | ||
| 7. Menschlichkeit und Lebensglück | 411 | ||
| Siebenter Abschnitt: Ober die Schwierigkeiten und Hemmnisse „richtigen" menschlichen Verstehens | 414 | ||
| Achter Abschnitt: Die sozialen Haltungen, deren Leitbilder und Bestimmungsfaktoren sowie die Schwierigkeiten ihrer „richtigen" Erfassung und Analyse | 421 | ||
| 1. Die Faktoren des „Fortschritts" und der „Tradition" | 421 | ||
| 2. Die starke Personengebundenheit jedes Leitbildes | 425 | ||
| 3. Die sachliche Gebundenheit des Leitbildes | 429 | ||
| 4. Die größere Dauerwirkung der religiösen Gestaltungskräfte: Menschenbild und Gottesbild | 434 | ||
| 5. Gibt es ein allgemeingültiges sozial-kulturelles Leitbild? | 440 | ||
| 6. Der „Unbestimmtheits"-Einfluß von Imponderabilien, z. B. von Gerüchten, Meinungen usw. auf alle soziale Haltung | 448 | ||
| 7. Kann eine bloß „empirische" Meinungsforschung die „wahre" soziale Einstellung der Menschen ermitteln? | 455 | ||
| Neunter Abschnitt: Zusammenfassung unserer sozialen Verhaltens- und Typenlehre | 467 | ||
| 1. Die Hauptaufgabe der Soziologie | 467 | ||
| 2. Die Bedeutung des ich-umweltlich „Gemeinsamen" als des „Richtigen", insbesondere in seinem Verhältnis zum „Polaren" und zum „Dialektischen" | 468 | ||
| 3. „Richtiges" Handeln als „gemeinsam ausgerichtetes" Handeln gemäß) dem Satze vom „zureichenden Realgrund" | 473 | ||
| 4. Das erste (direkte) Verfahren zur Erfassung der „richtigen" Einstellung als polares Produkt individueller (Lage- und Verhaltens-) Grenzsituationen von Ich und Umwelt | 477 | ||
| 5. Das „richtige" im Verhältnis zum „gemeinschaftlichen" und „typischen" Handeln | 482 | ||
| 6. Das „Soziale" als das „Gemeinsame, überwiegend Menschliche", insbesondere im Verhältnis zum „Durchschnittlichen" und „Typischen" | 484 | ||
| 7. Der „gemeinsame" (bzw. „Gemeinschafts"-) Typ | 488 | ||
| 8. Das zweite (indirekte) Verfahren zur Erfassung der „richtigen" Haltung als polares Produkt individueller Abweichungen von „gemeinsamen" (bzw. „gemeinschaftstypischen") Situationen | 489 | ||
| 9. Das dritte (indirekte) Verfahren zur Erfassung der „richtigen" Haltung als polares Produkt „typischer" individueller Grenzsituationen | 492 | ||
| 10. Idealtypisches und realtypisches (Grenz-) Verhalten | 493 | ||
| 11. Die Bedeutung des dritten Verfahrens für Erfassung des „richtigen" Handelns mittels Ein- und Zuordnung zu „grenz"- und „gemeinsamkeits"- typischen Ich-Umwelt-Beziehungen | 494 | ||
| 12. „Echte" soziale Typen als polare Misch- und Gegentypen | 498 | ||
| Zweiter Hauptteil: Die Lehre von den Sozialen Prozessen | 515 | ||
| Erster Abschnitt: Wesen, Bedeutung und systematische Einteilung der Sozialen Prozesse | 515 | ||
| Zweiter Abschnitt: Über die Sozialen Prozesse der überwiegenden Auslese oder über die Kunst der „richtigen" sozialen Auslese | 522 | ||
| 1. Einteilung und Systematik dieser Prozesse | 522 | ||
| 2. Die Prozesse oppositioneller Haltungen | 527 | ||
| 3. Die (überwiegend negativen) leib-seelischen Isolierungs-, Stör- und Ausweichtendenzen | 531 | ||
| 4. Die (überwiegend positiven) Elite-Haltungsprozesse | 538 | ||
| 5. Die sozialen Prozesse der Altersentwicklung | 541 | ||
| a) Das soziale Verhalten der Jugendlichen | 542 | ||
| α) Die Einflüsse der Pubertät | 544 | ||
| β) Die sonstigen „Labilitäts"-Einflüsse mit einhergehenden Haltungsschwankungen. Das Halbstarken-Problem | 550 | ||
| γ) Die Haltung der Jugendlichen aus der Sicht der „Erwachsenen" | 555 | ||
| b) Das soziale Verhalten der Erwachsenen mittlerer Jahrgänge, insbesondere gekennzeichnet nach verschiedenen Entwicklungs- „Modellen" | 560 | ||
| c) Das soziale Verhalten der „Alten" | 565 | ||
| 6. Der Soziale Prozeß der „Indiskretion" | 573 | ||
| 7. Die sozial typische Verhaltensweise beim „Klatschen", „Anschwärzen" usw. | 578 | ||
| 8. Der Soziale Prozeß des Konkurrierens | 580 | ||
| 9. Weitere Beispiele für überwiegend positive oder negative soziale „Auslese"-Prozesse (das Imponierenwollen, Flirten, Kritisieren, Ironisieren usw.) | 583 | ||
| 10. Die allgemeine soziale Bedeutung der überwiegenden Ausleseprozesse | 585 | ||
| Dritter Abschnitt: Über die Sozialen Prozesse der überwiegenden Anpassung oder: Über die Kunst der „richtigen" sozialen Anpassung | 594 | ||
| 1. Einteilung und Systematik der Sozialen Anpassungs-Prozesse | 594 | ||
| 2. Die sozialen Prozesse der — insbesondere kollektivistischen — Angleichung und Vereinheitlichung | 595 | ||
| a) Die Prozesse der Vermassung und Nivellierung, insbesondere mit gleichzeitiger Isolierung des Einzelnen | 599 | ||
| b) Die Ersatzbefriedigungs- und Ausweichtendenzen des Ich, besonders unter dem Druck der Unsicherheits- und Angstgefühle gegenüber der Umwelt | 610 | ||
| α) Die Bedeutung und Überwindung der Lebensangst und Überempfindlichkeit im ich-umweltlichen Verhalten | 614 | ||
| β) Die fehlende Harmonie von Vernunft- und gefühlsmäßiger Umwelt-Einstellung | 623 | ||
| c) Die soziale Bedeutung der mannigfachen — insbesondere kollektiven — Ersatzbefriedigungstendenzen | 626 | ||
| d) Weitere Abarten der Uniformierungs- und Angleichungsprozesse | 635 | ||
| 3. Soziale Fehlanpassungen mit geistigen Auslese-, Isolierungs- und Ausweichtendenzen, besonders unter dem Einfluß sozialer Fortschritts-, Spezialisierungs-, Aufstiegs- und Erfolgsbestrebungen . | 637 | ||
| 4. Die Bedeutung des Krankseins für alle „richtige" Sozialanpassung unter besonderer Berücksichtigung der „Manager"-Krankheit. Die Flucht aus der Krankheit und in die Krankheit | 650 | ||
| 5. Witz und Humor als soziale Anpassungstaktiken | 656 | ||
| 6. Gemeinschaftstendenzen mit hinreichender Wahrung der Freiheit der Persönlichkeit | 662 | ||
| 7. Das soziale Verhältnis von Führung und Gefolgschaft | 676 | ||
| 8. Gesellungstendenzen im Rahmen gesellschaftlicher Umgangsformen (Etikette, Anstandsregeln usw.) | 682 | ||
| 9. Das Verhältnis von gemeinschafts-, gesellschafts- und organisationsmäßigen Verhaltenweisen zueinander | 688 | ||
| 10. Richtige Menschenkenntnis und Menschenbehandlung erleichtert die soziale Anpassung | 695 | ||
| 11. Die Hauptprinzipien richtiger gesellschaftlicher Umgangsformen („human relations") in amerikanischer Sicht | 703 | ||
| 12. Die übersoziale Verankerung gesellschaftlicher Umgangsformen in genereller Sicht | 710 | ||
| 13. Lebensstil und gesellschaftliche Umgangsformen | 714 | ||
| 14. Die Rolle der „Ritterlichkeit" im Verkehr der Geschlechter untereinander | 716 | ||
| 15. Die soziale Bedeutung der konventionellen Betragens- und Anstandsregeln im Wechsel der Zeiten | 719 | ||
| Vierter Abschnitt: Soziale Annäherungs-, Kompromiß- und Duldungstendenzen | 735 | ||
| 1. Die Toleranz als Prinzip sozialen Verhaltens | 741 | ||
| 2. Die Gegenstände und Formen der Toleranz | 744 | ||
| 3. Die Grenzen der Toleranz | 749 | ||
| 4. Toleranz und Kompromißbereitschaft | 751 | ||
| Fünfter Abschnitt: | 754 | ||
| I. Soziale Kontaktmöglichkeiten | 754 | ||
| 1. Funktion und Bedeutung sozialer Kontakte | 754 | ||
| 2. Die Hauptarten sozialer Kontakte | 758 | ||
| 3. Die Ausdrucksformen und -mittel der Nahkontakte | 759 | ||
| 4. Die sozialen Fernkontakte | 764 | ||
| 5. Soziale Kontaktpflege im Wirtschaftsleben | 765 | ||
| 6. Das Verhältnis sozialer Nah- und Fernkontakte zueinander | 767 | ||
| II. Der einsame Mensch | 768 | ||
| 1. Die Einsamkeit als soziale „Grenz"-Situation | 768 | ||
| 2. Die Einsamkeit der Natur- und Kunstbetrachtung | 770 | ||
| 3. Die „schöpferische" Einsamkeit | 773 | ||
| 4. Die zunehmende Vereinsamung des Menschen im Zeichen des heutigen Massenzeitalters | 774 | ||
| 5. Die „Kunst" des Alleinseins und die „Kunst" richtigen Sozialverhaltens | 775 | ||
| Schlußbetrachtung | 780 | ||
| Autorenregister | 787 | ||
| Sachregister | 790 |
