Soziologie und Sozialpolitik
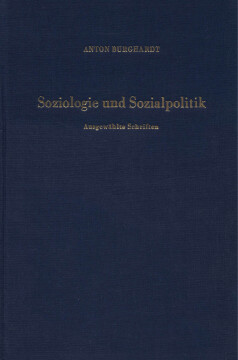
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Soziologie und Sozialpolitik
Ausgewählte Schriften. Aus Anlaß seines 70. Geburtstages hrsg. von Alois Brusatti / Friedrich Fürstenberg / Johannes Messner / Gertraude Mikl-Horke / Helmut Leuker
Editors: Brusatti, Alois | Fürstenberg, Friedrich | Messner, Johannes | Mikl-Horke, Gertraude | Leuker, Helmut
(1980)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhalt | 5 | ||
| Vorwort | 7 | ||
| Für Anton Burghardt – Versuch eines Curriculum | 9 | ||
| I. Wirtschaftssoziologie | 13 | ||
| Die EDV – sozioökonomische Aspekte | 15 | ||
| I. | 15 | ||
| II. | 16 | ||
| III. | 23 | ||
| IV. | 25 | ||
| Soziale Determinanten der beruflichen Lohnstruktur | 27 | ||
| I. Begriffsuntersuchung | 27 | ||
| II. Die ökonomischen Determinanten der Lohnstruktur | 29 | ||
| III. Die sozialen Determinanten der Lohnstruktur | 32 | ||
| IV. Die Dynamisierung der Lohnstruktur | 40 | ||
| II. Soziologie als Verhaltenstheorie | 43 | ||
| Technikverdrossenheit | 45 | ||
| Sociology of Money. Some Fundamental Statements | 51 | ||
| I. The Phenomenology of Money | 51 | ||
| II. How Money Comes into Being | 52 | ||
| III. The Ideology of Gold | 54 | ||
| IV. Money – A Behavioural Variable | 54 | ||
| V. Social Functions of Money | 56 | ||
| References | 57 | ||
| Die Nationswerdung Österreichs | 58 | ||
| I. Willensnation | 59 | ||
| II. Grenzbegriffe zur Nation | 59 | ||
| III. Nationswerdung als Sozialisierungsprozeß | 60 | ||
| IV. Nationswerdung Österreichs | 61 | ||
| V. Keineswegs eine Sprachnation | 63 | ||
| VI. Die Nation – ein Prozeß | 64 | ||
| Sparen aus soziologischer Sicht | 65 | ||
| I. | 65 | ||
| II. | 70 | ||
| III. | 73 | ||
| IV. | 75 | ||
| Die Entscheidung als verhaltenstheoretisches und soziales Phänomen | 78 | ||
| I. Allgemeines zur Entscheidung | 78 | ||
| II. Das Soziale in den Entscheidungen | 87 | ||
| Summary | 91 | ||
| Gewerkschaftstheorie als Verhaltenstheorie | 93 | ||
| I. Gewerkschaftstheorie – allgemein | 93 | ||
| II. Voraussetzung gewerkschaftlichen Verhaltens | 95 | ||
| III. Konstitutive Bedingungen | 98 | ||
| IV. Mutation der Arbeitsbedingungen? | 101 | ||
| V. Probleme der Anpassung | 111 | ||
| III. Eigentumstheorie | 115 | ||
| Eigentumskontroverse und Eigentumswirklichkeit | 117 | ||
| I. Entstehung des Eigentums | 117 | ||
| II. Die Eigentumstheorie | 119 | ||
| III. Die Eigentumskontroversen | 120 | ||
| IV. Eigentum als soziale Fiktion | 121 | ||
| V. Eigentumswirklichkeit und Wirtschaftswirklichkeit | 123 | ||
| VI. Zusammenfassung | 124 | ||
| Der „Tod“ des Eigentümers | 126 | ||
| I. | 126 | ||
| II. | 127 | ||
| III. | 129 | ||
| Eigentum – Ideologie und Wirklichkeit | 134 | ||
| I. Eigentumskontroversen | 134 | ||
| II. Das Eigentum als Herrschaftsinstrument | 137 | ||
| III. Eigentumskategorien | 138 | ||
| IV. Das „Absterben des Eigentümers“ | 142 | ||
| V. Besitzherrschaft – Eigentumsherrschaft | 144 | ||
| VI. | 146 | ||
| IV. Medizinsozioökonomie | 147 | ||
| Kosten und Nutzen des Krankenhauses für die Gesellschaft. Aspekte einer Sozioökonomie der Gesundheit | 149 | ||
| I. | 149 | ||
| II. | 153 | ||
| III. | 159 | ||
| Die Krankheit als soziologisches Phänomen | 165 | ||
| I. Relevanter Begriffskatalog | 165 | ||
| 1. Krankheitsbegriff | 165 | ||
| 1.1 Laienbegriff | 165 | ||
| 1.2 Ärztlicher Krankheitsbegriff | 166 | ||
| 1.3 Sozialpolitischer Aspekt | 167 | ||
| 2. Bedingte Krankheiten im Sinn der Sozialversicherung | 170 | ||
| 2.1 Körperliche Mängel | 170 | ||
| 2.2 Das Lebensalter als Krankheit | 170 | ||
| 3. Der Tod in der Zivilisation | 171 | ||
| 3.1 Der Tod als sozialer Störfaktor | 171 | ||
| 3.2 Euthanasie | 171 | ||
| II. Die Krankheit als soziales Phänomen | 172 | ||
| 1. Epidemiologie | 172 | ||
| 2. Medizinsoziologie | 173 | ||
| 3. Die soziologischen Aspekte der Krankheit | 173 | ||
| 3.1 Krankheit als kollektives Verhalten | 173 | ||
| 3.2 Gegenstand der medizin-soziologischen Analyse | 174 | ||
| 3.3 Soziosomatik von Krankheiten | 175 | ||
| 4. Bedeutungsverlagerung von Krankheitsfaktoren | 175 | ||
| 4.1 Konsumchancen | 175 | ||
| 4.2 Ökologische Situation | 175 | ||
| 4.3 Karrieristische Zwänge | 175 | ||
| 4.4 Wohlfahrtskrankheiten | 176 | ||
| 4.5 Schichtarbeit – Zeitbudget | 176 | ||
| III. Die Krankheit – als Anomie verstanden | 177 | ||
| 1. Krankheit als Differenz zwischen Soll- und Ist-Verhalten | 177 | ||
| 2. Behandlungsbedürftige psychisch Gestörte – soziale Interpretation | 177 | ||
| 3. Behinderte | 178 | ||
| IV. Krankheitsbestimmte Rollen | 179 | ||
| 1. Krankenrolle | 179 | ||
| 1.1 Rollenbedürfnis | 179 | ||
| 1.2 Rollenzuweisung | 179 | ||
| 1.3 Inhalt der Krankenrolle | 179 | ||
| 2. Arztrolle | 180 | ||
| 3. Arzt-Patient-Beziehungen | 180 | ||
| 4. Krankenhaus | 181 | ||
| V. Sozial- und Anspruchsneurosen | 182 | ||
| 1. Krankheit als Gewinnchance | 182 | ||
| 1.1 Primärer Krankheitsgewinn | 182 | ||
| 1.2 Sekundärer Krankheitsgewinn | 182 | ||
| 2. Aggravation vom Kranksein | 183 | ||
| 3. Krankheit als Ersatzbefriedigung | 183 | ||
| 4. Sozialneurosen – Anspruchsneurosen | 183 | ||
| 5. Rentenneurosen | 184 | ||
| V. Soziallehre | 185 | ||
| Katholische Soziallehre. Anmerkungen zu ihren Konstanten und Variablen | 187 | ||
| I. Die elementare Begründung | 187 | ||
| II. Die KSL – ein didaktisches Phänomen | 195 | ||
| III. Wesentliche Konstanten | 198 | ||
| IV. Die Orientierung am Einzelnen | 202 | ||
| V. Der Pluralismus in der KSL | 204 | ||
| VI. Die Mutation der sozialen Bedingungen | 205 | ||
| Humanae Vitae. Bemerkungen zu einer innerkatholischen Kontroverse | 211 | ||
| I. | 211 | ||
| II. Charakteristika der Enzyklika | 212 | ||
| III. Bestimmungsgründe der Polemik | 213 | ||
| IV. Gegenkritik | 217 | ||
| Ideologieverdacht gegen christliche Soziallehren | 219 | ||
| I. | 219 | ||
| II. | 221 | ||
| III. | 228 | ||
| IV. | 229 | ||
| VI. Sozialpolitik und Sozialreform | 233 | ||
| Die neue soziale Frage (Hypothesen) | 235 | ||
| Mitbestimmung | 246 | ||
| I. Begriff | 246 | ||
| 1. Semantische Problematik | 246 | ||
| 2. Mitbestimmung im weiteren Sinn | 247 | ||
| 3. Mitbestimmung im engeren Sinn | 247 | ||
| 4. Negative Mitbestimmung | 248 | ||
| 5. Überbetriebliche Mitbestimmung | 248 | ||
| 6. Mitbestimmung auf Grund von Miteigentum oder Ergebnisbeteiligung | 248 | ||
| 7. Arbeiterselbstverwaltung | 248 | ||
| II. Wesen der Mitbestimmung | 249 | ||
| 1. Ontologische Basis | 249 | ||
| 2. Partielle Besitzmacht der Arbeitnehmer | 249 | ||
| 3. Arbeitnehmer und Arbeitgeber – eine Dispositionsgemeinschaft | 249 | ||
| III. Einsatzbereich der Mitbestimmung | 250 | ||
| 1. Betrieb | 250 | ||
| 2. Engerer Produktionsbereich | 250 | ||
| 3. Mitbestimmung und materielle Arbeitsbedingungen | 250 | ||
| IV. Zwecke der Mitbestimmung | 250 | ||
| 1. Sozialer Zweck | 250 | ||
| 2. Ökonomische Aspekte | 251 | ||
| V. Rechtfertigung der Mitbestimmung | 251 | ||
| 1. Der Arbeitnehmer als Mitarbeiter | 251 | ||
| 2. Mitbestimmung und Konfliktregelung | 252 | ||
| 3. Betriebe als gesellschaftliche Gebilde | 252 | ||
| VI. Die Träger (Organe) der Mitbestimmung | 252 | ||
| 1. Betriebsrat | 253 | ||
| 2. Aufsichtsrat | 253 | ||
| 3. Vorstand | 253 | ||
| 4. Wirtschaftsausschuß | 253 | ||
| 5. Betriebsversammlung | 253 | ||
| 6. Supranationaler Betriebsrat | 253 | ||
| VII. Geschichtliches zur Frage der Mitbestimmung | 254 | ||
| VIII. Die Mitbestimmung in Einzelunternehmungen und auf Konzernebene | 255 | ||
| 1. Mitbestimmung in Einzelunternehmungen (Montan-Mitbestimmung) | 255 | ||
| 2. Mitbestimmung in Obergesellschaften der Montangesellschaften | 256 | ||
| 3. Die Mitbestimmung in den restlichen Kapitalgesellschaften – Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) | 256 | ||
| 4. Mitbestimmung in supranationalen Unternehmungen | 257 | ||
| 5. Tendenzbetriebe | 258 | ||
| 6. Projektierte Expansion der Mitbestimmung | 258 | ||
| IX. Erfahrungen | 259 | ||
| 1. Der Ort der Mitbestimmung | 259 | ||
| 2. Unternehmungspolitik | 259 | ||
| 3. Informelle Sekundärwirkungen der Mitbestimmungs-Gesetzgebung | 260 | ||
| X. Offene Fragen | 260 | ||
| 1. Kritische sozialethische Aspekte | 260 | ||
| 2. Gewerkschaften – Position in der Mitbestimmung | 260 | ||
| 3. Arbeitsdirektor | 261 | ||
| 4. Eigentumsordnung | 261 | ||
| 5. Direktionsrecht des Unternehmens | 262 | ||
| 6. Das neutrale Mitglied | 262 | ||
| 7. Gruppenbildung im Betrieb | 262 | ||
| 8. Leitende Angestellte | 262 | ||
| Literatur | 263 | ||
| Restarbeitslosigkeit bei Vollbeschäftigung | 265 | ||
| I. | 265 | ||
| II. | 268 | ||
| III | 272 | ||
| IV. | 273 | ||
| Zielsysteme und Leitbilder der angewandten Sozialpolitik in Österreich | 274 | ||
| I. Allgemeines zu Zielsystemen und Leitbildern | 274 | ||
| II. Etappen der österreichischen Sozialpolitik | 276 | ||
| III. Gegenwärtige Sozialpolitik in Österreich | 278 | ||
| A. Merkantilistische Tendenzen der Sozialpolitik in Österreich | 278 | ||
| B. Berufliche quasiständische Selbstverwaltung | 279 | ||
| C. Minimierung des privaten Risikos – Volksversicherung | 281 | ||
| D. Fürsorgerische Elemente in der Sozialpolitik | 284 | ||
| E. Mitbestimmung | 285 | ||
| F. Die sozialpolitisch relevanten Interessenvertretungen | 286 | ||
| G. Die Morphologie des österreichischen Arbeitsrechtes | 287 | ||
| H. Vermögensbildung in AN-Hand | 288 | ||
| J. Sozialpolitische Relevanz des Abgabenrechtes | 289 | ||
| IV. Versuch der Ermittlung eines sozialpolitischen Ziel- und Leitbildsystems in Österreich | 289 | ||
| A. Vorbemerkungen | 289 | ||
| B. Einige Axiome österreichischer Sozialpolitik | 289 | ||
| C. Ziele | 290 | ||
| D. Zielpräferenz | 291 | ||
| E. Zielkonsistenz | 291 | ||
| F. Leitbilder | 291 | ||
| Summary | 292 | ||
| Über residualen Pauperismus | 294 | ||
| I. | 295 | ||
| II. | 301 | ||
| III. | 309 | ||
| IV. | 313 | ||
| Summary | 314 | ||
| Quellennachweis | 317 | ||
| Schrifttumsverzeichnis | 319 | ||
| 1. Bücher | 319 | ||
| 2. Mitherausgeber | 319 | ||
| 3. Aufsätze | 319 | ||
| 4. Beiträge in „berichte“, herausgegeben vom Institut für Allgemeine Soziologie und Wirtschaftssoziologie an der Wirtschaftsuniversität Wien | 325 |
