Die Schranken planerischer Gestaltungsfreiheit im Planfeststellungsrecht
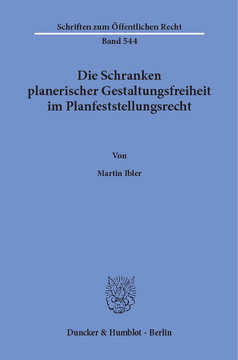
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Schranken planerischer Gestaltungsfreiheit im Planfeststellungsrecht
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 544
(1988)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 13 | ||
| 1. Kapitel: Grundlagen | 19 | ||
| A. Plan und Planung im Verwaltungsrecht | 19 | ||
| B. Die Planfeststellung als Instrument der Fachplanung im System des Raumplanungsrechts | 20 | ||
| C. Grundzüge der historischen Entwicklung des Planfeststellungsrechts | 23 | ||
| D. Kurzer Überblick über das Planfeststellungsverfahren | 24 | ||
| 2. Kapitel: Zur Präzisierung des Planfeststellungsrechts durch das BVerwG | 26 | ||
| A. Die hohe Abstraktheit der gesetzlichen Vorschriften | 26 | ||
| B. Die Verringerung der Abstraktionshöhe durch die Rechtsprechung des BVerwG | 26 | ||
| I. Möglichkeiten und Grenzen einer Bezugnahme auf das Bauplanungsrecht | 27 | ||
| 1. Beachtung der Verschiedenheit der Sachbereiche | 27 | ||
| 2. Beachtung der Verschiedenheit der gesetzlichen Regelungsgefuge | 28 | ||
| 3. Die Folgerungen des BVerwG | 30 | ||
| II. Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Systems der Rechtsprechung als eine Aufgabe dieser Untersuchung | 34 | ||
| C. Zusammenfassung | 35 | ||
| 3. Kapitel: Planerische Gestaltungsfreiheit | 36 | ||
| A. Abgrenzung vom und Verwandtschaft zum Ermessen? | 36 | ||
| I. Normstruktur als äußerliches Unterscheidungskriterium? | 36 | ||
| 1. Konditionalprogramme | 37 | ||
| 2. Zweckprogramme | 37 | ||
| II. Tauglichkeit der Normstruktur als Unterscheidungskriterium? | 37 | ||
| B. Vorläufige Inhaltsbeschreibung | 41 | ||
| C. Zusammenfassung | 42 | ||
| 4. Kapitel: Die Grenzen der planerischen Gestaltungsfreiheit | 44 | ||
| A. Die Entwicklung eines Schrankensystems durch das BVerwG | 44 | ||
| B. Formelle Schranken | 46 | ||
| I. Begriff | 46 | ||
| II. Planungsfreiheitsbeschränkende oder -erweiternde Funktion formeller Schranken? | 48 | ||
| III. Eignung formeller Schranken zur Beschränkung einer Planungsbefugnis? | 50 | ||
| 1. Positive Gesichtspunkte | 50 | ||
| a. Zur erfahrungsbildenden Wirkung von Verfahrensvorschriften | 50 | ||
| b. Einfache Struktur von Verfahrensnormen | 51 | ||
| c. Zur verfassungsrechtlich bedingten Entlastung des BVerwG | 52 | ||
| 2. Nachteile beim derzeitigen Stand der Entwicklung formeller Schranken | 53 | ||
| a. Die Schwierigkeit der Abgrenzung zwischen Verwaltungsverfahrensrecht und materiellem Verwaltungsrecht | 53 | ||
| b. Die mit der sog. Konzentrationswirkung verbundenen Probleme | 57 | ||
| c. Selbständige gerichtliche Kontrolle nur der das Verfahren beendenden Verwaltungsentscheidung | 63 | ||
| aa. Verfahrensstufung durch die dem Planfeststellungsverfahren vorausgehenden Zwischenentscheidungen | 65 | ||
| (1) Die Linienführungsbestimmungen nach §§ 16 FStrG und 13 WaStrG — Zulässigkeit einer Feststellungsklage | 66 | ||
| (a) Fehlendes Außenrechtsverhältnis? | 68 | ||
| (b) Erfordernis unmittelbarer Außenwirkung? | 70 | ||
| (c) Konkretheit des Rechtsverhältnisses | 73 | ||
| (d) Feststellungsinteresse | 77 | ||
| (e) Subsidiarität der Feststellungsklage | 78 | ||
| (f) „Vorbereitender Charakter" der Linienführungsbestimmung | 79 | ||
| (g) Ähnlichkeiten mit dem Flächennutzungsplan? | 82 | ||
| (h) Vorzüge der Feststellungsklage | 84 | ||
| (2) Die luftverkehrsrechtliche Unternehmergenehmigung nach § 6 LuftVG — Zulässigkeit einer Feststellungsklage | 86 | ||
| (a) Verwaltungsaktscharakter, insbesondere die Gerichtetheit auf unmittelbare Außenwirkung | 88 | ||
| (b) Ansatzpunkte für frühzeitige Kontrolle | 92 | ||
| (c) Klagebefugnis i. S. v. § 42 Abs. 2 VwGO für Anfechtungsklage Dritter? | 92 | ||
| (d) Feststellungsklage Dritter zur Überprüfung des durch die Genehmigung geschaffenen Rechtsverhältnisses | 104 | ||
| (3) Die Unternehmergenehmigung nach dem PBefG | 107 | ||
| (4) Die Genehmigung nach §14 Abs. 3 S. 1 lit c BbG | 109 | ||
| (5) Die Abfallentsorgungspläne nach § 6 AbfG | 109 | ||
| (6) Der Wege- und Gewässerplan nach § 41 FlurbG | 113 | ||
| bb. Verfahrensstufung durch Zwischenentscheidungen innerhalb des Planfeststellungsverfahrens | 120 | ||
| d. Kein generell drittschützender Charakter von Verfahrensnormen | 123 | ||
| IV. Zusammenfassung | 127 | ||
| C. Materielle Schranken | 128 | ||
| I. Die Schranke der Planrechtfertigung | 130 | ||
| 1. Einleitende Übersicht über die Konzeption des BVerwG | 130 | ||
| 2. Erwägungen zur Methodenwahl für die weitere Untersuchung | 133 | ||
| a. Planrechtfertigung und Subsumtion | 133 | ||
| b. Zur angeblichen Untauglichkeit der Subsumtionsmethode im Planungsrecht | 134 | ||
| 3. Vom methodischen Ausgangspunkt zur Gewinnung der sachlichen Ausgangsthese | 136 | ||
| a. Die Einordnung des Begriffs der Planrechtfertigung in das deduktive Begründungsmodell | 136 | ||
| b. Entwicklung der Planrechtfertigung durch das BVerwG mittels verfassungsrechtsorientierter Auslegung? | 137 | ||
| c. Die Formulierung der These zur Planrechtfertigung | 141 | ||
| 4. Die Überprüfung der These | 141 | ||
| a. Verfassungsrechtlicher Hintergrund | 142 | ||
| aa. Verfassungsrechtliche Motive für ein Erfordernis der Planrechtfertigung? | 142 | ||
| (1) Die Auffassung von Winter | 143 | ||
| (2) Die Auffassung des BVerwG | 143 | ||
| bb. Rechtsstaatsprinzip, Vorbehalt des Gesetzes und Planrechtfertigung | 144 | ||
| (1) Das Rechtsstaatsprinzip | 145 | ||
| (2) Der Vorbehalt des Gesetzes | 145 | ||
| b. Die Wortsinnauslegung der vom BVerwG herangezogenen Planfeststellungsvorschriften | 149 | ||
| aa. Betrachtung des Wortlauts der vom BVerwG genannten Normen anhand von Beispielen | 149 | ||
| (1) Fernstraßenrechtliche Planfeststellung | 149 | ||
| (2) Luftverkehrsrechtliche Planfeststellung | 150 | ||
| (3) Wasserstraßenrechtliche Planfeststellung | 150 | ||
| (4) Wasserrechtliche Planfeststellung | 150 | ||
| (5) Abfallrechtliche Planfeststellung | 151 | ||
| (6) Bundesbahnrechtliche Planfestellung | 151 | ||
| (7) Personenbeförderungsrechtliche Planfeststellung | 152 | ||
| (8) Flurbereinigungsrechtliche Planfeststellung | 152 | ||
| bb. Zum naheliegenden Verständnis des Wortlauts | 152 | ||
| cc. Zum sprachlich möglichen Wortsinn | 156 | ||
| c. Systematische Auslegung | 157 | ||
| aa. Ermächtigungen zu Grundrechtseingriffen durch Planung außerhalb der Fachplanfeststellungsgesetze? | 158 | ||
| (1) Der Erforderlichkeitsgrundsatz | 158 | ||
| (2) Die Planfeststellungsvorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze | 159 | ||
| (3) Zur Ausschlußwirkung des §75 Abs. 2 VwVfG und zur Bestandskraft von Verwaltungsakten | 160 | ||
| (4) Das Bundesfernstraßenausbaugesetz | 163 | ||
| (5) Das Allgemeine Eisenbahngesetz | 165 | ||
| bb. Anderweitige Ermächtigungsgrundlagen innerhalb der Fachplanfeststellungsgesetze | 166 | ||
| (1) Ermächtigungsgrundlagencharakter der eine Verfahrensstufung vorsehenden Normen der Fachplanungsgesetze | 166 | ||
| (2) Ermächtigungsgrundlagencharakter der Aufgabennormen der Fachplanungsgesetze | 168 | ||
| (3) Die die flurbereinigungsrechtliche Eingriffsermächtigung bildenden Vorschriften | 169 | ||
| d. Zur teleologischen Auslegung | 169 | ||
| 5. Die Vereinbarkeit des Planrechtfertigungserfordernisses mit dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot | 171 | ||
| a. Die Präzisierung der Voraussetzungen der Planrechtfertigung | 172 | ||
| aa. Die mit dem Fachplanungsgesetz allgemein verfolgten Ziele | 174 | ||
| bb. Das Bedürfnis | 176 | ||
| b. Besteht ein Entscheidungsfreiraum der Verwaltung bei der Ermittlung der Planrechtfertigung, der von den Gerichten nur eingeschränkt überprüfbar ist? | 178 | ||
| II. Die Schranke der Planungsleitsätze | 181 | ||
| 1. Der Begriff des Planungsleitsatzes in der Rechtsprechung des BVerwG | 181 | ||
| 2. Die Wirkung der Planungsleitsätze als Schranken der planerischen Gestaltungsfreiheit | 183 | ||
| 3. Die Ermittlung von Planungsleitsätzen | 183 | ||
| 4. Die verschiedenen Arten von Planungsleitsätzen | 185 | ||
| a. Interne und externe Planungsleitsätze | 185 | ||
| b. Sonstige Differenzierungen | 186 | ||
| c. Einzelne Planungsleitsätze | 186 | ||
| 5. Vermindert die begriffliche „Richtigstellung" im Urteil v. 22.3.1985 die Wirksamkeit der Planungsleitsätze als Schranke planerischer Gestaltungsfreiheit? | 187 | ||
| 6. Die Schranke der Planungsleitsätze als spezifische Ausprägung des Grundsatzes vom Vorrang des Gesetzes | 191 | ||
| III. Spezielle fachplanungsgesetzimmanente Schranken planerischer Gestaltungsfreiheit | 192 | ||
| 1. Die in den einzelnen Fachplanungsgesetzen vorgesehenen Zwischenentscheidungen | 192 | ||
| 2. Sonstige spezielle fachplanungsgesetzimmanente Schranken? | 193 | ||
| 3. Zur Tauglichkeit der speziellen fachplanungsgesetzimmanenten Schranken für die Begrenzung planerischer Gestaltungsfreiheit | 195 | ||
| a. Die Linienführungsbestimmungen | 196 | ||
| b. Die luftverkehrsrechtliche Unternehmergenehmigung | 203 | ||
| c. Die Unternehmergenehmigung nach dem PBefG | 204 | ||
| d. Die Genehmigung nach § 14 Abs. 3 S. 1 lit c BbG | 205 | ||
| e. Die Abfallentsorgungspläne | 205 | ||
| f. Der Flurbereinigungsbeschluß und der Wege- und Gewässerplan | 206 | ||
| 4. Zusammenfassung | 211 | ||
| IV. Die Schranke des fachplanerischen Abwägungsgebots | 212 | ||
| 1. Die Abwägung als Methode der Rechtsfindung | 212 | ||
| 2. Die Entwicklung des fachplanerischen Abwägungsgebots durch das BVerwG | 214 | ||
| 3. Die Abwägungsfehler als Kontrollkriterien des fachplanerischen Abwägungsgebots | 215 | ||
| 4. Zur Ähnlichkeit von Abwägungsfehlerarten und Ermessensfehlerarten | 216 | ||
| a. Gemeinsamkeiten | 216 | ||
| aa. Ermessensnichtgebrauch — Abwägungsausfall | 217 | ||
| bb. Ermessensfehlgebrauch — Abwägungsdefizit und -fehleinschätzung | 217 | ||
| cc. Ermessensüberschreitung — Abwägungsüberschreitung | 218 | ||
| b. Unterschiede | 218 | ||
| c. Zusammenfassende Bewertung | 220 | ||
| 5. Zur Bedeutung des Abwägungsausfalls | 221 | ||
| 6. Die Bedeutung des Abwägungsdefizits | 222 | ||
| a. Die Notwendigkeit präziser Vorgaben zur Feststellung der Abwägungserheblichkeit von Belangen | 222 | ||
| b. Die Vorgehensweise zur Bestimmung der Betroffenheit von Belangen | 223 | ||
| c. Zur inhaltlichen Bestimmung des Abwägungsmaterials | 229 | ||
| aa. Die Unterscheidung öffentlicher und privater Belange | 229 | ||
| bb. Öffentliche Belange | 230 | ||
| cc. Private Belange | 231 | ||
| dd. Nicht zu den abwägungserheblichen Belangen gehörende Positionen | 237 | ||
| ee. Vorteile der Systematisierung einzelner Belange | 239 | ||
| ff. Die Bedeutung des Begriffs des Belangs für den subjektiven Rechtsschutz | 240 | ||
| gg. Der Begriff des Berührens (Betroffenseins) | 243 | ||
| hh. Zusammenfassung | 248 | ||
| 7. Zur Bedeutung der Abwägungsfehleinschätzung | 248 | ||
| a. Kriterien zur Feststellung der „objektiven Gewichtigkeit" eines Belangs | 252 | ||
| aa. Bezugnahme des BVerwG auf Wertentscheidungen des Gesetzgebers als objektive Gewichtungsmaßstäbe | 252 | ||
| bb. Weitere Gewichtungsmaßstäbe | 254 | ||
| b. Fehlerhafte behördliche Gewichtung von Belangen | 255 | ||
| c. Fehlerhafter behördlicher Ausgleich von Belangen | 256 | ||
| aa. Verhältnismäßigkeitsprinzip | 257 | ||
| bb. Gebot der Rücksichtnahme | 257 | ||
| cc. Gebot der Konfliktbewältigung | 260 | ||
| dd. Auflagengebote als besondere Abwägungsgrenzen | 263 | ||
| 8. Die Unterscheidung von Abwägungsvorgang und Abwägungsergebnis | 266 | ||
| a. Die Argumentation des BVerwG | 266 | ||
| b. Zur Berechtigung der Differenzierung für die gerichtliche Kontrolle | 268 | ||
| 5. Kapitel: Schluß | 273 | ||
| Literaturverzeichnis | 274 | ||
| Fundstellen der Veröffentlichungen zitierter BVerwG-Entscheidungen | 288 |
