Erwartungen und ökonomische Theoriebildung:
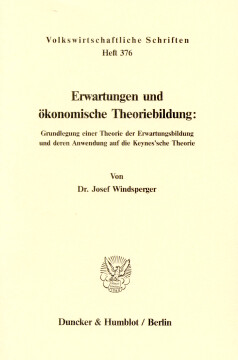
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Erwartungen und ökonomische Theoriebildung:
Grundlegung einer Theorie der Erwartungsbildung und deren Anwendung auf die Keynes'sche Theorie
Volkswirtschaftliche Schriften, Vol. 376
(1988)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Verzeichnis der Abbildungen | 17 | ||
| Einleitung und Problemstellung | 19 | ||
| 1. Teil: Theorie der Erwartungsbildung | 28 | ||
| 1. Kapitel: Erwartungsbildung und Unsicherheit in der ökonomischen Literatur | 28 | ||
| 1.1. Quasivollständige Information | 28 | ||
| 1.2. Unvollständige Information | 29 | ||
| 1.2.1. „Unsicherheit" bei Knight | 29 | ||
| 1.2.2. Erwartungen und Unsicherheit bei Keynes | 30 | ||
| 1.2.3. Das Konzept der „potential surprise" von Shackle | 31 | ||
| 1.2.4. Die Verläßlichkeitstheorie von Heiner | 32 | ||
| 1.3. Beurteilung der Ansätze bei unvollständiger Information | 33 | ||
| 2. Kapitel: Erkenntnistheoretische Einbettung der Erwartungsbildung | 35 | ||
| 2.1. Was ist objektives Wissen? | 35 | ||
| 2.2. Welche Beziehung besteht zwischen der realen und der subjektiven Welt | 36 | ||
| 2.2.1. Aufbau der realen Welt | 36 | ||
| 2.2.2. Aufbau der subjektiven Welt | 37 | ||
| 2.2.3. Partielle Isomorphie zwischen subjektiver und realer Welt | 38 | ||
| 2.2.3.1. Partielle Isomorphie zwischen Erkenntnis- und Seinskategorien | 38 | ||
| 2.2.3.2. Adäquate Repräsentation der realen Welt im Subjekt bzw. Kenntnis der „relevanten" Tatsachen | 39 | ||
| 2.3. Kreislauftheorie der Erkenntnisgewinnung | 41 | ||
| 2.3.1. Gewinnung von subjektivem Wissen | 41 | ||
| 2.4. Die einzelnen Schritte der Erwartungsbildung im Überblick | 45 | ||
| 3. Kapitel: Theorie der vorwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung | 47 | ||
| 3.1. Umwelt und Wahrnehmung | 47 | ||
| 3.1.1. Exkurs: Theorie der Informationsentnahme von Gibson | 47 | ||
| 3.1.1.1. Theorie der Angebote | 47 | ||
| 3.1.1.2. Theorie der Informationsentnahme | 48 | ||
| 3.1.2. Wahrnehmung der sozialen und wirtschaftlichen Umwelt | 49 | ||
| 3.1.2.1. Umweltbegriff | 49 | ||
| 3.1.2.2. Theorie der Informationsentnahme | 49 | ||
| 3.1.2.2.1. Wahrnehmung einer komplexen Umwelt | 51 | ||
| 3.1.2.2.2. Wahrnehmung einer sich ändernden Umwelt | 53 | ||
| 3.1.2.3. Vollständigkeitsgrad der Wahrnehmungen | 54 | ||
| 3.1.2.4. Konvergente Wahrnehmungen | 57 | ||
| 3.2. Modellkonstruktion | 57 | ||
| 3.2.1. „Going Beyond the Information Given" | 57 | ||
| 3.2.2. Modellkonstruktion und Umweltkomplexität | 61 | ||
| 3.2.3. Modellkonstruktion und Umweltveränderung | 61 | ||
| 4. Kapitel: Theorie der Prognose | 63 | ||
| 4.1. Ermittlung der Erwartungsgrößen aus dem Modell | 63 | ||
| 4.2. Der Grad des Vertrauens | 65 | ||
| 4.2.1. Definition | 65 | ||
| 4.2.2. Bestimmungsfaktoren des Grades des relevanten Wissens | 66 | ||
| 4.2.3. Erfassung des Grades des relevanten Wissens durch den Grad des Vertrauens | 66 | ||
| 4.2.3.1. Stabilitätsgrad der wahrgenommenen Umwelt in bezug auf den Zeitpunkt der Erwartungsbildung | 67 | ||
| 4.2.3.2. Stabilitätsgrad der wahrgenommenen Umwelt in bezug auf den Planungshorizont | 68 | ||
| 4.2.4. Operationalisierung des Vertrauensfaktors durch Risikokosten | 71 | ||
| 4.2.5. Vertrauenseffekte der Marktergebnisse | 71 | ||
| 4.2.6. Konsistentes Verhalten, Stabilität der wahrgenommenen Umwelt und Grad des Vertrauens | 72 | ||
| 4.2.7. Vertrauenswirkungen von Ankündigungsstrategien | 73 | ||
| 4.2.7.1. Einmalige Ankündigungen | 73 | ||
| 4.2.7.2. Mehrmalige Ankündigungen | 74 | ||
| 4.3. Konvergente Erwartungen | 74 | ||
| 5. Kapitel: Lernprozeß und Erwartungsänderung | 76 | ||
| 5.1. Inadäquanz der Bayes'schen Regel | 76 | ||
| 5.2. Der Lernzyklus | 77 | ||
| 5.2.1. Aufdeckung von neunen Informationen über die Umwelt | 77 | ||
| 5.2.2. Verarbeitung von neuen Informationen | 78 | ||
| 5.2.3. Abgrenzung des Suchfeldes | 78 | ||
| 5.2.4. Determinanten der Suchintensität | 79 | ||
| 5.3. Lernprozeß in einer konstanten Umwelt | 81 | ||
| 5.3.1. Erwartungsänderung im Laufe des Lernprozesses | 82 | ||
| 5.4. Lernprozeß und Erwartungsrevision bei Umweltveränderung | 83 | ||
| 5.4.1. Gleichbleibende Umweltstabilität | 84 | ||
| 5.4.2. Stabilisierung der Umwelt | 86 | ||
| 5.4.3. Destabilisierung der Umwelt | 86 | ||
| 5.5. Anpassungsdauer und Lernprozeß | 87 | ||
| 5.6. Erwartungsgrößen- und Vertrauenseffekt bei Auftreten von neuen Informationen | 88 | ||
| 6. Kapitel: Erläuterung des Erwartungsbildungskonzeptes am Beispiel der Wirtschaftspolitik | 90 | ||
| 6.1. Wahrnehmung der Wirtschaftspolitik als investitionsbeeinflussender Umweltfaktor | 90 | ||
| 6.2. Modellkonstruktion und Erwartungsbildung | 91 | ||
| 6.3. Erwartungseffekte bei Änderung der wirtschaftspolitischen Strategie | 92 | ||
| 6.3.1. Gleichbleibender Stabilitätsgrad der Teilumwelt „Wirtschaftspolitik" | 92 | ||
| 6.3.2. Stabilisierung der Teilumwelt „Wirtschaftspolitik" | 93 | ||
| 6.3.3. Destabilisierung der wirtschaftspolitischen Umwelt | 94 | ||
| 7. Kapitel: Exkurs: Einbettung der Erwartungsbildung in eine Theorie der Entscheidung und Handlung | 96 | ||
| 7.1. Erwartungsbildung und Entscheidung | 96 | ||
| 7.2. Erwartungsbildung — Entscheidung — Handlung | 99 | ||
| II Teil: Erwartungen in Keynes Theorie | 102 | ||
| Abschnitt A: Methodologische Überlegungen zur ökonomischen Theoriebildung | 102 | ||
| 1. Kapitel: Allgemeinheitsgrad der Keynes'schen und allgemeinen Gleichgewichtstheorie | 103 | ||
| 1.1. Einleitende Bemerkungen | 103 | ||
| 1.2. Allgemeinheitsgrad einer Theorie | 104 | ||
| 1.3. Allgemeinheitsgrad der Wirtschaftstheorie | 105 | ||
| 1.3.1. Makroökonomische Gleichgewichtstheorie | 105 | ||
| 1.3.2. Keynes' „General Theory | 107 | ||
| 2. Kapitel: Erwartungen und Unterbeschäftigungsgleichgewicht — ex ante und ex post | 110 | ||
| 2.1. Zusammenhang zwischen Erwartungen und Plänen | 110 | ||
| 2.2. Individuelles, Markt- und gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht bzw. Ungleichgewicht | 111 | ||
| 2.2.1. Gleichgewicht | 111 | ||
| 2.2.1.1. Ex ante Gleichgewicht | 111 | ||
| 2.2.1.2. Ex post Gleichgewicht | 111 | ||
| 2.2.2. Ungleichgewicht | 112 | ||
| 2.2.2.1. Ex ante Ungleichgewicht | 112 | ||
| 2.2.2.2. Ex post Ungleichgewicht | 112 | ||
| 2.3. Beziehung zwischen Erwartungsgleichgewicht bzw. -Ungleichgewicht und gesamtwirtschaftlichem Ungleichgewicht ex post | 112 | ||
| 2.3.1. Vom Erwartungsgleichgewicht zum gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewicht ex post | 112 | ||
| 2.3.2. Vom Erwartungsungleichgewicht zum gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewicht ex post | 113 | ||
| 2.4. Keynes'sches Unterbeschäftigungsgleichgewicht ex post | 114 | ||
| 2.4.1. Gründe für das Auftreten eines Angebotsüberschusses auf dem Arbeitsmarkt | 114 | ||
| 2.4.2. Bedingungen für das Zustandekommen eines makroökonomischen Güter-, Geld- und Wertpapiermarktgleichgewichtes | 114 | ||
| 3. Kapitel: Erwartungen und Periodenabgrenzung | 116 | ||
| 3.1. Die „kurze" Periode | 116 | ||
| 3.1.1. Die „kurze" Periode in der IS-LM Analyse | 116 | ||
| 3.1.2. Die „kurze" Periode in der Keynes'schen Theorie | 117 | ||
| 3.2. Die „lange" Periode | 118 | ||
| 3.2.1. Erwartungsänderungen aufgrund der Änderung der exogenen Umwelt — Änderung des Erwartungszustandes | 118 | ||
| 3.2.2. Erwartungsänderung aufgrund endogener Datenänderungen im Konjunkturverlauf | 120 | ||
| 3.3. Schlußbemerkungen | 120 | ||
| Abschnitt Β: Erwartungen im Kreislaufzusammenhang | 122 | ||
| 4. Kapitel: Der Einfluß der Erwartungen auf Investitionen, Konsum und Liquiditätspräferenz | 122 | ||
| 4.1. Einleitende Bemerkungen | 122 | ||
| 4.2. Erwartungen im Kreislaufzusammenhang | 123 | ||
| 4.2.1. Erwartungen und Investitionen | 123 | ||
| 4.2.2. Erwartungen und Liquiditätspräferenz | 125 | ||
| 4.2.3. Erwartungen und Konsumnachfrage | 125 | ||
| 4.3. Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen von Erwartungsänderungen | 126 | ||
| 4.3.1. SpilloverefFekte zwischen Güter- und Geldmarkt | 126 | ||
| 4.3.2. Gesamtwirtschaftliche Effekte von konvergenten Erwartungsänderungen | 127 | ||
| 4.3.3. Gesamtwirtschaftliche Effekte von divergenten Erwartungsänderungen | 128 | ||
| 4.4. Abschließende Bemerkungen | 130 | ||
| 5. Kapitel: Geldangebot und Erwartungen | 131 | ||
| 5.1. Einleitung | 131 | ||
| 5.2. Analyse des endogenen Geldangebotsprozesses | 132 | ||
| 5.2.1. Theorie der Liquiditätspräferenz der Geschäftsbanken | 132 | ||
| 5.2.1.1. Transaktionskassenhaltung | 133 | ||
| 5.2.1.2. Spekulationskassenhaltung | 133 | ||
| 5.2.2. Endogener Geldangebotsprozeß | 133 | ||
| 5.2.2.1. Ein Wertpapiermarkt als Kreditmarkt und Sichteinlagen | 133 | ||
| 5.2.2.2. Zwei Wertpapiermärkte (kurz- und langfristige) und Sichteinlagen | 136 | ||
| 5.2.2.3. Zwei Wertpapiermärkte als Kreditmärkte, ein Interbankengeldmarkt und Sicht sowie Spareinlagen | 137 | ||
| 5.3. Geldangebot und Erwartungen | 138 | ||
| 5.3.1. Exogenes Geldangebot und Erwartungen | 139 | ||
| 5.3.2. Endogenes Geldangebot und Erwartungen | 139 | ||
| 5.3.2.1. Ein Wertpapiermarkt und Sichteinlagen | 140 | ||
| 5.3.2.2. Zwei Wertpapiermärkte und eine Einlagenmöglichkeit | 142 | ||
| 5.3.2.3. Zwei Wertpapiermärkte, ein Interbankengeldmarkt und zwei Einlagemöglichkeiten | 142 | ||
| 5.4. Schlußbemerkungen | 144 | ||
| 6. Kapitel: Zinsrigiditäten und Unsicherheit | 145 | ||
| 6.1. Zinsrigidität bei gegebenen Erwartungen | 145 | ||
| 6.2. Zinsrigidität aufgrund unsicherer Erwartungen | 147 | ||
| 6.3. Abschließende Bemerkungen | 148 | ||
| 7. Kapitel: Erwartungen und die Beziehung zwischen Sparen und Investieren | 150 | ||
| 7.1. Einleitung | 150 | ||
| 7.2. Die Beziehung zwischen Sparen und Investieren | 150 | ||
| 7.2.1. Deflatorische Beziehung zwischen Sparen, Investieren und Horten | 150 | ||
| 7.2.2. Die individuellen Bestimmungsgründe des Sparens und Investierens | 151 | ||
| 7.2.2.1. Theorie des Sparens | 151 | ||
| 7.2.2.1.1. Sparentscheidung | 152 | ||
| 7.2.2.1.2. Portefeuilleentscheidung | 152 | ||
| 7.2.2.2. Die individuellen Bestimmungsgründe des Investierens | 153 | ||
| 7.2.3. Ex ante und ex post Gleichgewicht zwischen Sparen und Investieren | 153 | ||
| 7.2.3.1. Definition von ex ante und ex post Gleichgewicht | 153 | ||
| 7.2.3.2. Unter welchen Informationsbedingungen kann ein ex post Gleichgewicht zwischen Sparen und Investieren realisiert werden? | 154 | ||
| 7.2.3.3. Periodenlänge zwischen ex ante und ex post Gleichgewicht zwischen Sparen und Investieren | 154 | ||
| 7.2.3.3.1. Interne Betrachtungsweise | 154 | ||
| 7.2.3.3.2. Externe Betrachtungsweise | 155 | ||
| 7.2.3.3.3. Beziehung zwischen interner und externer Betrachtungsweise | 156 | ||
| 7.2.3.4. Beziehung zwischen ex post Gleichgewicht und ex post Ausgleich zwischen Sparen und Investieren | 157 | ||
| 7.2.3.4.1. Exogene Geldmenge und kein Enthorten | 157 | ||
| 7.2.3.4.2. Exogene Geldmenge und Enthorten aus dem Vermögensbestand | 158 | ||
| 7.2.3.4.3. Endogene Geldmenge und Nettoenthorten | 159 | ||
| 7.3. Der Einfluß der Erwartungen auf Sparen und Investieren | 160 | ||
| 7.3.1. Anpassungsprozeß bei Verbesserung der Erwartungen | 160 | ||
| 7.3.2. Die Beziehung zwischen Sparen und Investieren während des Anpassungsprozesses | 163 | ||
| 7.4. Exkurs: Beziehung zwischen Sparen und Investieren in der klassischen Theorie, der Sequenzanalyse der Schwedischen Schule und der Keynes'- schen Theorie | 166 | ||
| 7.4.1. Klassische Theorie | 166 | ||
| 7.4.2. Sequenzanalyse der Schwedischen Schule | 167 | ||
| 7.4.3. Keynes'sche Theorie | 168 | ||
| 7.5. Schlußbemerkungen | 169 | ||
| Abschnitt C: Erwartungen und Wirtschaftspolitik | 171 | ||
| 8. Kapitel: Die Vertrauenseffekte der Wirtschaftspolitik | 171 | ||
| 8.1. Einleitende Bemerkungen | 171 | ||
| 8.2. Die drei Vertrauenseffekte der Wirtschaftspolitik | 172 | ||
| 8.2.1. Ankündigungseffekt der Wirtschaftspolitik | 173 | ||
| 8.2.2. Einsatzeffekt der Wirtschaftspolitik | 173 | ||
| 8.2.3. Die Beziehung zwischen Ankündigungs- und Einsatzeffekt | 173 | ||
| 8.2.4. Wirkungseffekt der Wirtschaftspolitik | 174 | ||
| 8.3. Langfristige Wirtschaftspolitik und Effizienz der kurzfristigen Maßnahmen | 175 | ||
| 8.3.1. Positive Vertrauenseffekte durch langfristig konsistente Wirtschaftspolitik | 175 | ||
| 8.3.2. Politikversagen und Stabilisierung der Marktschwankungen durch kurzfristige wirtschaftspolitische Eingriffe | 176 | ||
| 8.3.3. Häufigkeit und Ausmaß von kurzfristigen wirtschaftspolitischen Eingriffen | 177 | ||
| 8.3.4. Inkonsistente langfristige wirtschaftspolitische Strategie | 178 | ||
| 8.4. Erwartungsgrößeneffekt der Wirtschaftspolitik | 179 | ||
| 8.5. Schlußbetrachtungen | 180 | ||
| Abschnitt D: Dynamische Makrotheorie | 181 | ||
| 9. Kapitel: Erwartungsänderungen und makroökonomischer Anpassungsprozeß: Bausteine einer dynamischen Makrotheorie | 181 | ||
| 9.1. Einleitung | 181 | ||
| 9.2. Konvergente Erwartungsänderungen und langfristiges Unterbeschäftigungsgleichgewicht | 182 | ||
| 9.2.1. Konvergente Erwartungsänderung | 182 | ||
| 9.2.2. Langfristiges Unterbeschäftigungsgleichgewicht als Fließgleichgewicht | 183 | ||
| 9.3. Komponenten des makroökonomischen Anpassungsprozesses | 185 | ||
| 9.3.1. Mikroökonomischer Anpassungsprozeß | 185 | ||
| 9.3.1.1. Informationsverarbeitungsprozeß | 185 | ||
| 9.3.1.2. Mikroökonomischer Marktanpassungsprozeß | 185 | ||
| 9.3.2. Kreislaufprozeß | 186 | ||
| 9.4. Analyse der Dynamik des Anpassungsprozesses | 187 | ||
| 9.4.1. Phasen des Lernprozesses und Gruppenprozesse | 187 | ||
| 9.4.1.1. Phasen des Lernprozesses | 187 | ||
| 9.4.1.1.1. Gleichbleibende Umweltstabilität | 187 | ||
| 9.4.1.1.2. Stabilisierung der Umwelt | 188 | ||
| 9.4.1.1.3. Destabilisierung der Umwelt | 188 | ||
| 9.4.1.2. Gruppenprozesse | 188 | ||
| 9.4.1.3. Zusammenhang zwischen Phasen des Lernprozesses und Gruppenprozessen | 189 | ||
| 9.4.1.3.1. Anpassungsprozeß bei Umweltstabilisierung | 190 | ||
| 9.4.2. Anpassungsprozeß bei Erhöhung des Grades des Vertrauens | 193 | ||
| 9.4.2.1. Zeitliche Struktur des Anpassungsprozesses | 196 | ||
| 9.4.3. Anpassungsprozeß bei Verminderung des Grades des Vertrauens | 197 | ||
| 9.5. Schlußbemerkungen | 198 | ||
| Abschnitt Ε: Dynamische Makro- versus Koqjunkturtheorie | 200 | ||
| 10. Kapitel: Die Rolle der Erwartungen in der Makro- und Konjunkturtheorie | 200 | ||
| 10.1. Einleitung | 200 | ||
| 10.2. Makrotheorie | 201 | ||
| 10.2.1. Makrotheorie als Struktur- bzw. statische Analyse | 201 | ||
| 10.2.2. Makrotheorie als Prozeß- oder dynamische Analyse | 201 | ||
| 10.3. Konjunkturtheorie als Prozeß- bzw. dynamische Analyse | 203 | ||
| 10.3.1. Ursachen der Konjunkturschwankungen | 204 | ||
| 10.3.2. Konjunkturschwankungen als endogen verursachte „Wellenbewegung des Wirtschaftslebens" | 207 | ||
| 10.4. Schlußbemerkungen | 212 | ||
| Zusammenfassung und Schlußbetrachtung | 214 | ||
| Literaturangaben | 218 |
