Korporation und Assoziation
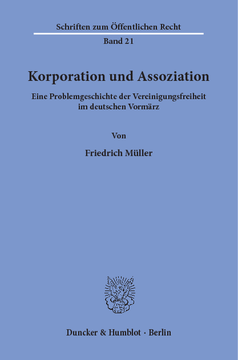
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Korporation und Assoziation
Eine Problemgeschichte der Vereinigungsfreiheit im deutschen Vormärz
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 21
(1965)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung: Geschichtliche und methodische Abgrenzung des Themas | 15 | ||
| A. Begriffsbestimmungen | 15 | ||
| I. Korporation, Assoziation, Vereinigungsfreiheit | 15 | ||
| II. Korporation und Verein als rechtsgeschichtliche Typen | 17 | ||
| B. Geschichtliche Abgrenzung des Themas | 18 | ||
| I. Das Vereinswesen im Mittelalter | 18 | ||
| II. Die Vereinsfrage in der Neuzeit | 21 | ||
| 1. Reformatorische Staatslehren und Vereinsfreiheit | 21 | ||
| 2. Die covenant-Lehre und die Vereinsfreiheit in England und Nordamerika vor ihrem rechtlichen und geistesgeschichtlichen Hintergrund | 24 | ||
| 3. Die Entwicklung auf dem Kontinent | 34 | ||
| C. Der Gegenstand der Arbeit | 38 | ||
| I. Beschränkung auf Grundfragen. Zeitliche Abgrenzung | 38 | ||
| II. Elemente einer Problemgeschichte | 39 | ||
| Erstes Kapitel: Rousseau und die Revolution: Die Unterdrückung aller Teilverbände | 42 | ||
| A. Einleitung: Keine Analogie von Gesamtverband und Teilverband | 42 | ||
| B. Exkurs: Die anthropologische und staatsphilosophische Grundlage der Rousseauschen Vereinslehre | 44 | ||
| I. Zur Anthropologie | 44 | ||
| 1. Der Naturzustand | 44 | ||
| 2. Der Abfall vom Naturzustand | 46 | ||
| 3. Das Wesen des ,Abfalls' | 48 | ||
| 4. Möglichkeiten der Heilung der menschlichen Natur | 52 | ||
| II. Staatstheorie | 54 | ||
| 1. Der Gesellschaftsvertrag | 54 | ||
| 2. Aliénation totale und volonté générale | 58 | ||
| C. Rousseaus Vereinslehre | 61 | ||
| I. Volonté générale, aliénation totale und Vereinslehre | 61 | ||
| 1. Volonté générale und Vereinslehre | 61 | ||
| 2. Aliénation totale und Vereinslehre | 63 | ||
| II. ,Statik' und ,Dynamik' des Staatsbildes in bezug auf die Vereinslehre | 65 | ||
| 1. ,Statik' und ,Dynamik' | 65 | ||
| 2. Sitten und Volksmeinung | 68 | ||
| III. Vereinigungsfreiheit und Freiheitsbegriff | 70 | ||
| 1. Zu Rousseaus Freiheitsbegriff | 70 | ||
| 2. Rousseaus Abstand zum Liberalismus: Montesquieu | 72 | ||
| 3. Individualismus und Vereinslehre | 73 | ||
| IV. Rousseaus praktische Stellungnahme zu den Vereinigungen | 75 | ||
| 1. Praktische Behandlung vorhandener Einzel verbände | 75 | ||
| 2. Keine Analogie zu den corps intermédiaires der Regierung | 78 | ||
| V. Bewertung von Rousseaus Vereinsfeindlichkeit | 79 | ||
| VI. Zur geschichtlichen Wirkung von Rousseaus Vereinslehre bis zur Revolution | 82 | ||
| Zweites Kapitel: Die Verbandslehre der Romantik und der Restauration | 86 | ||
| A. Grundlagen der romantischen Verbandslehre | 86 | ||
| I. Politische Position und allgemeines Staatsbild der deutschen Romantik im Hinblick auf die Vereinigungsfreiheit | 86 | ||
| 1. Französische Revolution, Liberalismus | 87 | ||
| 2. Zur Machbarkeit von Recht und Staat | 88 | ||
| 3. Geschichtsbegriff, Die Rolle der Religion, Verhältnis von Ganzem und Einzelnem | 90 | ||
| 4. Einflüsse auf die deutsche Romantik, Grundlinien der ständestaatlichen Konzeption | 93 | ||
| II. Die Organismus-Lehre in bezug auf die Vereinigungsfreiheit | 95 | ||
| 1. Kant, Fichte, Schelling | 95 | ||
| 2. Kosmologische Ableitungen bei Baader und Görres | 97 | ||
| 3. Kritik an der ungenauen Fassung des Organismus-Begriffs | 98 | ||
| 4. Stahl | 100 | ||
| 5. Bonté naturelle, Gleichheit | 102 | ||
| III. Weitere Vorbereitung einer vertieften Untersuchung der Ansichten der Romantiker zur Vereinsfreiheit: Romantik, Revolution, Liberalismus in ihrem Bezug zu einem freien Vereinswesen | 103 | ||
| 1. Wirtschaftspolitik: Zünfte und freie Assoziationen | 105 | ||
| 2. Adam Müllers organisches „Wechselverhältnis" in bezug auf die Teil verbände im Staat | 106 | ||
| 3. Die Lehre von den Staatszwecken in bezug auf die Vereinigungsfreiheit | 108 | ||
| 4. Die Romantik als Gegner der totalen Gruppenfeindlichkeit der Französischen Revolution | 110 | ||
| 5. Zur Kritik am romantischen Staatsdenken | 112 | ||
| B. Romantik und Assoziationsfreiheit | 114 | ||
| I. Die vereinsfeindliche Fassung des romantischen und restaurativen Ständestaatsgedankens | 114 | ||
| 1. Zur Frage der politischen Erziehung | 115 | ||
| 2. Organismus-Lehre und Ständelehre | 115 | ||
| 3. Berufsständisches System | 117 | ||
| 4. Keine Assoziationen im restaurativen Ständestaat | 118 | ||
| 5. Stahl: Die Korporation als Element der vom „Staat" unterschiedenen „Gesellschaft" | 120 | ||
| II. Romantik, Soziale Frage und das Problem der Assoziation | 122 | ||
| 1. Novalis und Friedrich Schlegel | 123 | ||
| 2. Adam Müller | 124 | ||
| 3. Baader | 125 | ||
| 4. Stahl | 127 | ||
| III. Die unmittelbare Behandlung der Vereinigungsfreiheit in der Romantik | 130 | ||
| 1. Friedrich Schlegel | 131 | ||
| 2. Görres und Baader | 132 | ||
| 3. Adam Müller | 134 | ||
| 4. Stahl | 136 | ||
| 5. Zur politischen Zeitlage, Geschichte und Geschichtlichkeit, Positive Freiheit, Ordo-Denken | 140 | ||
| C. Abschließender Exkurs: Zur Nachfolge der politischen Romantik | 142 | ||
| I. Die Vereinigungsfreiheit und die deutsche Katholische Soziallehre des 19. Jahrhunderts | 142 | ||
| II. Die allgemeine Vereinigungsfreiheit als Naturrecht | 143 | ||
| Drittes Kapitel: Die Korporationslehre Hegels | 146 | ||
| A. Methodologische und systematische Einleitung zu Hegels Korporationslehre | 146 | ||
| I. Zur Methode | 146 | ||
| II. Zur Stellung der Korporationslehre in Hegels System | 153 | ||
| B. Die Korporationslehre Hegels | 157 | ||
| I. Die Korporation in der bürgerlichen Gesellschaft | 157 | ||
| 1. Bürgerliche Gesellschaft, Stände und Korporationen | 157 | ||
| 2. Zu Hegels Terminologie | 161 | ||
| 3. Einzelrechte der Korporationen | 162 | ||
| 4. Staatsaufsicht, Grenzen der korporativen Rechte | 166 | ||
| II. Das Problem einer allgemeinen Assoziationsfreiheit bei Hegel | 168 | ||
| 1. Analogien: Familie, Gewerbefreiheit, Stände | 169 | ||
| 2. Substantielle Freiheit | 172 | ||
| 3. Gegenbild: Humboldts Lehre von den Vereinigungen | 174 | ||
| 4. Hegels ,Korporation': nicht beliebig disponibel | 176 | ||
| 5. Hegel und die Vereinigungsfreiheit | 177 | ||
| III. Die Korporation im System der Sittlichkeit | 180 | ||
| 1. Die sittliche Leistimg der Korporation | 180 | ||
| 2. Die institutionelle Leistung der Korporation | 183 | ||
| 3. Substantialisierung und Konkretisierung | 186 | ||
| IV. Der Übergang zum Staat | 187 | ||
| 1. Die Rolle der Korporation | 187 | ||
| 2. Die Korporation als die „zweite sittliche Wurzel des Staates" | 190 | ||
| 3. Das „Umschlagen des Korporationsgeistes" und des Zwecks | 192 | ||
| 4. Die Korporation: nicht isoliert | 194 | ||
| 5. Der „Übergang" in den Staat: unhistorisch gedacht | 196 | ||
| V. Die Korporation als Figur der Vermittlung | 198 | ||
| 1. Weitere Parallelen in der Philosophie des objektiven Geistes | 198 | ||
| 2. Die Korporation als Figur der Vermittlung in Hegels System selbst | 203 | ||
| C. Die geistesgeschichtliche Stellung von Hegels Korporationslehre | 203 | ||
| I. Zur Wertung von Hegels Korporationslehre | 203 | ||
| II. Hegels Korporationslehre im Deutschen Idealismus | 207 | ||
| 1. Kant | 208 | ||
| 2. Fichte | 210 | ||
| 3. Schelling | 212 | ||
| III. Rousseau und Hegel: Zur Grundlegung ihrer Vereinslehren | 215 | ||
| Viertes Kapitel: Die Freiheit der Vereine | 220 | ||
| Erster Abschnitt: Die Vereinigungsfreiheit als liberales Menschenrecht | 220 | ||
| A. Liberalismus und Vereinigungsfreiheit | 220 | ||
| I. Die Struktur des liberalen Denkens als Parallele zur Struktur der Vereinsfreiheit | 220 | ||
| 1. Zum Begriff „Liberalismus" | 221 | ||
| 2. Zur Abgrenzung des Liberalismus von den Ideen von 1789 und vom Radikalismus | 222 | ||
| 3. Wesensverwandtschaft von Vereinsfreiheit und Liberalismus: Hegel als Gegenbild | 223 | ||
| 4. Liberalismus und Vereinigungsfreiheit, Dekorporierung der überkommenen Gesellschaft | 224 | ||
| II. Zur genaueren Abgrenzung der frühliberalen Vereinslehre | 226 | ||
| 1. Die Vereinslehre von Justus Moser | 226 | ||
| 2. Die Vereinslehre bei Maurenbrecher | 228 | ||
| 3. Die individualistische Vereinslehre Wilhelm von Humboldts in den „Ideen" von 1792 | 228 | ||
| B. Anfänge der Ver eins freiheit | 231 | ||
| I. In der Praxis: die preußischen Reformen | 231 | ||
| 1. Negative Vereinigungsfreiheit | 231 | ||
| 2. Der Freiherr vom Stein | 232 | ||
| 3. Dekorporierende Einzelreformen ab 1806 | 233 | ||
| 4. Hardenberg: negative Vereinigungsfreiheit | 234 | ||
| 5. Die Vereinigungsfreiheit in den Schriften der Reformer, besonders bei Vincke | 235 | ||
| 6. Die Bedeutung der negativen Vereinsfreiheit | 237 | ||
| II. die positive Rechtslage unter dem ALR | 239 | ||
| III. Anfänge der Vereinsfreiheit in der Literatur | 240 | ||
| 1. Partielle „natürliche" Vereinsfreiheit bei J. J. Moser | 240 | ||
| 2. „Stillschweigende" Bestätigung: Leist und Gönner | 242 | ||
| 3. Klüber: Verzicht auf den Genehmigungsvorbehalt; Aufsicht | 243 | ||
| 4. Ansatz zur rechtlichen Vereinigungsfreiheit: Lötz und Berg | 244 | ||
| IV. Die Vereinsfreiheit bei A. L. von Schlözer | 246 | ||
| 1. Vereinsfreiheit zwischen „Staat" und „Gesellschaft" | 246 | ||
| 2. Die Vereinsfreiheit als Grundsatz des Staatsrechts | 248 | ||
| C. Kurze Verfassungsgeschichte der Vereinsfreiheit | 250 | ||
| I. Preußen | 250 | ||
| II. Die Reaktion in England und Frankreich | 251 | ||
| III. Die Vereinsfreiheit in der Verfassung von Sachsen-Meiningen von 1829 | 252 | ||
| IV. Die Reaktion seit 1832; besonders Baden | 253 | ||
| V. Die soziale Notwendigkeit eines freien Vereinswesens | 255 | ||
| D. Die Vereinigungsfreiheit als Menschenrecht in der Staatslehre des vormärzlichen Liberalismus | 256 | ||
| I. Vernunftrechtliche Ableitungen | 256 | ||
| 1. Wesen der Menschenrechte in liberaler Sicht; gemäßigter Individualismus; assoziative Tendenz von Vernunftrecht und Liberalismus | 256 | ||
| 2. Politische Mitwirkungsrechte; Doppelaspekt der liberalen Staatslehre und der Vereinsfreiheit | 258 | ||
| 3. Die Grundrechtsvorstellung bei Rotteck, Bluntschli, Welcker | 259 | ||
| 4. Ableitung der Vereinsfreiheit aus der persönlichen Freiheit | 260 | ||
| 5. Weitere Ableitungen der Vereinsfreiheit: Das Staatslexikon | 265 | ||
| 6. Rottecks Vereinslehre nach dem „Lehrbuch des Vernunftrechts" | 267 | ||
| 7. Die Doppel Wertigkeit der liberalen Vereinslehre | 272 | ||
| II. Übergang vom Vernunftrecht zum Grundrechts-Positivismus | 273 | ||
| 1. Schmid, Reyscher, Henke | 273 | ||
| 2. Jordan und Mohl | 275 | ||
| 3. Zoepfl, Schmitthenner, Pölitz | 278 | ||
| Zweiter Abschnitt: Die öffentliche Seite der Vereinigungsfreiheit im deutschen Liberalismus des Vormärz | 282 | ||
| A. Vereinigungsfreiheit und öffentliche Meinung | 282 | ||
| I. Gegenbeispiel zum Liberalismus: Der Freiherr vom Stein; Zirkler | 282 | ||
| II. Die Frage der Geheimbünde | 284 | ||
| III. Zoepfl; Welcker | 285 | ||
| B. Vereinigungsfreiheit und Soziale Frage | 286 | ||
| I. Die korporativen Lösungsvorschläge | 286 | ||
| II. Die Vereinsfreiheit im Frühsozialismus und im Marxismus | 287 | ||
| III. Vereinigungsfreiheit und Soziale Frage im Liberalismus | 288 | ||
| C. Die Rolle von Vereinigungsfreiheit und freiem Vereinswesen beim Aufbau des Gemeinwesens | 292 | ||
| I. Einführung | 292 | ||
| II. Ansätze: Schmid; Rotteck; Henke; Jordan | 293 | ||
| III. Robert von Mohl | 294 | ||
| IV. Freie Vereine als Stütze der konstitutionellen Monarchie im besonderen und eines freien Gemeinwesens im allgemeinen | 295 | ||
| 1. Reyscher, Zoepfl, Rotteck | 295 | ||
| 2. Welcker | 298 | ||
| 3. Gustav von Struve, K. S. Zachariä | 302 | ||
| 4. Mohl: Funktionen politischer Vereine | 303 | ||
| D. Die Parteifreiheit als Sonder fall der Vereinigungsfreiheit | 305 | ||
| I. Parteibegriff und Vereinigungsfreiheit | 305 | ||
| II. Verfassungsgeschichte der Parteifreiheit und liberale Parteilehren | 306 | ||
| 1. Gemeines Recht; Französische Revolution; Preußen | 306 | ||
| 2. Die Reaktion in Gesetzgebung und Literatur | 306 | ||
| 3. Beispiel für polizeistaatliches Denken: aus der badischen Gesetzgebung | 308 | ||
| 4. Die Reaktion der 1850er Jahre; Bluntschli | 310 | ||
| 5. Sozialgeschichtlicher Hintergrund der liberalen Parteilehren | 311 | ||
| 6. Die Parteilehren von Robert von Mohl, Schulz, Abt | 312 | ||
| Dritter Abschnitt: Die Vereinigungsfreiheit und die Lehre von „Staat und Gesellschaft" | 314 | ||
| A. Struktur dieser Lehre — Struktur der liberalen Staatstheorie — Struktur der Vereinsfreiheit | 314 | ||
| I. Die Doppel Wertigkeit der Grundrechtskataloge und der einzelnen Grundrechte | 314 | ||
| II. Der Doppelstatus des Einzelnen in der liberalen Staatslehre; besonders: Albrecht | 315 | ||
| B. Die Doppelwertigkeit der Vereinsfreiheit | 317 | ||
| I. Beispiel: die politischen Vereine | 317 | ||
| II. Der Doppelaspekt der Vereinsfreiheit bei von Mohl und Ahrens | 317 | ||
| C. Die Struktur der Ver eins freiheit und die Staatslehre des deutschen Frühliberalismus | 318 | ||
| I. Praktischer und theoretischer Aspekt | 318 | ||
| II. Menschenbild und Verbandskonzeption — Struktur und Funktion | 319 | ||
| D. Die Vereinigungsfreiheit als ein Schlüsselproblem der Lehre von „Staat und Gesellschaft" | 320 | ||
| I. Die Problemgeschichte dieser Lehre in bezug auf die Vereinigungsfreiheit | 321 | ||
| 1. Schlözer; Hegel; Herbart; Stahl | 321 | ||
| 2. Die Unterscheidung von „Staat" und „Gesellschaft" als Ergebnis der neueren Sozialgeschichte | 322 | ||
| II. Die Vereinsfreiheit und die theoretische Trennung von „Staat" und „Gesellschaft" | 323 | ||
| 1. Humboldts „Ideen" von 1792 | 323 | ||
| 2. Robert von Mohl | 323 | ||
| 3. Diskrepanz der Trennungs-Doktrin zur frühliberalen Vereinslehre | 325 | ||
| 4. Bezüge zwischen der Trennungs-Doktrin und der frühliberalen Vereinslehre | 327 | ||
| 5. Die liberale Vereinslehre und die Wirklichkeit der Märztage | 329 | ||
| Schlußkapitel | 331 | ||
| Α. Zur Reaktion der 1850er Jahre | 331 | ||
| I. Gesetzgebung und Schrifttum | 331 | ||
| II. Die Bedeutung der Normierung der Vereinsfreiheit in den Frankfurter Grundrechten | 332 | ||
| B. Kurze Zusammenfassung erarbeiteter Ergebnisse | 333 | ||
| I. Rousseau und der Deutsche Idealismus | 333 | ||
| 1. Rousseau und die Revolution | 333 | ||
| 2. Kant und der frühe Fichte; Schelling | 333 | ||
| II. Restaurative Lehren | 334 | ||
| III. Humboldt | 335 | ||
| 1. Die „Ideen" von 1792 | 335 | ||
| 2. Humboldt und Rousseau | 335 | ||
| IV. Hegel | 336 | ||
| V. Der deutsche Frühliberalismus | 337 | ||
| VI. Die Vereinigungsfreiheit in bezug auf Staat und Gesellschaft | 338 | ||
| VII. Die faktische Notwendigkeit eines freien Vereinswesens im Vormärz | 338 | ||
| VIII. Die Vereinigungsfreiheit als ein Organisationsprinzip der neuen Klassengesellschaft | 340 | ||
| C. Typologie der Teilverbände. Die Vereinsfreiheit als eine geschichtliche Ausformung eines umfassenden Problems | 340 | ||
| I. Verbandstypen | 341 | ||
| 1. Rousseau und die Revolution | 341 | ||
| 2. Der Frühliberalismus | 341 | ||
| II. Verbandstypen und Tj'pologie der Rechtsentstehung | 342 | ||
| III. Verbandstypen und Freiheitsbegriff | 342 | ||
| IV. Gebundenheit und Freiheit in der Typologie der Verbandsformen | 343 | ||
| 1. Rousseau; Der Totalstaat; Der Feudal- und Ständestaat; Der liberale Verfassungsstaat mit Vereinigungsfreiheit | 343 | ||
| 2. Vereinigungsfreiheit und Zwangskorporationen in geschichtstypologischer Sicht | 344 | ||
| V. Relativität der Typisierung bei Konstanz der Fragestellungen | 344 | ||
| 1. Zur naturrechtlichen Analogie: Staat — Teil verbände | 344 | ||
| 2. Die Aktualität der vormärzlichen Vereinslehren | 345 | ||
| Literaturverzeichnis | 346 | ||
| A. Dokumentation | 346 | ||
| B. Quellen | 347 | ||
| C. Literatur | 357 | ||
| Personenregister | 367 |
