Die inlandswirksame Geldmenge in einer interdependenten Welt
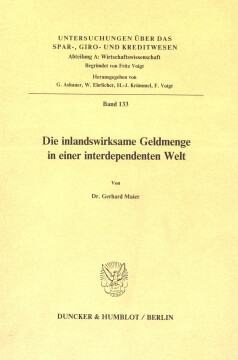
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die inlandswirksame Geldmenge in einer interdependenten Welt
Eine Untersuchung zur Abgrenzung der Geldmenge einer offenen Volkswirtschaft bei flexiblen Wechselkursen durchgeführt am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland
Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft, Vol. 133
(1987)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung und Plan der Arbeit | 13 | ||
| Erster Teil: Grundsatzfragen | 18 | ||
| 1. Die Definition der Geldmenge in offenen Volkswirtschaften: Ein internationaler Vergleich | 18 | ||
| 1.0. Einführung | 18 | ||
| 1.1. Entscheidungsprobleme bei der Definition der Geldmenge | 20 | ||
| 1.2. Geldmengenabgrenzungen in sieben Nationen: Ein Vergleich | 21 | ||
| 1.3. Die Problematik einer national definierten Geldmenge in einer offenen Volkswirtschaft | 27 | ||
| 1.4. Fazit | 30 | ||
| 2. Die Definition der Geldmenge: A priori versus empirische Konzepte | 30 | ||
| 2.0. Einführung | 30 | ||
| 2.1. Empirische Ansätze der Gelddefinition: Ein Überblick | 32 | ||
| 2.1.1. Kriterien | 33 | ||
| 2.1.2. Kritik | 34 | ||
| Exkurs I: Die Evolution des Geldes | 36 | ||
| 2.1.3. Veränderliche Beziehung | 37 | ||
| 2.2. A priori Ansätze der Gelddefinition: Ein Überblick | 38 | ||
| 2.3. Fazit | 40 | ||
| 3. Die mikroökonomischen und institutionellen Grundlagen des Geldes | 41 | ||
| 3.0. Einführung | 40 | ||
| 3.1. Kriterien zur Abgrenzung der inlandswirksamen Geldmenge: Ein mikroökonomischer Ansatz | 41 | ||
| 3.1.1. Der Nutzen des Geldes | 41 | ||
| 3.1.1.1. Ersparnis von Transaktionskosten | 41 | ||
| 3.1.1.2. Ersparnis von Informationskosten | 43 | ||
| 3.1.2. Die charakterisierenden Eigenschaften des Geldes | 45 | ||
| 3.1.2.1. Die Zahlungsmittelfunktion | 46 | ||
| 3.1.2.2. Die Rechenmittelfunktion | 47 | ||
| 3.1.2.3. Die Wertaufbewahrungsfunktion | 48 | ||
| 3.2. Institutionelle Aspekte des Geldwesens | 51 | ||
| 3.2.1. Der gesetzliche Rahmen des Geldwesens | 52 | ||
| 3.2.1.1. Der Geldbegriff im Rahmen der Rechtsordnung der Bundesrepublik | 52 | ||
| 3.2.1.2. Das Nominalprinzip | 54 | ||
| 3.2.2. Die komparativen Vorteile der verschiedenen Geldarten | 55 | ||
| 3.2.3. Geld, Geldsubstitute und Geldkapital | 57 | ||
| Exkurs II: Die Rolle der Banken als „Geldproduzenten“: „Old view“ versus „new view“ | 60 | ||
| 3.3. Fazit | 62 | ||
| Zweiter Teil: Internationale Aspekte des Geldwesens | 64 | ||
| 4. Die Bedeutung der internationalen Finanzmärkte für die Geldpolitik der Deutschen Bundesbank | 64 | ||
| 4.0. Einführung | 64 | ||
| 4.1. Die Auswirkungen von Devisenbewegungen auf das Geldangebot der Bundesrepublik | 67 | ||
| 4.1.1. Die Geldmengenwirkung der Devisenmarktinterventionen der Bundesbank | 67 | ||
| 4.1.2. Die Geldmengenwirkung privater Devisenkäufe | 70 | ||
| 4.2. Der Einfluß des Euromarktes auf die Entwicklung der Geldmengenaggregate der Bundesrepublik Deutschland | 73 | ||
| Exkurs III: Die Kontroverse um den Euromarktmultiplikator | 75 | ||
| 4.2.1. Die geldpolitische Bedeutung der Euromarktkredite an Nichtbanken | 77 | ||
| 4.2.2. Die geldpolitische Bedeutung der Interbankbeziehungen zwischen Euromarkt und nationalem Geldmarkt | 80 | ||
| 4.3. Fazit | 81 | ||
| 5. Die internationalen Funktionen des Geldes | 82 | ||
| 5.0. Einführung | 82 | ||
| 5.1. Die Currency Substitution-Hypothese | 83 | ||
| 5.1.1. Die geldpolitische Aussage | 85 | ||
| 5.1.2. Ursachen und Konsequenzen | 86 | ||
| 5.1.2.1. Konkurrenzversion | 87 | ||
| 5.1.2.2. Diversifikationsversion | 89 | ||
| 5.1.3. Kritik | 90 | ||
| 5.1.3.1. Währungspräferenzen | 91 | ||
| 5.1.3.2. Eine Erklärung für die internationale Streuung der Kassenhaltung | 93 | ||
| 5.1.3.3. Vernachlässigung der Zahlungsmittelfunktion | 95 | ||
| 5.1.4. Die Evidenz | 96 | ||
| 5.2. Internationale Zahlungsmittel | 98 | ||
| 5.2.1. Der Nutzen eines internationalen Zahlungsmittels | 100 | ||
| 5.2.2. Die Rolle der Vehikelwährung | 102 | ||
| 5.2.3. Die internationale Funktion der Nichtvehikelwährungen | 104 | ||
| Exkurs IV: Die geldpolitische Relevanz von „Kunstwährungen“ | 105 | ||
| 5.3. Fazit | 108 | ||
| 6. Die internationale Rolle der DM | 109 | ||
| 6.0. Einführung | 109 | ||
| 6.1. Die DM als Transaktionswährung | 109 | ||
| 6.1.1. Die Rolle der DM im Außenhandel | 110 | ||
| 6.1.2. Geldpolitische Konsequenzen | 111 | ||
| 6.2. Die DM als internationale Emissionswährung | 112 | ||
| 6.3. Die DM als internationale Anlage- und Reservewährung | 114 | ||
| 6.3.1. Die Rolle der DM auf den internationalen Finanzmärkten | 114 | ||
| 6.3.2. Geldpolitische Konsequenzen | 116 | ||
| 6.4. Die externe Verwendung von DM-Banknoten | 119 | ||
| 6.5. Fazit | 120 | ||
| Dritter Teil: Die Geldmenge in einer offenen Volkswirtschaft | 121 | ||
| 7. Das Geldmengenkonzept in interdependenten Volkswirtschaften: Weltgeldmenge versus national abgegrenzte Geldmengenaggregate | 121 | ||
| 7.0. Einführung | 121 | ||
| 7.1. Die wirtschaftspolitische Relevanz der Weltgeldmenge | 121 | ||
| 7.1.1. Das Konzept der Weltgeldmenge | 122 | ||
| 7.1.2. Die Aussagefähigkeit der Weltgeldmenge | 125 | ||
| 7.1.2.1. Die Frage der internationalen Geldeigenschaft | 125 | ||
| 7.1.2.2. Einige geldpolitische Konsequenzen der externen Verwendung des US-Dollars | 126 | ||
| 7.1.2. Die Evidenz | 129 | ||
| Exkurs V: Die Rolle der „internationalen Liquidität“ | 129 | ||
| 7.2. Die „nationale“ Geldmenge | 131 | ||
| 7.3. Fazit | 132 | ||
| 8. Die Abgrenzung der inlandswirksamen Geldmenge der Bundesrepublik gegenüber dem Ausland: Eine Kritik des Definitionsansatzes der Deutschen Bundesbank | 132 | ||
| 8.0. Einführung | 132 | ||
| 8.1. Die „Inlandswirksamkeit“ von Fremdwährungsguthaben | 133 | ||
| 8.1.1. Die Geldnähe von Fremdwährungsguthaben im Lichte der „Neuen Mikroökonomie des Geldes“ | 133 | ||
| 8.1.2. Die Relevanz des Währungsprinzips | 136 | ||
| 8.2. Die „Inlandswirksamkeit“ von Auslandseinlagen bei deutschen Banken | 137 | ||
| 8.2.1. Die Kontroverse über die monetäre Relevanz von Auslandseinlagen | 138 | ||
| 8.2.1.1. Die Position der Deutschen Bundesbank | 138 | ||
| 8.2.1.2. Die Position des Sachverständigenrats | 139 | ||
| 8.2.2. Die Funktion der Auslandseinlagen im Lichte der „Neuen Mikroökonomie des Geldes“ | 140 | ||
| 8.2.3. Die Relevanz des Domizilierungsprinzips | 140 | ||
| 8.3. Die „Inlandswirksamkeit“ der Euro-DM-Einlagen | 141 | ||
| 8.3.1. Zahlungsmittel versus Zahlungsversprechen | 142 | ||
| 8.3.2. Transaktionsmotiv versus Vermögensmotiv | 144 | ||
| 8.4. Die inlandswirksame Geldmenge: Ein Vorschlag für eine Korrektur der Geldmengendefinitionen der Deutschen Bundesbank | 146 | ||
| 8.5. Fazit | 148 | ||
| 9. Schlußfolgerungen | 148 | ||
| Literaturverzeichnis | 150 |
