Die Auswirkungen eines Geburten- und Bevölkerungsrückgangs auf Entwicklung und Ausgestaltung von gesetzlicher Alterssicherung und Familienlastenausgleich
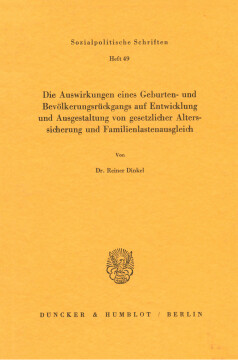
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Auswirkungen eines Geburten- und Bevölkerungsrückgangs auf Entwicklung und Ausgestaltung von gesetzlicher Alterssicherung und Familienlastenausgleich
Sozialpolitische Schriften, Vol. 49
(1984)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
In der Reihe Sozialpolitische Schriften werden Monographien und Sammelbände zu sozialpolitischen Themenstellungen aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven veröffentlicht. Dabei werden einzelne Sozialversicherungszweige oder Sozialleistungssysteme in ihrer Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte, in ihrem Wandel oder ihren rechtlichen, ökonomischen sowie sozialen Wirkungen behandelt. In anderen Studien stehen übergreifende Fragen sozialpolitischen Leitbild- und Ideenwandels, sozialpolitische Herausforderungen und Lösungsansätze, akteursbezogene Politikfeldanalysen oder politische und ideengeschichtliche Fragen im Zentrum. Dabei sind sowohl Untersuchungen zur deutschen Sozialpolitik wie auch internationale oder international vergleichende Studien willkommen.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhalt | 5 | ||
| Einführung und Problemstellung | 11 | ||
| Erstes Kapitel: Demographische und demo-ökonomische Grundlagen | 15 | ||
| 1. Die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland: Ein analytischer Ausgangspunkt | 15 | ||
| 1.1. Perioden- versus Kohortenbetrachtung von Geburten- und Sterbevorgängen | 16 | ||
| 1.2. Eine Kohortenanalyse der deutschen Nachkriegsgeburtenentwicklung | 25 | ||
| 1.3. Eine Abschätzung der Kohortenfertilität der aktiven Frauenjahrgänge | 40 | ||
| 1.4. Die Fertilität ethnischer Minderheiten: Ein Exkurs | 50 | ||
| 1.5. Methoden und Möglichkeiten der langfristigen Bevölkerungsprognose, dargestellt am Beispiel der deutschen Bevölkerung | 51 | ||
| 1.6. Zusammenfassung | 58 | ||
| 2. Die ökonomische Analyse der Fruchtbarkeit | 61 | ||
| 2.1. Familienbildung in der ökonomischen Analyse | 61 | ||
| 2.1.1. Ansatzpunkte einer ökonomischen Theorie der Geburtenrate | 61 | ||
| 2.1.2. Die Familienplanung im theoretischen ökonomischen Modell | 67 | ||
| 2.1.3. Die Analyse von Abtreibungen: Ein Exkurs | 71 | ||
| 2.2. Die Bestimmungsgründe für die Nachfrage nach Kindern | 74 | ||
| 2.2.1. Haushaltsproduktionsfunktion und Theorie der Zeitallokation | 74 | ||
| 2.2.2. Die direkten Kosten der Kinder | 80 | ||
| 2.2.3. Die Opportunitätskosten der veränderten Erwerbsbeteiligung der Mütter | 85 | ||
| 2.2.4. Die Zeitkosten innerhalb der Familie | 91 | ||
| 2.2.5. Eine Gesamtbewertung der Kosten von Kindern für ihre Eltern | 96 | ||
| 2.3. Der Entscheidungsprozeß der Eltern in ökonomischer Interpretation | 101 | ||
| 2.3.1. Die Präferenzstruktur für Kinder | 101 | ||
| 2.3.2. Die Haushaltsoptimierung in vereinfachter Darstellung | 106 | ||
| 2.4. Die empirische Relation zwischen Fruchtbarkeit und Einkommen der Eltern | 111 | ||
| 2.5. Zusammenfassung | 117 | ||
| Zweites Kapitel: Bevölkerungs- oder Familienpolitik mit finanzpolitischen Instrumenten | 120 | ||
| 1. Ansatzpunkte einer Bevölkerungspolitik im liberalen Rechtsstaat | 120 | ||
| 1.1. Bevölkerungs- oder Familienpolitik: Die Schwierigkeiten einer problemgeladenen Abgrenzung | 120 | ||
| 1.2. Eine Systematisierung von Interventionsargumenten | 122 | ||
| 2. Makroökonomische Konsequenzen eines Bevölkerungsrückgangs | 128 | ||
| 2.1. Das Arbeitskräfteangebot im Bevölkerungsrückgang | 129 | ||
| 2.2. Die volkswirtschaftliche Gesamtnachfrage im Bevölkerungsrückgang | 131 | ||
| 2.2.1. Die Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs auf Konsum und Ersparnisse | 131 | ||
| 2.2.2. Die Investitionsgüternachfrage im Bevölkerungsschwund | 135 | ||
| 2.3. Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht bei schrumpfender Bevölkerung | 136 | ||
| 2.3.1. Die neoklassische Analyse | 136 | ||
| 2.3.2. Die „Stagnationstheorie“. Eine keynesianische Analyse | 139 | ||
| 2.3.3. Wirtschaftspolitische Empfehlungen für die Situation des Bevölkerungsrückgangs | 141 | ||
| 3. Nicht-makroökonomische Auswirkungen eines Bevölkerungsrückgangs | 142 | ||
| 3.1. Konsequenzen einer Veränderung der absoluten Bevölkerungszahl | 142 | ||
| 3.2. Bevölkerungspolitische Ansatzpunkte durch die relative Verschiebung in der Besetzung von Bevölkerungsgruppen | 144 | ||
| 3.2.1. Soziale Konsequenzen der „Überalterung“ | 144 | ||
| 3.2.2. Alters- und Kinderlast in Folge eines Geburtenrückgangs | 147 | ||
| 4. Bevölkerungs- oder familienpolitische Zielformulierungen | 150 | ||
| 4.1. Die „optimale“ Bevölkerung: Eine Antwort im Rahmen der ökonomischen Theorie? | 151 | ||
| 4.2. Bevölkerungspolitik als Ausgleich positiver Konsumexternalitäten | 154 | ||
| 4.3. Die „stabile“ Bevölkerung als Ziel einer Rahmensteuerung? | 157 | ||
| 4.4. Eine bevölkerungs- und familienpolitische Position: Der Bevölkerungsrückgang als Ansatzpunkt für distributive Maßnahmen | 159 | ||
| Drittes Kapitel: Alterssicherung im langfristigen Bevölkerungsrückgang | 162 | ||
| 1. Der ökonomische Gutscharakter einer kollektiven Alterssicherung | 162 | ||
| 2. Kapitaldeckung versus Umlageverfahren in der gesetzlichen Sozialversicherung | 165 | ||
| 2.1. Organisationsprinzipien der Sozialversicherung | 165 | ||
| 2.2. Die Wirkungsweise von Kapitaldeckungs- und Umlageverfahren in einem elementaren Modell | 167 | ||
| 2.3. Bevölkerungsveränderung und Zinssatz: Ein Vergleich der Organisationsformen im Modell der stabilen Bevölkerung | 175 | ||
| 2.4. Die Organisationsform in realwirtschaftlicher Betrachtung | 181 | ||
| 3. Bevölkerungsentwicklung und kollektive Alterssicherung | 184 | ||
| 3.1. Die Ausgestaltung der gesetzlichen Alterssicherung in Deutschland und ihre Finanzierungslage im Bevölkerungsrückgang | 184 | ||
| 3.2. Der „Generationenvertrag“ der umlagefinanzierten Alterssicherung | 192 | ||
| 3.3. Die Auswirkung von Kindern auf die Rentenhöhe im geltenden Recht | 195 | ||
| 4. Reformvorschläge im Bereich der gesetzlichen Alterssicherung | 201 | ||
| 4.1. Vorschläge zur finanziellen Bewältigung der Zukunftslasten | 201 | ||
| 4.2. Reformvorschläge zur Verbesserung der Alterssicherung von Müttern bzw. der Berücksichtigung der Kindererziehung | 207 | ||
| 4.2.1. Die Anrechnung von Erziehungsjahren als Beitragsjahre der Mütter | 207 | ||
| 4.2.2. Die Rente nach Mindesteinkommen und ihre Auswirkungen auf die Rentenhöhe der Mütter | 211 | ||
| 5. Ein Vorschlag zur langfristigen Neugestaltung der gesetzlichen Alterssicherung | 214 | ||
| 5.1. Ziele und Anforderungen an eine langfristige Neuregelung | 214 | ||
| 5.2. Die Berücksichtigung der Generationsabfolge in der Rentengestaltung | 215 | ||
| 5.2.1. Die Rentenhöhe in Abhängigkeit von der Kinderzahl | 215 | ||
| 5.2.2. Die Beitragsdifferenzierung in verschiedenen Ausgestaltungsformen | 216 | ||
| 5.3. Die Beitragsdifferenzierung als Stärkung oder Schwächung des Äquivalenzprinzips? | 222 | ||
| 5.4. Auswirkungen einer Beitragsdifferenzierung auf das generative Verhalten | 224 | ||
| 5.5. Die Beitragsdifferenzierung und der intergenerationale Transfer | 225 | ||
| 5.6. Die Beitragsdifferenzierung in ihren ökonomischen Konsequenzen | 229 | ||
| 6. Hinterbliebenenversorgung und Rentenkumulierungen in langfristiger Perspektive | 231 | ||
| 6.1. Grundsätze und Alternativen der Hinterbliebenenversorgung | 231 | ||
| 6.2. Ein Vorschlag zur zukunftsgerechnten Ausgestaltung der Hinterbliebenenversorgung | 235 | ||
| Viertes Kapitel: Der Ausgleich von Kinder- und Familienlasten | 242 | ||
| 1. Arten und Zielsetzung von Familienausgleichsleistungen | 242 | ||
| 1.1. Begriff und Geschichte des Familienlastenausgleichs in Deutschland | 242 | ||
| 1.2. Die Auswirkung monetärer Transfers auf die Entscheidung über die Familienbildung und -erweiterung | 246 | ||
| 1.3. Umverteilungsziele und -wirkungen des Familienlastenausgleichs | 250 | ||
| 2. Die steuerliche Behandlung von Ehe und Familie | 254 | ||
| 2.1. Die Ehegattenbesteuerung im deutschen Steuerrecht | 254 | ||
| 2.2. Die steuerliche Berücksichtigung von Kindern | 260 | ||
| 3. Das Kindergeld in der familienpolitischen Diskussion | 264 | ||
| 3.1. Sozialpolitische Begründungen für die Gewährung von Kindergeld | 264 | ||
| 3.2. Familieneinkommen und -wohlfahrt in Abhängigkeit von der Familiengröße | 266 | ||
| 3.3. Die Aufwendungen für Kinder durch Eltern und Staat | 270 | ||
| 3.4. Die Festlegung eines „richtigen“ staatlichen Transfersatzes | 273 | ||
| 4. Kritische Erörterung familienpolitischer Reformvorschläge | 275 | ||
| 4.1. Neue familienpolitische Instrumente: Eine Auswahl | 275 | ||
| 4.1.1. Familien- oder Erziehungsgeld | 275 | ||
| 4.1.2 Heirats- und Familiengründungsdarlehen | 278 | ||
| 4.1.3. Das Kindergeld in kapitalisierter Form | 280 | ||
| 4.2. Erhöhung der Transfers oder verstärktes Angebot öffentlicher Güter: Versuch einer Bewertung | 281 | ||
| 5. Ein Vorschlag zur Reform des Familienlastenausgleichs | 286 | ||
| 5.1. Zur Neugestaltung der Ehegatten- und Familienbesteuerung | 286 | ||
| 5.2. Grundsätze einer Neuorientierung der direkten Familientransfers | 289 | ||
| 6. Zusammenfassung | 293 | ||
| Anhang I: Ein Überblick über die moderne ökonomische Theorie der Geburtenentwicklung | 295 | ||
| 1. Die „Wohlstandstheorie“ der Geburtenrate | 297 | ||
| 2. Sinkende Fruchtbarkeit bei steigendem Einkommen: Der Beitrag Leibensteins | 300 | ||
| 3. Der „Chicago-Approach“ | 302 | ||
| 3.1. G. Beckers ökonomische Analyse der Fruchtbarkeit | 302 | ||
| 3.2. Die Weiterentwicklungen im Rahmen der „neuen“ Haushaltstheorie | 306 | ||
| 4. Die langfristige Analyse von Easterlin | 310 | ||
| 5. Außerökonomische Faktoren und die alternativen sozialwissenschaftlichen Erklärungsansätze | 312 | ||
| 6. Die Prognose der Geburtenentwicklung im ökonomischen Modell | 317 | ||
| Literaturverzeichnis | 321 |
