Risikobereitschaft bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen
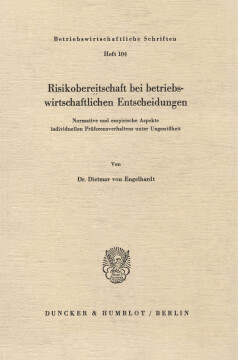
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Risikobereitschaft bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen
Normative und empirische Aspekte individuellen Präferenzverhaltens unter Ungewißheit
Betriebswirtschaftliche Schriften, Vol. 104
(1981)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | V | ||
| Inhaltsverzeichnis | VII | ||
| Einleitung | 1 | ||
| A. Problemstellung | 3 | ||
| B. Abgrenzung | 9 | ||
| C. Gang der Untersuchung | 11 | ||
| Erstes Kapitel: Risikobereitschaft als Element eines theoretischen Bezugsrahmens zur Behandlung von Entscheidungen unter Ungewißheit | 16 | ||
| A. Konzept der Entscheidung als Problemlösungsprozeß | 17 | ||
| I. Begriff und Elemente der Entscheidung (Problemlösung) | 17 | ||
| II. Konstruktcharakter der Entscheidungselemente | 22 | ||
| B. Konzept der Wahrscheinlichkeit | 29 | ||
| I. Mathematische Wahrscheinlichkeit | 30 | ||
| II. Objektive Wahrscheinlichkeit | 32 | ||
| 1. Logische Interpretation | 33 | ||
| 2. Häufigkeitsinterpretation | 37 | ||
| III. Subjektive Wahrscheinlichkeit | 41 | ||
| 1. Grad des Glaubens | 41 | ||
| 2. Subjektive und objektive Wahrscheinlichkeit | 45 | ||
| 3. Subjektive und personelle Wahrscheinlichkeit | 49 | ||
| C. Konzept der Präferenzen | 66 | ||
| I. Präferenzen, Ziele und Nutzen | 67 | ||
| II. Differenzierung von Präferenzen | 71 | ||
| 1. Inhaltsbezogene, ausmaßbezogene und zeitbezogene Präferenz | 72 | ||
| 2. Risikopräferenz | 75 | ||
| 2.1. Ungewißheit, Risiko und Risikobereitschaft | 76 | ||
| 2.2. Operationalisierung von Risikobereitschaft | 81 | ||
| Zweites Kapitel: Risikobereitschaft und Nutzenmaximierungsmodell | 85 | ||
| A. Kennzeichnung des Nutzenmaximierungsmodells | 86 | ||
| I. Komponenten | 86 | ||
| II. Axiomatische Fundierung | 90 | ||
| III. Funktionaler Charakter | 98 | ||
| IV. Offenheit | 100 | ||
| V. Exkurs: Eigenschaften von Nutzenfunktionen | 102 | ||
| 1. Argumente der Nutzenfunktion | 102 | ||
| 2. Risikoaversion und Nutzenfunktion | 106 | ||
| 2.1. Definition von Risikoaversion | 106 | ||
| 2.2. Messung von Risikoaversion | 109 | ||
| 2.3. Zunehmende, konstante und abnehmende Risikoaversion | 111 | ||
| B. Normative Relevanz des Nutzenmaximierungsmodells | 116 | ||
| I. Vorbemerkung | 116 | ||
| II. Risikonutzen und Nutzen des Geldes | 122 | ||
| 1. Kritik an der Risikonutzenfunktion | 122 | ||
| 1.1. Paradoxon von Jacob und Leber | 122 | ||
| 1.2. Trennung zwischen Einstellung zum Risiko und Einstellung zum Geld | 125 | ||
| 1.2.1. Argumentation von Jacob und Leber | 125 | ||
| 1.2.2. Argumentation von Krelle | 129 | ||
| 2. Kritik der Kritik an der Risikonutzenfunktion | 130 | ||
| 2.1. Lösung des Paradoxons von Jacob und Leber | 131 | ||
| 2.2. Interpretation des Risikonutzens | 133 | ||
| III. Unabhängigkeitspostulat und Paradoxa | 139 | ||
| 1. Pro- und Contra-Position | 139 | ||
| 2. Darstellung der Paradoxa | 141 | ||
| 2.1. Beispiele von Allais | 141 | ||
| 2.2. Beispiel von Morlat | 144 | ||
| 2.3. Beispiel von Markowitz | 145 | ||
| 2.4. Beispiele von Ellsberg | 146 | ||
| 3. Frage der Akzeptabilität des Unabhängigkeitspostulats | 148 | ||
| 3.1. Empirische Untersuchungen zu den Paradoxa | 149 | ||
| 3.1.1. Experimente zum Allais-Paradoxon | 149 | ||
| 3.1.2. Experimente zum Ellsberg-Paradoxon | 158 | ||
| 3.2. Relevanz der empirischen Untersuchungen für die Akzeptabilität des Unabhängigkeitspostulats | 164 | ||
| 3.3. Akzeptanz des Unabhängigkeitspostulats | 169 | ||
| 4. Frage der Rationalität paradoxer Präferenzurteile | 172 | ||
| 4.1. Rationalität beim Allais-Paradoxon | 174 | ||
| 4.1.1. Ansätze zur Erklärung der paradoxen Präferenzen | 174 | ||
| 4.1.1.1. Streuungspräferenz | 175 | ||
| 4.1.1.2. Freude am Spiel | 177 | ||
| 4.1.1.3. Relevanz spezifischer Wahrscheinlichkeiten und Auszahlungen | 184 | ||
| 4.1.2. Analyse der Erklärungsansätze unter dem Aspekt der Rationalität | 192 | ||
| 4.2. Rationalität beim Ellsberg-Paradoxon | 196 | ||
| 4.2.1. Zur Einführung: Zweipersonennullsummenspiel – Ein unbeachtet gebliebener Ansatz zur Erklärung der paradoxen Präferenzen | 197 | ||
| 4.2.2. Darstellung der in der Literatur vorgetragenen Erklärungsansätze | 206 | ||
| 4.2.2.1. Bewertungsinterdependenz der Chancen | 206 | ||
| 4.2.2.2. Modifikation von Wahrscheinlichkeiten oder Nutzen | 210 | ||
| 4.2.2.3. Vertrauensparameter für Wahrscheinlichkeiten | 215 | ||
| 4.2.2.4. Extranutzen für Wahrscheinlichkeiten | 218 | ||
| 4.2.3. Kognitives Risiko-Modell – Eine Anregung zur Lösung des Ellsberg-Paradoxons | 221 | ||
| 4.2.3.1. Kennzeichnung des kognitiven Risiko-Modells | 221 | ||
| 4.2.3.2. Anwendung des kognitiven Risiko-Modells auf das Ellsberg-Paradoxon | 230 | ||
| 4.2.3.3. Thematische Ausweitung des kognitiven Risiko-Modells | 248 | ||
| 4.2.4. Analyse der Erklärungsansätze unter dem Aspekt der Rationalität | 263 | ||
| C. Empirische Relevanz des Nutzenmaximierungsmodells unter Beachtung alternativer Ansätze | 272 | ||
| I. Vorbemerkung | 272 | ||
| II. Risiko-Präferenz und Risiko-Wahrnehmung | 274 | ||
| 1. Coombs’ Portfoliotheorie – Eine Theorie der Risiko-Präferenz | 275 | ||
| 2. Theorien der Risiko-Wahrnehmung | 288 | ||
| 2.1. Polynome Theorie des Risikos | 289 | ||
| 2.2. Theorie des additiven Risikos | 291 | ||
| 2.3. Theorie des erwarteten Risikos | 293 | ||
| 3. Resümierende Betrachtung von Portfolio- und Risikotheorien und eine Idee von Aschenbrenner | 299 | ||
| III. Risiko-Dimensionen und Informationsverarbeitung | 309 | ||
| 1. Gewichte von Dimensionen und der Umkehreffekt | 309 | ||
| 1.1. Regressionsmodell | 309 | ||
| 1.2. Umkehreffekt | 314 | ||
| 2. Lexikographische Semiordnung von Dimensionen, Differenzenstrategien und die Intransitivität von Präferenzen | 317 | ||
| 2.1. Unterschiedsschwelle und intransitive Präferenzen | 320 | ||
| 2.2. Identifikation kognitiver Strategien und intransitive Präferenzen | 330 | ||
| 3. Relation zwischen Dimensionen und die Bevorzugung bei Alternativen mit gleicher Verteilung | 334 | ||
| 4. Resümierende Betrachtung von Risiko-Dimensionen und Informationsverarbeitung | 343 | ||
| D. Zusammenfassung zur normativen und empirischen Relevanz des Nutzenmaximierungsmodells | 345 | ||
| Drittes Kapitel: Ausgewählte Determinanten von Risikobereitschaft bzw. Risikoverhalten | 350 | ||
| A. Vorbemerkung | 350 | ||
| B. Konsequenzenbezug, Kontext und Komplexität | 352 | ||
| I. Isolierung und Referenzpunkt | 352 | ||
| II. Versicherungskontext | 366 | ||
| III. Sammelpolicen | 369 | ||
| IV. Zusammenfassung | 376 | ||
| C. Kontrollillusion | 378 | ||
| I. Kontrollimpulse und Risikoverhalten in Chancesituationen | 378 | ||
| II. Allgemeine Verhaltensrelevanz von kognizierter Kontrolle | 385 | ||
| D. Kommunikation und Betroffenheit anderer | 394 | ||
| I. Fragestellung | 394 | ||
| II. Umrisse und Erklärungsansätze der Polarisierung durch Kommunikation | 395 | ||
| 1. Zunahme an Risikofreudigkeit | 396 | ||
| 1.1. Wahldilemma-Paradigma | 396 | ||
| 1.2. Andere Meßinstrumente | 409 | ||
| 2. Zunahme an Vorsicht | 426 | ||
| 3. Polarisierung | 429 | ||
| 3.1. Polarisierung auf der Risikodimension | 430 | ||
| 3.2. Generalität der Polarisierung | 432 | ||
| 3.3. Gruppenpolarisierung und individuelle Polarisierung | 435 | ||
| 4. Soziale Vergleichsprozesse | 438 | ||
| 4.1. Ideale Position und präsumtive Positionen anderer | 438 | ||
| 4.2. Fingierte und faktische Positionen anderer | 440 | ||
| 5. Informationale Einflüsse | 443 | ||
| 5.1. Manipulation von Argumenten | 445 | ||
| 5.2. Analyse von Argumenten | 453 | ||
| III. Entscheidungen für Außenstehende | 458 | ||
| IV. Entscheidungen für die eigene Bezugsgruppe | 462 | ||
| V. Ergebnis | 469 | ||
| Viertes Kapitel: Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal | 478 | ||
| A. Fragestellung | 478 | ||
| B. Ergebnisse von Slovic und von Kogan und Wallach und die Nein-Aber-Antwort | 484 | ||
| C. Evidenz gegen die Nein-Aber-Antwort | 495 | ||
| Fünftes Kapitel: Resultate der vorgetragenen Analyse der Risikobereitschaft und ihre Relevanz für reale betriebswirtschaftliche Entscheidungen | 500 | ||
| A. Resultate im Überblick | 500 | ||
| B. Generalisierbarkeit | 505 | ||
| C. Problemlösungsrelevanz | 522 | ||
| Schlußbetrachtung | 529 | ||
| Literaturverzeichnis | 536 |
