Wählerverhalten in der Bundesrepublik Deutschland
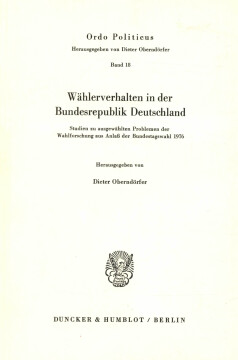
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Wählerverhalten in der Bundesrepublik Deutschland
Studien zu ausgewählten Problemen der Wahlforschung aus Anlaß der Bundestagswahl 1976
Editors: Oberndörfer, Dieter
Ordo Politicus, Vol. 18
(1978)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Zur Einführung | 7 | ||
| I. Wahlforschung im Verhältnis zu politischer Praxis und normativer Demokratietheorie | 11 | ||
| Dieter Oberndörfer: Politische Meinungsforschung und Politik | 13 | ||
| Hartmut Garding: Empirische Wahlforschung und normative Demokratietheorie | 39 | ||
| 1. Verständigungsschwierigkeiten zwischen Empirie und Theorie | 39 | ||
| 1.1. Die „klassischen“ Demokratietheorien: Monismus und Pluralismus | 40 | ||
| 1.2. Die „theoretische Kluft“ | 45 | ||
| 2. Der Beginn der empirischen Wahlforschung (Columbia) | 46 | ||
| 2.1. Die Begleitumstände | 47 | ||
| 2.2. Von der „rationalen“ zur „soziologischen“ Theorie des Wählerverhaltens | 48 | ||
| 2.2.1. Rationales Verhalten als Ausgangshypothese | 49 | ||
| 2.2.2. Die Homogenität sozialer Gruppen als Ersatz für Rationalität | 51 | ||
| 2.2.3. Ein alternatives Erklärungskonzept: „cross-pressures“ | 53 | ||
| 2.3. Globale Erklärungsansätze mit implizierter Rationalität | 54 | ||
| 2.4. Die Vermengung von Individual- und Aggregatebene | 55 | ||
| 2.5. Logische Widersprüche zwischen Rationalitätsprämisse und Gruppenkonzept | 57 | ||
| 3. Wahlforschung und monistische Demokratietheorie | 60 | ||
| 3.1. Drei Phasen der Behavioralismusdebatte | 60 | ||
| 3.2. Kritik an der Gültigkeit der empirischen Ergebnisse | 62 | ||
| 3.3. Monistische Demokratietheorie als Idealkonzept | 64 | ||
| 3.3.1. Die prinzipielle Realisierbarkeit des Ideals | 65 | ||
| 3.3.2.1. Die Variable „Parteiidentifikation“ | 67 | ||
| 3.3.2. Generelle Realisierbarkeit (Michigan) | 68 | ||
| 3.3.2.2. Evidenz zur Rolle der Parteiidentifikation | 71 | ||
| 3.3.3. Ansätze zum Dialog | 76 | ||
| Literaturverzeichnis | 77 | ||
| II. Politische Ideologie und Parteien aus der Wählerperspektive | 83 | ||
| Karl-Josef Does: Politische Werte, politische Perspektive und Parteiensystem. Zur Wahrnehmung von Parteiimages | 85 | ||
| 1. Parteiensystem und Parteipräferenz. Einige theoretische Implikationen | 86 | ||
| 1.1 Präferenz und Nicht-Präferenz | 86 | ||
| 1.2 Das Parteiensystem als Ergebnis politischer Kommunikation „Objektive“ und wahrgenommene Realitätsebene | 88 | ||
| 1.3 Politische Begriffe als Imagekomponenten | 92 | ||
| 1.4 Einige empirische Untersuchungen | 94 | ||
| 1.5 Zusammenfassung | 97 | ||
| 2. Das Analysemodell und operationale Konzepte | 99 | ||
| 3. Das Wertesystem als politische Perspektive | 105 | ||
| 3.1 Politische Begriffe als Dimensionen eines politischen Wertesystems | 106 | ||
| 3.2 Zur Struktur des Wertesystems | 112 | ||
| 3.2.1. Die Polarität der Rechts-Links-Dimension | 113 | ||
| 3.2.2. Strukturanalyse des Wertesystems | 119 | ||
| 3.3 Soziostrukturell bedingte Variabilität der Wertestruktur | 123 | ||
| 3.4 Zusammenfassung | 130 | ||
| 4. Wertesystem und Parteiensystem | 131 | ||
| 4.1 Politische Standpunkte und Parteipositionen | 132 | ||
| 4.1.1. Die Rechts-Links-Dimension als Beispiel | 132 | ||
| 4.1.2. Politische Standpunkte und die Wahrnehmung von Distanzen zwischen den Parteien | 134 | ||
| 4.1.3. Parteisympathie und die Wahrnehmung von Parteipositionen | 136 | ||
| 4.1.4. Soziostrukturelle Bedingungen und politisches Interesse | 138 | ||
| 4.1.5. Wertestruktur und Parteipositionen auf der Rechts-Links-Dimension | 140 | ||
| 4.1.6. Zusammenfassung | 141 | ||
| 4.2 Strukturanalyse der Parteienimages | 143 | ||
| 4.2.1. Begriffsvalenzen und Parteienpositionen | 143 | ||
| 4.2.2. Die Struktur der Imageprofile | 147 | ||
| 4.3 Struktur der Perspektive und Struktur des Parteiensystems | 155 | ||
| 4.5 Zusammenfassung | 161 | ||
| 5. Schlußfolgerungen und Bewertung der Ergebnisse | 163 | ||
| Anhang | 169 | ||
| 1. Ableitung der Strukturmerkmale Polarität, Kohärenz und Komplexität des Wertesystems | 169 | ||
| 2. Ableitung der Strukturmerkmale Polarität, Kohärenz und Komplexität des Parteiensystems | 171 | ||
| Literaturverzeichnis | 184 | ||
| Peter Röhrig/Rolf Stadié: Dimensionen der Wahrnehmung und Beurteilung politischer Parteien | 189 | ||
| 1. Problemstellung: Die Wahrnehmung und Beurteilung von Parteien | 189 | ||
| 2. Ordnungskonzepte von Einstellungen zu politischen Objekten | 190 | ||
| 2.1 Der Ansatz von Converse | 191 | ||
| 2.2 Diskussion alternativer Forschungsansätze | 193 | ||
| 3. Empirische Ergebnisse | 196 | ||
| 3.1 Das operationale Konzept | 196 | ||
| 3.2 Die Elemente der Vorstellungsbilder | 197 | ||
| 3.3 Der Einfluß der Parteipräferenz auf die Vorstellungen über die Parteien | 200 | ||
| 3.4 Die Images der Parteien | 207 | ||
| 4. Zusammenfassung | 213 | ||
| 5. Literatur | 213 | ||
| Dieter Noetzel: Über einige Bedingungen des Erwerbs politisch-ideologischer Deutungsmuster Kritische Anmerkungen zur Theorie der Schweigespirale | 215 | ||
| 1. Problemstellung | 215 | ||
| 2. Darstellung der Theorie der Schweigespirale | 216 | ||
| 3. Theoretische Analyse der Theorie der Schweigespirale | 225 | ||
| 3.1 Die Theorie der Schweigespirale als Konformitätstheorie | 225 | ||
| 2.2 Die Theorie der Schweigespirale als Wahrnehmungstheorie | 234 | ||
| 4. Hypothesen und Daten | 239 | ||
| 5. Schlußbemerkungen | 260 | ||
| Literaturverzeichnis | 261 | ||
| Peter Gluchowski: Parteiidentifikation im politischen System der Bundesrepublik Deutschland Zum Problem der empirischen Überprüfung eines Konzepts unter variierten Systembedingungen | 265 | ||
| 1. Parteiidentifikation – Ein Konzept und seine Folgen für das Modelldenken in der empirischen Wahlforschung | 265 | ||
| 2. Deutsche Übertragungsversuche des Parteiidentifikationskonzepts – Ein Operationalisierungsdilemma | 270 | ||
| 3. Elemente des Parteiidentifikationskonzepts, Konstruktvalidierung und die Rahmenbedingungen des politischen Systems | 273 | ||
| 4. Die Bedeutung der Parteiidentifikation für das Individuum | 277 | ||
| 5. Systembedingungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland und ihre Auswirkungen auf die Sichtbarkeit von politischen Objekten und Inhalten | 280 | ||
| 5.1 Überblick über die Regierungssysteme der Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland | 281 | ||
| 5.2 Die Sichtbarkeit von Parteien, Politikern und politischen Standpunkten im amerikanischen Regierungssystem | 282 | ||
| 5.3 Die Sichtbarkeit von Parteien, Politikern und politischen Standpunkten im Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland | 285 | ||
| 6. Stabilität von Parteiidentifikation und Kongruenz von Parteiidentifikation und Wahlintention in der Bundesrepublik Deutschland | 288 | ||
| 6.1 Spezifische Anforderungen an die Datenlage | 288 | ||
| 6.2 Verwendete Studien und Meßinstrumente | 289 | ||
| 6.3 Empirische Ergebnisse | 291 | ||
| 6.4 Diskussion | 300 | ||
| 7. Attitüdenstrukturierung – das Zusammenspiel von Parteiidentifikation und externen Faktoren | 302 | ||
| 7.1 Das Analysemodell | 302 | ||
| 7.2 Evidenz für Attitüdenstrukturierung durch Parteiidentifikation – das Beispiel der Bundestagswahl 1976 | 303 | ||
| 7.3 Anzeichen für die Wirkung externer Faktoren – das Beispiel der Bundestagswahl 1972 | 306 | ||
| 7.3.1. Die Attitüdenasymmetrie | 307 | ||
| 7.3.2 Die Verhaltensasymmetrie | 310 | ||
| 7.3.3 Parallelitäten in der Veränderung von Parteiidentifikationen | 312 | ||
| 7.4 Diskussion | 315 | ||
| 8. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen | 318 | ||
| Literaturverzeichnis | 321 | ||
| III. Politische Sachfragen und Kanzlerkandidaten als Determinanten des Wahlverhaltens | 325 | ||
| Hartmut Garding: Ostpolitik und Arbeitsplätze Issues 1972 und 1976 | 327 | ||
| 1. Die Renaissance des Issue | 327 | ||
| 2. Die Bedeutung von Issues aus monistischer und pluralistischer Sicht | 329 | ||
| 3. Issueorientierung versus „issue support“ | 333 | ||
| 4. Das Distanzmodell | 336 | ||
| 4.1 Implikationen des Distanzmodells | 338 | ||
| 4.1.1 Die Operationalisierung der Issueabfrage | 339 | ||
| 4.1.2 Die Issueposition des Befragten | 341 | ||
| 4.1.3 Die Festlegung der Issuepartei | 345 | ||
| 4.2 Das Konfliktpotential | 349 | ||
| 4.2.1 Konsens-, Dissens- und Polarisationsissues | 351 | ||
| 4.2.2 Die Asymmetrie der Issuepublika | 355 | ||
| 4.2.3 Die Verteilung der Issuepositionen | 358 | ||
| 4.3 Projektion | 368 | ||
| 4.3.1 Die Wahrnehmung der ID-Partei | 370 | ||
| 4.3.2 Die Wahrnehmung von ID- und Konkurrenzpartei | 374 | ||
| 4.4 Issuewahl | 381 | ||
| 5. Über die Bedeutung von Issues | 386 | ||
| Literaturverzeichnis | 387 | ||
| Helmut Jung: Ökonomische Einstellungen und das Wahlverhalten auf dem Hintergrund sozialstruktueller Variablen – ein Zeitvergleich zwischen 1973 und 1976 – | 391 | ||
| 1. Problemstellung und Aufbau der Analyse | 391 | ||
| 2. Einstellungen zur wirtschaftlichen Situation als Determinanten des Wahlverhaltens | 392 | ||
| 2.1 Versuche zur Quantifizierung des Einflusses wirtschaftlicher Variablen auf das Wahlverhalten | 393 | ||
| 2.1.1 Probleme der Operationalisierung wirtschaftlicher Einstellungen und Erwartungen | 399 | ||
| 2.2 Schlußfolgerungen für das Analysekonzept | 403 | ||
| 2.2.1. Die operationale Definition wirtschaftlicher Einstellungen und Erwartungen durch die ökonomische Issueorientierung | 403 | ||
| 2.2.2 Die theoretische Stellung der Issueorientierung | 410 | ||
| 3. Zusammenhänge zwischen allgemeiner Parteipräferenz, ökonomischer Issueorientierung und der Wahlabsicht zwischen 1973 und 1976 | 418 | ||
| 3.1 Querschnittanalyse | 418 | ||
| 3.2 Längsschnittanalyse | 425 | ||
| 4. Die Bedeutung der Sozialstruktur für Stabilität und Wechsel der Wahlabsicht | 433 | ||
| 4.1 Exkurs: Vergleich verschiedener Schichtungstheorien | 433 | ||
| 4.2 Die operationale Definition von Schichtungskonzepten und die theoretische Stellung der Sozialstruktur im Analysemodell | 436 | ||
| 4.3 Die Bedeutung der Sozialstruktur für Stabilität und Wechsel der Wahlabsicht bei veränderter Issueorientierung | 438 | ||
| 4.3.1 Generelle Einflüsse der Sozialstruktur auf das Wahlverhalten zwischen 1973 und 1976 | 438 | ||
| 4.3.3 Die Ergebnisse | 447 | ||
| 5. Zusammenfassung | 457 | ||
| Literaturverzeichnis | 460 | ||
| Ludolf K. Eltermann: Zur Wahrnehmung von Kanzlerkandidaten Imageprofilierung im Wechselspiel von Identifikation und Projektion | 465 | ||
| 1. Das Analyseproblem und die Daten | 465 | ||
| 1.1 Warum Wahlverhalten nicht als die abhängige Variable aufgefaßt werden soll | 465 | ||
| 1.2 Die zugrundeliegenden Daten | 467 | ||
| 1.3 Ein Datenvergleich zur Darstellung des Problemhintergrundes | 468 | ||
| 1.3.1 Kritsche Überlegungen zum Amtsbonus als Erklärungsraster | 469 | ||
| 1.3.2 Die Einstellungs- und Verhaltensebene | 470 | ||
| 1.3.3 Kanzlerkandidaten im Vergleich von Relevanz und Präferenz | 473 | ||
| 2. Das Eindrucksdifferential – ein Versuch zur Beschreibung der Politikerimages als Einstellungskonstellationen | 475 | ||
| 2.1 Die Auswahl und Zusammenstellung der Beurteilungsmerkmale | 479 | ||
| 2.2. Politische Führungsbedürfnisse – ein besonderes Problem bei der Anwendung des Eindrucksdifferentials zur Imagemessung von Kanzlerkandidaten | 483 | ||
| 2.3 Die Kanzlerkandidaten von 1972 und 1976 im Spiegel von Eigenschaftspotentialen | 485 | ||
| 2.4 Die Konsequenzen von Rollenerwartungen an Kanzler und Oppositionsführer für die Schwerpunkte der Imageanalyse | 488 | ||
| 2.5 Modern und konservativ als ideologiespezifische Bezüge für die Einstellungskonstellationen der Parteien und Kandidaten | 496 | ||
| 3. Zusammenhänge der Merkmale des Eindrucksdifferentials – die Imagekonstellation als ein Syndrom zentraler und peripherer Eigenschaften | 501 | ||
| 3.1 Die Kanzlerkandidaten 1972 | 506 | ||
| 3.2 Die Kanzlerkandidaten 1976 | 513 | ||
| 3.3 Der „Idealkanzler“ – ein Versuch zur Operationalisierung von politischer Führungserwartung | 520 | ||
| Literaturverzeichnis | 528 |
