Staat, Steuern- und Finanzausgleich
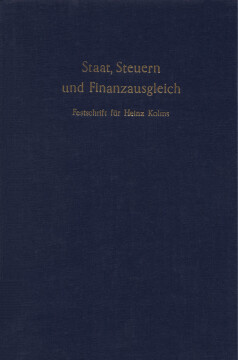
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Staat, Steuern- und Finanzausgleich
Festschrift für Heinz Kolms zum 70. Geburtstag
Editors: Koch, Walter A. S. | Petersen, Hans-Georg
(1984)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhalt | 9 | ||
| Erster Teil: Zur Stellung öffentlicher Finanzwirtschaften in dogmenhistorischer und heutiger Sicht | 13 | ||
| Martin Heilmann: Zur Politischen Ökonomie des Staates und der Staatsfinanzen bei Karl Marx | 15 | ||
| A. Die Stellung des Staates im theoretischen System der Marxschen Politischen Ökonomie | 16 | ||
| I. Die philosophischen Grundlagen | 16 | ||
| II. Einordnung des Staates in das theoretische System | 19 | ||
| III. Ökonomische Bestimmung der Staatsfunktionen | 21 | ||
| 1. Formbesonderung des Staates als Rechtsstaat | 22 | ||
| 2. „Zusammenfassung“ der bürgerlichen Gesellschaft – Staatliche Sicherung der gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen | 23 | ||
| 3. Der Staat als Interventionsstaat | 24 | ||
| B. Der Staat im Wirtschaftskreislauf (Gesamtwirtschaftliches Reproduktionssystem) | 26 | ||
| I. Das einfache Kreislaufschema | 28 | ||
| II. Marx’ Unterscheidung zwischen reproduktiven und nicht-reproduktiven Staatsausgaben | 28 | ||
| III. Marx’ Unterscheidung zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit | 31 | ||
| IV. Einführung des Staates in das einfache Reproduktionsschema | 33 | ||
| V. Ansätze einer Theorie der Staatsausgaben | 35 | ||
| 1. Begriffliche „Bausteine“ | 35 | ||
| 2. Bereitstellung der „allgemeinen Produktionsbedingungen“ durch den Staat – Das „Wegebau-Beispiel“ | 37 | ||
| 3. Marx’ Kommentierung der Smithschen Lehre von der Unproduktivität der Staatsausgaben | 39 | ||
| C. Zur Einordnung der Staatseinnahmen – Steuern und Staatskredit | 43 | ||
| I. Steuern auf Lohnarbeiter – Konsequenzen der Mehrwerttheorie | 44 | ||
| II. Zur Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Steuern | 47 | ||
| III. Marx’ Stellung zum Staatskredit | 50 | ||
| Harry Schimmler: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und Wirtschaftspolitik | 55 | ||
| A. Einleitung | 55 | ||
| B. Wirtschaftspolitik | 57 | ||
| C. Wirtschaftsdaten | 57 | ||
| D. Bewertung | 60 | ||
| E. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | 63 | ||
| F. Schlußbemerkungen | 65 | ||
| Günter Ollenburg: Staat – Wirtschaft – Wohlfahrt. Ein Beitrag zum Dilemma staatlicher Wirtschaftspolitik | 67 | ||
| A. Beziehungen zwischen Bürger und Staat | 67 | ||
| I. Individuum, Staat und Wirtschaftstheorie: eine subjektive Betrachtung | 67 | ||
| II. Die Stellung des Staates in der demokratischen Gesellschaft | 68 | ||
| III. Der Staat als Wohltäter und als Organisator des Interessenausgleichs | 72 | ||
| B. Aktuelle Beispiele: Staat und Bürger im Spiegel des Steuerrechts | 75 | ||
| I. Steuertarif und die Grundsätze einer zutreffenden Begriffsbildung | 75 | ||
| II. Gleichberechtigung und Steuerklassengesellschaft | 78 | ||
| III. Die zukünftige Generation und steuerliche Leistungsfähigkeit | 81 | ||
| IV. Lebenseinkommen und Generationenvertrag | 86 | ||
| V. Investition und Konsumtion als Teil des Generationenvertrages | 90 | ||
| C. Wohlfahrtsauffassungen und die Stellung des Staates in der Gesellschaft | 92 | ||
| I. Wohlfahrt als Menge der wirtschaftlich nutzbaren Ressourcen | 93 | ||
| II. Wohlfahrt als Umfang des Einsatzes von Ressourcen | 95 | ||
| III. Wohlfahrt als Verwirklichung des Leistungsergebnisses | 96 | ||
| D. Staatsaufgaben und Funktionsfähigkeit der Wirtschaft | 99 | ||
| I. Marktwirtschaft und die Utopie des Nachtwächterstaates | 99 | ||
| II. Niveau der Staatsausgaben und Prinzipien der Gerechtigkeit | 102 | ||
| III. Externe Effekte als markt- und staatswirtschaftliche Aufgabe | 105 | ||
| E. Schlußfolgerungen | 107 | ||
| Hans-Georg Petersen: Ursachen und Konsequenzen einer wachsenden Schattenwirtschaft | 111 | ||
| A. Zur Problematik | 111 | ||
| B. Der Umfang der Schattenwirtschaft | 113 | ||
| I. Eine umfassende Definition | 114 | ||
| II. Einige empirische Befunde | 116 | ||
| C. Bestimmungsgründe der Schattenwirtschaft | 121 | ||
| I. Außer-ökonomische Determinanten | 122 | ||
| II. Ökonomische Determinanten | 125 | ||
| D. Die Auswirkungen der Staatstätigkeit | 129 | ||
| I. Die isolierte Analyse der Steuerwirkungen | 129 | ||
| 1. Wirkungen von Steuerersatzvariationen im formellen Sektor | 130 | ||
| 2. Wirkungen von Steuersatzvariationen bei Berücksichtigung eines informellen Sektors | 132 | ||
| 3. Abhängigkeit der Wirkungen der Steuersatzvariationen von makroökonomischen Gegebenheiten | 133 | ||
| II. Die Analyse der Budgeteffekte | 135 | ||
| III. Die Qualität der Staatstätigkeit | 140 | ||
| E. Umfang und Struktur der Staatstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland | 141 | ||
| I. Einige grobe Entwicklungslinien | 142 | ||
| II. Die Konsequenzen für das Wachstum des formellen und informellen Sektors | 147 | ||
| F. Risiken und Chancen einer wachsenden Schattenwirtschaft | 149 | ||
| Hennig Bydekarken: Einleitung zu einer theoretischen Konzeption der Verteilungsgerechtigkeit und Fragen ihrer finanzpolitischen Realisierung | 155 | ||
| A. Abgrenzung | 155 | ||
| B. Aufgabenstellung | 163 | ||
| C. Ausführung | 165 | ||
| Zweiter Teil: Steuertheorie und Steuerpolitik | 169 | ||
| Wilhelmine Dreißig: Steuerpolitik im Zusammenhang mit der Währungsreform | 171 | ||
| A. Einleitung | 171 | ||
| B. Zur Vorgeschichte: Reaktion auf die Steuergesetzgebung des Alliierten Kontrollrates | 173 | ||
| C. Die Steuergesetzgebung vom Juni 1948 bis zum April 1949 | 175 | ||
| I. Umstrittenes Procedere | 175 | ||
| II. Die Tarifsenkung | 182 | ||
| 1. Differenzen über das Ausmaß der Steuersenkung | 182 | ||
| 2. Ungleichmäßige Belastung der Gewinneinkommen | 186 | ||
| III. Die Steuervergünstigungen | 188 | ||
| 1. Ambivalente Vorstellungen der Militärregierungen | 188 | ||
| 2. Die Vergünstigungen im einzelnen: Versuch einer Klassifizierung | 189 | ||
| 3. Der Anfang: Das Militärregierungsgesetz Nr. 64 „Zur vorläufigen Neuordnung von Steuern“ | 191 | ||
| 4. Der Ausbau: Das zweite Gesetz zur vorläufigen Neuordnung von Steuern | 192 | ||
| 5. Rechtfertigung und Bedenken | 195 | ||
| D. Abschließende Bemerkungen | 198 | ||
| Herbert Timm: Eine Variante des Haavelmo-Theorems: Der multiplikative Effekt der Finanzierung von Staatsausgaben für Güter und Dienste durch eine allgemeine Verbrauchsteuer | 201 | ||
| A. Vorbemerkungen | 201 | ||
| B. Der multiplikative Effekt | 203 | ||
| C. Der beschäftigungspolitische Aspekt | 212 | ||
| Heinz Haller: Die steuerliche Behandlung von Ersparnissen – ein Dauerthema? | 215 | ||
| A. | 215 | ||
| B. | 216 | ||
| C. | 223 | ||
| D. | 231 | ||
| Willi Albers: Die Besteuerung von Vermögen und fundierten Einkünften | 235 | ||
| A. Das Verhältnis der Einkommensteuer zur Vermögensteuer | 236 | ||
| I. Doppelbesteuerung des Vermögens in der Einkommen- und Vermögensteuer | 236 | ||
| II. Die Behandlung von Erbschaften | 237 | ||
| III. Die Familie als Besteuerungseinheit | 239 | ||
| IV. Maßstäbe für eine steuerliche Leistungsfähigkeit | 240 | ||
| V. Vermögen als Quelle einer zusätzlichen Leistungsfähigkeit | 242 | ||
| VI. Freizeit als Bestandteil der Leistungsfähigkeit | 243 | ||
| VII. Humankapital als Kriterium für die Leistungsfähigkeit | 244 | ||
| VIII. Anstrengungen bei der Einkommenserzielung und Leistungsfähigkeit | 245 | ||
| IX. Zwischenbilanz | 246 | ||
| B. Der Verbrauch als Besteuerungsmaßstab | 247 | ||
| C. Die Besteuerung des Produktionsfaktors Kapital durch eine Vermögensteuer | 251 | ||
| D. Die Beurteilung der Vermögensteuer in Abhängigkeit von ihrer Inzidenz | 252 | ||
| E. Leistungsanreize und Gefahr der Substanzbesteuerung | 252 | ||
| F. Besteuerung und Umverteilung von Einkommen und Vermögen | 254 | ||
| G. Die praktischen Schwierigkeiten bei der Durchführung einer Vermögensbesteuerung | 257 | ||
| H. Schlußfolgerungen | 259 | ||
| Horst Zimmermann: Welfare Taxation. The Importance of Non-Monetary Welfare Determinants for Income Taxation | 263 | ||
| A. The Issue | 263 | ||
| B. An Old Argument about Welfare Determinants in Income Taxation Resumed | 264 | ||
| C. Income and Welfare | 265 | ||
| I. Empirical Evidence of Decreasing Importance of Monetary Income | 265 | ||
| II. Welfare Determinants Beside Monetary Income | 270 | ||
| 1. The Meaning of a Welfare Determinant under the Taxation Aspect | 270 | ||
| 2. Some Determinants Beside Monetary Income | 271 | ||
| D. Approach to a Welfare Taxation | 272 | ||
| Dritter Teil: Nationaler Finanzausgleich und internationale Finanzwirtschaft | 277 | ||
| Horst Claus Recktenwald: Föderalismus im säkularen Wandel. Erste Ergebnisse einer empirischen Analyse | 279 | ||
| Vorbemerkung | 279 | ||
| A. Rahmen und Zweck der Abhandlung | 280 | ||
| B. Das Prinzip des ökonomischen und politischen Verbundes – ein normatives Referenzkonzept | 282 | ||
| C. Popitz’ Gesetz der Anziehungskraft des Zentraletats – eine empirische Widerlegung | 285 | ||
| D. Die säkulare Entwicklung des Finanzföderalismus im internationalen Vergleich | 288 | ||
| E. Der Grad der Zentralisierung einzelner Staatsausgaben – erste Befunde | 293 | ||
| F. Die föderale Finanzstruktur in und nach Kriegen – Niveauverschiebungseffekte? | 293 | ||
| Karl-Heinrich Hansmeyer/Klaus Zimmermann: Das Popitzsche Gesetz und die Entwicklung der Ausgabenverteilung zwischen Bund und Ländern in den 60er und 70er Jahren | 297 | ||
| A. Das Popitzsche „Gesetz“ | 297 | ||
| B. Empirische Tests des Popitzschen Gesetzes | 300 | ||
| C. Die Entwicklung in den 60er und 70er Jahren in disaggregierter Sicht | 302 | ||
| D. Bestimmungsgründe der Dynamik in der Ausgabenverteilungsstruktur | 312 | ||
| Rolf Peffekoven: Eigene Einnahmen internationaler Organisationen. Zu einem Problem des internationalen Finanzausgleichs | 315 | ||
| A. Einleitung | 315 | ||
| B. Beitragsfinanzierung versus eigene Einnahmen | 316 | ||
| C. Problematik eigener Einnahmen | 321 | ||
| D. Arten eigener Einnahmen | 324 | ||
| E. Verteilungswirkungen eigener Einnahmen | 329 | ||
| F. Resümee | 331 | ||
| Günter Ott: Zur Diskussion um „Zahlmeister“ und „Nutznießer“ der Europäischen Gemeinschaften | 333 | ||
| A. Einleitung | 333 | ||
| B. Das gegenwärtige Konzept | 335 | ||
| I. Größenordnungen und Bestimmungsgründe | 335 | ||
| II. Verteilungspolitische Konzeptionen | 339 | ||
| C. Unzulänglichkeiten des gegenwärtigen Konzepts | 341 | ||
| I. Nichterfaßte gemeinschaftliche Aktivitäten | 341 | ||
| II. Formale Zurechnung der Finanzströme | 344 | ||
| III. Integrationsinduzierte Effekte | 347 | ||
| D. Zusammenfassung | 351 | ||
| Herbert Weise: Zweckzuweisungen und gebundene Kredite im nationalen und internationalen Finanzausgleich | 353 | ||
| A. Einführende Bemerkungen: Verständnis und finanzwissenschaftliche Einordnung des Themas | 353 | ||
| I. Die Vergleichsgrundlagen | 353 | ||
| II. Die historischen Perspektiven | 354 | ||
| B. Öffentliche Entwicklungshilfe als nach-„kapitalistische“ Variante internationaler wirtschaftlicher und politischer Verflechtungen (Weltfinanzausgleich) | 355 | ||
| I. Die veränderte Ausgangssituation nach dem Zweiten Weltkrieg | 355 | ||
| 1. Die Marshallhilfe als gedankliche Wende | 355 | ||
| 2. Entwicklungshilfe als eine besondere Form der internationalen finanzwirtschaftlichen Kooperation | 357 | ||
| 3. Wirtschaftliche Motivation der Hilfeleistungen | 360 | ||
| II. Nationaler – speziell kommunaler – Finanzausgleich und öffentliche internationale Entwicklungshilfe im Vergleich | 361 | ||
| 1. Allgemeine Grundsätze und Kriterien | 361 | ||
| 2. Projektgebundene Investitions- und Entwicklungshilfe: Kritik und Berechtigung | 366 | ||
| C. Determinanten kommunaler Investitionsentscheidungen im Spannungsfeld zwischen Verwaltungsautonomie und Einbindung in die Volkswirtschaft | 368 | ||
| I. Institutionelle Fakten und Zwänge | 368 | ||
| 1. Die Heterogenität der politischen und finanzwirtschaftlichen Einheit „Gemeinde“ | 368 | ||
| 2. Planerisches Potential als Funktion der Größenklasse | 369 | ||
| II. Wirtschafts- und finanzpolitische „Umwelt“ der kommunalen Investitionspolitik | 370 | ||
| 1. Regional- und branchenstrukturelle Einbettung | 370 | ||
| 2. Volks- und finanzwirtschaftliche Datenkonstellation | 371 | ||
| III. Chancen der Mitbestimmung auf der Empfängerseite | 372 | ||
| 1. Sachzwänge auf der Geberseite | 372 | ||
| 2. Bedeutung und Einfluß des Informationspotentials „vor Ort“ | 375 | ||
| 3. Persönliche Faktoren: Die Rolle der Experten- und Fachgruppen | 375 | ||
| 4. Möglichkeiten des Interessenausgleichs bei Projekt- und Zuweisungsverhandlungen | 376 | ||
| D. Projektorientierung im entwicklungspolitischen Finanzausgleich: Probleme und Chancen | 378 | ||
| I. Der Bedarf der meisten Entwicklungsländer für Planungs- und Implementierungshilfe | 378 | ||
| 1. Institutioneller und politischer Nachholbedarf | 378 | ||
| 2. Die Rolle der verschiedenen Arten und Formen von technischer Hilfe | 379 | ||
| 3. Die Rolle des Consultingwesens in der internationalen Entwicklungspolitik | 386 | ||
| II. Selbstinteresse und entwicklungspolitische Verantwortung der Geberländer | 387 | ||
| 1. Das nationale Interesse der Geberländer am Ausbau der LDCs in der weltwirtschaftlichen Entwicklung | 387 | ||
| 2. Koordinierungsmöglichkeiten in der Geberpolitik | 388 | ||
| E. Zusammenfassende Schlußbemerkungen | 390 | ||
| Walter A. S. Koch: Probleme Öffentlicher Finanzwirtschaften in Entwicklungsländern | 393 | ||
| A. Ausgangslage und Problemstellung | 393 | ||
| B. Öffentliche Haushaltswirtschaft und Entwicklungsstand | 394 | ||
| C. Staatshaushalt und Entwicklungsplanung | 400 | ||
| D. Haushaltswirtschaft und Entwicklungshilfe | 404 | ||
| E. Lösungsansätze | 407 | ||
| Vierter Teil: Spezielle Probleme | 413 | ||
| Karl Häuser: Widersinn des Bundesbankgewinnes | 415 | ||
| A. Quantität und Qualität | 415 | ||
| B. Rechtslage | 417 | ||
| C. Entwicklung | 418 | ||
| D. Besonderheiten und Charakter des Bundesbankgewinnes | 419 | ||
| E. Quellen des Bundesbankgewinns | 421 | ||
| F. Wirkungen der Gewinnabführung | 424 | ||
| G. Folgerungen | 427 | ||
| Heinz Langen: Betriebswirtschaftliche Prozeßerhaltung als Verallgemeinerung des Liquiditätspostulats | 433 | ||
| A. Liquidität als Voraussetzung der Unternehmenserhaltung | 433 | ||
| B. Die Eignung der Finanz- und Betriebsbuchhaltung und ihrer Abschlüsse für die Liquidität | 434 | ||
| C. Basiselemente eines alternativen Rechnungswesens auf der Mengenebene | 436 | ||
| D. Dynamische Darstellung von Prozessen und Dispositionen | 441 | ||
| E. Die Durchführbarkeit von Prozessen | 444 | ||
| F. Probleme der Preisstellung | 445 | ||
| G. Das Problem der Liquiditätssicherung als Spezialfall des Problems der Prozeßerhaltung | 447 | ||
| H. Zusammenfassung | 449 | ||
| Verzeichnis der Herausgeber und Mitarbeiter | 451 |
