Die Wirkungen öffentlicher Güter untersucht am Beispiel von Fußgängerbereichen
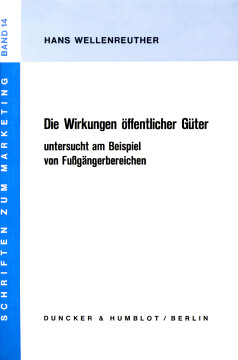
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Wirkungen öffentlicher Güter untersucht am Beispiel von Fußgängerbereichen
Schriften zum Marketing, Vol. 14
(1982)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | V | ||
| Inhaltsverzeichnis | VII | ||
| Tabellenverzeichnis | XV | ||
| Abbildungsverzeichnis | XIX | ||
| Kapitel I: Theoretische Grundlagen der Bereitstellung einer bedürfnisgerechten Ausstattung an öffentlichen Gütern | 1 | ||
| 1. Eigenarten öffentlicher Güter und Gegenstand der Arbeit | 1 | ||
| 1.1. Das Wesen öffentlicher Güter als Gegenstand der Theorien öffentlicher Güter | 1 | ||
| 1.1.1. Die Theorie reiner öffentlicher Güter | 2 | ||
| 1.1.2. Die Theorie meritorischer Güter | 2 | ||
| 1.1.3. Die Theorie externer Effekte | 3 | ||
| 1.2. Der Gegenstand der Arbeit | 5 | ||
| 2. Theorien zur Bestimmung des optimalen öffentlichen Angebotes auf der Basis von Bürgerurteilen | 7 | ||
| 2.1. Der wohlfahrtstheoretische Ansatz | 7 | ||
| 2.2. Der Ansatz der Theorie der Local Public Goods | 9 | ||
| 2.3. Der demokratietheoretische Ansatz | 10 | ||
| 2.4. Praktische Konsequenzen für die Beurteilung öffentlicher Güter | 12 | ||
| 3. Pragmatische Ansätze zur Bereitstellung einer bedürfnisgerechten Ausstattung an öffentlichen Gütern | 13 | ||
| 3.1. Die Bereitstellung einer bedürfnisgerechten Ausstattung an öffentlichen Gütern im Licht der Problemlösungstheorie | 14 | ||
| 3.1.1. Entscheidungen über öffentliche Güter als komplexe, schlechtstrukturierte Probleme | 14 | ||
| 3.1.2. Konzeptionen zur Handhabung komplexer Probleme | 15 | ||
| 3.2. Ansätze der empirischen Çozialforschung | 17 | ||
| 3.2.1. Der Einsatz der empirischen Sozialforschung als Beitrag zur Verbesserung der Bedürfnisadäquanz öffentlicher Güter | 17 | ||
| 3.2.2. Grundfragen empirischer Wirkungsanalysen und der für diese Arbeit gewählte Ansatz | 20 | ||
| 3.2.2.1. Maßstäbe für die Wirkungen | 20 | ||
| 3.2.2.2. Die Methodik der Wirkungsanalyse | 22 | ||
| 3.2.2.3. Möglichkeiten der Datenauswertung | 25 | ||
| 4. Der Gang der weiteren Untersuchung | 27 | ||
| Kapitel II: Hypothesen zu den mutmaßlichen Auswirkungen der Einrichtung von Fußgängerbereichen | 28 | ||
| 1. Die Identifikation von Wirkungen und von Hypothesen über deren Ursachen | 28 | ||
| 2. Literaturmeinungen über die Wirkungen der Einrichtung von Fußgängerbereichen | 30 | ||
| 3. Rechtliche Grundlagen der Einrichtung von Fußgängerbereichen | 35 | ||
| 3.1. Die Einrichtung eines Fußgängerbereichs als Gemeindeaufgabe | 36 | ||
| 3.2. Rechtliche Bestimmungen zur Beteiligung von Bürgern | 37 | ||
| 3.2.1. Verfassungsrechtliche Bestimmungen | 37 | ||
| 3.2.2. Bundesbau rechtliche Bestimmungen | 39 | ||
| 3.2.3. Straßenverkehrs- und Straßen rechtliche Bestimmungen | 40 | ||
| 3.2.4. Gemeindeordnungsrechtliche Bestimmungen | 42 | ||
| 4. Kriterien der Rechnungshöfe bei der Beurteilung von Fußgängerbereichen | 44 | ||
| 5. Kriterien des Zukunftsinvestitionen- Programms für die Förderung von Fußgängerbereichen | 48 | ||
| 5.1. Grundzüge der Förderungsrichtlinien | 48 | ||
| 5.2. Die Bestimmungen des Städtebauförderungsgesetzes als Beurteilungsgrundlage bei der Mittelvergabe für Fußgängerbereiche | 49 | ||
| 5.3. Kriterien der Bundesländer für die Vergabe von Mitteln | 52 | ||
| 6. Wirkungsanalysen und -annahmen in einem Einzelfall am Beispiel Heidelberg | 55 | ||
| 6.1. Eine Chronologie der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen | 57 | ||
| 6.2. Wirkungsanalysen und -annahmen der Vorschläge zur Verkehrsberuhigung | 58 | ||
| 6.2.1. Der Vorschlag im Rahmen des Verkehrsgutachtens | 59 | ||
| 6.2.2. Der Vorschlag im Rahmen des Gutachtens zur Stadtentwicklung | 60 | ||
| 6.2.3. Der Vorschlag seitens der Stadtverwaltung | 64 | ||
| 6.3. Wirkungsannahmen während des Prozesses der Zielfindung und der Zielfestlegung | 67 | ||
| 6.3.1. Wirkungsannahmen während der öffentlichen Diskussion der Ziele | 67 | ||
| 6.3.2. Wirkungsannahmen des Rahmenplans für die Altstadtregenerierung | 69 | ||
| 6.3.3. Wirkungsannahmen des Bebauungsplanentwurfs | 70 | ||
| 6.3.4. Wirkungsannahmen während der Erprobung des Fußgängerbereichs | 74 | ||
| 7. Zusammenfassung der Ergebnisse | 76 | ||
| Kapitel III: Auswirkungen von Fußgängerbereichen auf den Verkehr und auf die Wohnbevölkerung | 82 | ||
| 1. Auswirkungen auf den Verkehr | 82 | ||
| 1.1. Determinanten der Entwicklung des Verkehrsaufkommens in der Umgebung der Fußgängerbereiche | 82 | ||
| 1.1.1. Die Entwicklung des Verkehrsaufkommens | 84 | ||
| 1.1.2. Der Einfluß einzelner Gestaltungsalternativen auf die Entwicklung des Verkehrsaufkommens | 87 | ||
| 1.1.2.1. Der Einfluß der Größe der Fußgängerbereiche auf die Entwicklung des Verkehrsaufkommens | 88 | ||
| 1.1.2.2. Der Einfluß der Bereitstellung von Umgehungsstraßen auf die Entwicklung des Verkehrsaufkommens | 92 | ||
| 1.1.2.3. Der Einfluß der Qualität des Anschlusses an den öffentlichen Personen- Nahverkehr auf die Entwicklung des Verkehrsaufkommens | 94 | ||
| 1.1.2.4. Der Einfluß der Art der Anlieferung auf die Entwicklung des Verkehrsaufkommens | 96 | ||
| 1.1.3. Die relative Bedeutung der Gestaltungsalternativen für die Entwicklung des Verkehrsaufkommens | 98 | ||
| 1.1.3.1. Exkurs: Die Vorgehensweise bei einer Strukturanalyse zur Erklärung der Verkehrsentwicklung in der Umgebung der Fußgängerbereiche | 99 | ||
| 1.1.3.2. Ergebnisse einer Strukturanalyse zur Erklärung der Verkehrsentwicklung in der Umgebung der Fußgängerbereiche | 105 | ||
| 1.2. Determinanten für das Auftreten von Problemen in der Verkehrsführung | 107 | ||
| 1.2.1. Der Einfluß einzelner Determinanten | 108 | ||
| 1.2.2. Die relative Bedeutung der Determinanten für Probleme in der Verkehrsführung | 110 | ||
| 1.3. Determinanten für den Erfolg von Verkehrsverlagerungen | 119 | ||
| 2. Auswirkungen auf die Wohnbevölkerung | 123 | ||
| 2.1. Folgen für die Anzahl der Bewohner | 124 | ||
| 2.2. Folgen für die Gesundheit und die Sicherheit der Bevölkerung | 128 | ||
| 2.2.1. Auswirkungen auf die Gesundheit | 128 | ||
| 2.2.2. Auswirkungen auf die Sicherheit | 131 | ||
| Kapitel IV: Auswirkungen von Fußgängerbereichen auf Einzelhandel sowie Hotel- und Gaststättengewerbe | 134 | ||
| 1. Auswirkungen auf den Einzelhandel | 134 | ||
| 1.1. Veränderungen der Attraktivität des Einzelhandels infolge der Einrichtung von Fußgängerbereichen | 135 | ||
| 1.2. Der Einfluß von Gestaltungsmaßnahmen auf die Attraktivität der Fußgängerbereiche | 137 | ||
| 1.2.1. Der Einfluß der Größe der Fußgängerbereiche | 137 | ||
| 1.2.1.1. Der Einfluß der Größe auf die Passantenzahlen | 138 | ||
| 1.2.1.2. Der Einfluß der Größe auf die Kundenzahlen | 142 | ||
| 1.2.1.3. Der Einfluß der Größe der Fußgängerbereiche auf die Umsätze des Einzelhandels | 144 | ||
| 1.2.2. Der Einfluß von Einrichtungen zur Gewährleistung und Verbesserung der Erreichbarkeit von Fußgängerbereichen | 147 | ||
| 1.2.3. Die relative Bedeutung der Einflußfaktoren für die Umsatzentwicklung in Fußgängerbereichen | 152 | ||
| 1.3. Veränderungen der Attraktivität des Einzelhandels in Fußgängerbereichen auf Kunden im Vergleich zu den angrenzenden Gebieten | 156 | ||
| 1.3.1. Der Eintritt eines Leistungsniveaugefälles zu Lasten der angrenzenden Gebiete | 157 | ||
| 1.3.2. Die Umsatzentwicklung des Einzelhandels in den benachbarten Gebieten | 161 | ||
| 1.3.3. Zur Wirksamkeit der Bedarfsforschungsvorschriften des Städtebauförderungsgesetzes | 173 | ||
| 1.4. Strukturveränderungen im Einzelhandel im Zusammenhang mit Fußgängerbereichen | 174 | ||
| 1.4.1. Veränderungen im Sortimentsniveau | 175 | ||
| 1.4.2. Die Mietentwicklung | 180 | ||
| 1.4.3. Die Veränderung der Branchenstruktur | 185 | ||
| 1.5. Veränderungen in den Konkurrenzbeziehungen zu Versorgungseinrichtungen auf der "grünen Wiese" | 191 | ||
| 2. Auswirkungen auf das Hotel- und Gaststättengewerbe | 195 | ||
| 2.1. Veränderungen innerhalb der Fußgängerbereiche | 195 | ||
| 2.1.1. Veränderungen in der Anzahl der Betriebe | 195 | ||
| 2.1.2. Die Entwicklung der Umsätze | 199 | ||
| 2.2. Folgen der Einrichtung von Fußgängerbereichen für die Betriebe in den angrenzenden Gebieten | 201 | ||
| Kapitel V: Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung im Oberblick | 203 | ||
| Literaturverzeichnis | 211 | ||
| Anhang 1: Das Zielsystem des Rahmenplans für die Altstadtregenerierung in Heidelberg | 241 | ||
| Anhang 2: Tabellen | 249 | ||
| Anhang 3: Grundzüge der log-linearen Modellanalyse | 253 | ||
| 1. Das formale Modell im zweidimensionalen Fall | 254 | ||
| 2. Das formale Modell im dreidimensionalen Fall | 258 | ||
| 3. Die möglichen Modelle und deren inhaltliche Interpretation im dreidimensionalen Fall | 261 | ||
| 4. Zur Auswahl eines befriedigenden Modells | 266 |
