Stabilität im Wandel
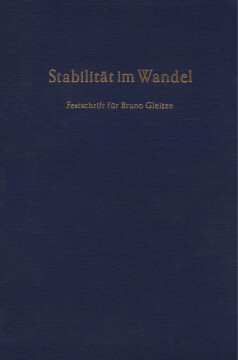
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Stabilität im Wandel
Wirtschaft und Politik unter dem evolutionsbedingten Diktat. Festschrift für Bruno Gleitze zum 75. Geburtstage
Editors: Gemper, Bodo B.
(1978)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhalt | V | ||
| Vorbemerkung des Herausgebers | 1 | ||
| 1. Bestätigung | 1 | ||
| 2. Eine klare Lebensperspektive | 2 | ||
| 3. Gestalten und steuern | 3 | ||
| 4. Soziales Engagement | 4 | ||
| 5. Ein gesamtdeutsches Schicksal | 5 | ||
| 6. Stabilität im Wandel, ein Widerspruch? | 7 | ||
| Helmut Schmidt: Bruno Gleitze zum 75. Geburtstag | 11 | ||
| Heinz Markmann: Bruno Gleitze und das Wirtschaftswissenschaftliche Institut der Gewerkschaften (WWI) | 13 | ||
| 1. Stabilität und Wandel | 19 | ||
| Oswald von Nell-Breuning: Stabilität – Flexibilität – Mobilität | 21 | ||
| 1. Sicht der Mitglieder | 21 | ||
| 2. Sicht und Haltung der Gewerkschaften | 22 | ||
| 3. Mikro- und makro-ökonomische Sicht | 23 | ||
| 4. Doppelsinn von „Arbeitsplatz“ | 25 | ||
| 5. „Sicherung und Erhaltung“ | 26 | ||
| 6. Beschäftigungspolitik | 27 | ||
| 7. Say’sches Theorem | 29 | ||
| 8. Verlagerter Schwerpunkt | 30 | ||
| 9. Zu den Arbeitskämpfen März/April 1978 | 31 | ||
| Ludwig Dohmen: Modische Tendenzen im wirtschaftspolitischen Denken | 33 | ||
| I. | 33 | ||
| II. | 35 | ||
| III. | 37 | ||
| IV. | 39 | ||
| V. | 41 | ||
| VI. | 43 | ||
| VII. | 44 | ||
| Literaturhinweise | 45 | ||
| Elisabeth Noelle-Neumann: Die Mutation der Zeitung in der Ära des Fernsehens | 47 | ||
| 1. Erfolgreiche Zeitungen erkennen die Notwendigkeit zum Reagieren | 47 | ||
| 2. Imitation des Fernsehens oder komplementär? | 51 | ||
| 3. Medienpolitisch bedingte Unterschiede | 54 | ||
| 4. Lesen ist schwieriger als Sehen | 55 | ||
| 5. Über das Fernsehen in der Zeitung schreiben | 58 | ||
| 6. Umfrageergebnisse, was in den Zeitungen verändert wurde | 59 | ||
| 7. Verkennung von Stärken und Schwächen | 62 | ||
| 2. Beschäftigungsniveau und Wirtschaftsordnung | 65 | ||
| Jan Tinbergen: Beschäftigungsförderung ohne Preissteigerung | 67 | ||
| 1. Stagflation: die neue Herausforderung | 67 | ||
| 1.1. Beschreibung des Phänomens | 67 | ||
| 1.2. Wichtigste Erklärungsgründe | 67 | ||
| 1.3. Vergleich mit der Großen Depression | 68 | ||
| 2. Die Notwendigkeit einer neuen Wirtschaftspolitik | 69 | ||
| 2.1. Fünf Prozent Arbeitslosigkeit unzulässig | 69 | ||
| 2.2. Die neue Wirtschaftspolitik soll eine internationale sein | 69 | ||
| 3. Erhöhung der Weltnachfrage notwendig | 70 | ||
| 3.1. Viele unerfüllte Bedürfnisse der Dritten Welt | 70 | ||
| 3.2. Ein gemeinsames Interesse der Ersten und der Dritten Welt | 71 | ||
| 4. Neue Möglichkeiten einer Preisstabilisierung | 72 | ||
| 4.1. Die Begründung von Lohnforderungen | 72 | ||
| 4.2. Die Grenzen von Lohnerhöhungen | 73 | ||
| 4.3. Beherrschung der höheren Gehälter und Honorare | 74 | ||
| 4.4. Die Machbarkeit einer solchen Politik | 74 | ||
| 4.5. Schlußbemerkungen | 75 | ||
| Literaturhinweise | 75 | ||
| Gernot Gutmann: Das Beschäftigungsproblem in kollektivistischen Wirtschaftsordnungen | 77 | ||
| I. | 77 | ||
| II. | 80 | ||
| III. | 83 | ||
| IV. | 91 | ||
| Lothar F. Neumann: Sozialökonomische und sozialpolitische Beiträge zu Problemen des Arbeitsmarktes | 93 | ||
| Josef Stingl: Möglichkeiten und Grenzen der Arbeitsmarktpolitik | 117 | ||
| 1. Arbeitsmarkt und politisches System | 117 | ||
| 2. Aktuelle Arbeitsmarktperspektiven | 119 | ||
| 3. Arbeitsmarktausgleich als gesetzlicher Auftrag | 120 | ||
| 4. Möglichkeiten und Grenzen arbeitsmarktpolitischen Handelns | 123 | ||
| Bodo B. Gemper: „Recht auf Arbeit“– Politikum oder Problem ökonomischer Gesetzmäßigkeit und Realisierbarkeit? | 129 | ||
| 1. Politische Ökonomie der Arbeit | 129 | ||
| 2. „Recht auf Arbeit“ als politische Forderung | 131 | ||
| 3. „Recht auf Arbeit“ und Verfassungsrecht | 133 | ||
| 4. Eine deklamatorische Forderung | 133 | ||
| 5. Soziale Verantwortung | 135 | ||
| 6. Aspekte | 136 | ||
| 7. Schlüsselproblem mit unterschiedlicher Basis | 137 | ||
| 8. Prinzipielle Bedenken | 138 | ||
| 9. Chance und Aufgabe | 140 | ||
| 10. Auftrag | 141 | ||
| 3. Struktur und Funktionen sozialer Systeme | 143 | ||
| Wilhelm Haferkamp: Wandel und Stabilität in der Weltwirtschaft | 145 | ||
| I. | 145 | ||
| II. | 146 | ||
| III. | 148 | ||
| IV. | 150 | ||
| Otto Schlecht: Deutsche Lokomotive oder europäischer Konvoi in der Wirtschaftspolitik? | 153 | ||
| II. | 154 | ||
| III. | 154 | ||
| IV. | 155 | ||
| V. | 156 | ||
| VI. | 157 | ||
| VII. | 158 | ||
| VIII. | 159 | ||
| IX. | 159 | ||
| X. | 162 | ||
| XI. | 162 | ||
| XII. | 163 | ||
| Karl C. Thalheim: Aktuelle Funktionsprobleme einer zentral geplanten und gelenkten Wirtschaft im Spiegel der Diskussionen in der DDR | 167 | ||
| 1. Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Bewegungserscheinungen im Wirtschaftssystem der DDR | 167 | ||
| 2. Die „wissenschaftlich-technische Revolution“ als Forderung und Aufgabe | 170 | ||
| 3. Der Übergang von extensivem zu intensivem Wirtschaftswachstum und das Schicksal des „Neuen Ökonomischen Systems“ von 1963 | 171 | ||
| 4. Grundsätze der Wirtschaftspolitik seit 1971 | 172 | ||
| 5. Die Auffassungen Otto Reinholds, Günter Mittags und Erich Honeckers über Wirtschaftssystem und Wirtschaftspolitik | 174 | ||
| 6. Die gemeinsame Tagung der Politökonomen der Sowjetunion und der DDR in Moskau (Dezember 1977) | 176 | ||
| 7. Wege zur Verbesserung des Wirtschaftssystems der DDR | 181 | ||
| 8. Zukunftsaussichten | 184 | ||
| Wilhelm Hankel: Integrationsdefizit: Währungspolitik | 187 | ||
| 1. Zusammenhänge klären | 187 | ||
| 2. Geld, binnenwirtschaftlicher Entwicklungs- und Integrationsmotor | 188 | ||
| 3. Zahlungsbilanzausgleich oder -finanzierung? | 193 | ||
| 4. Zahlungsbilanzkredite privat oder öffentlich? | 199 | ||
| 5. Überregionale oder welteinheitliche Währungsräume? | 203 | ||
| 6. Weltzentralbank von oben oder von unten? | 206 | ||
| Friedrich Geigant: Gralshüter im Tempel der reinen Sachgesetzlichkeit? Zur Rolle des Sachverstands in der Geld- und Kreditpolitik | 209 | ||
| 1. Berufungsprozeduren | 209 | ||
| 2. Gesetzliche Anforderungen | 210 | ||
| 3. Strukturerfordernisse | 212 | ||
| 4. Sachverstand | 213 | ||
| 5. Politik | 214 | ||
| 6. Optimale Politik | 215 | ||
| 7. Stringenz der Aufgabendefinition | 215 | ||
| 8. Zielspektrum und politische Qualifikation | 216 | ||
| 9. Gestaltende Politik | 218 | ||
| 10. Resümee | 218 | ||
| Udo Kollatz: Deutschland zwischen Vergangenheit und Zukunft Verständnisdefizite in unserem Verhältnis zur Dritten Welt | 221 | ||
| 1. Zum Thema | 221 | ||
| 2. Zur Ausgangslage: Ökonomische Konsequenzen der Teilung Deutschlands | 222 | ||
| 2.1 Verkürzende Perspektiven des üblichen Systemvergleichs | 224 | ||
| 2.2 Systemunabhängige Parallelitäten | 226 | ||
| 3. Optionen und Alternativen | 228 | ||
| 3.1 Die Europäische Gemeinschaft | 228 | ||
| 3.2 Der Osthandel | 231 | ||
| 3.3. Die Dritte Welt als neues ökonomisches Kraftfeld | 232 | ||
| 4. Partnerschaft mit den Entwicklungsländern: Voraussetzungen und Konsequenzen | 236 | ||
| Bernhard Kapp: Ost-West-Kompensationsgeschäfte – Ein Anachronismus? | 242 | ||
| Vorbemerkung | 242 | ||
| 1. Volkswirtschaftliche Beziehungen zwischen extremen Wirtschaftssystemen | 242 | ||
| 2. Industrielle Kooperation zwischen Ost und West | 243 | ||
| 2.1. Definition und begriffliche Abgrenzung | 244 | ||
| 2.2. Formen der Kooperationsbeziehungen | 244 | ||
| 3. Kompensationsgeschäfte als Sonderfall des Ost-West-Handels | 245 | ||
| 3.1. Arten der Kompensation nach der Zielsetzung | 245 | ||
| 3.2. Formen der praktischen Ausgestaltung | 246 | ||
| 3.3. Ursachen und Motive | 247 | ||
| 3.4 Probleme für Ost und West | 249 | ||
| 4. Beurteilung | 253 | ||
| 4. Sozialparteien in der Verantwortung | 255 | ||
| Hans Bolewski: Ortsbestimmung der Ethik | 257 | ||
| 1. Auf der Suche nach Grundwerten | 257 | ||
| 2. Ethik und technischer Prozeß | 260 | ||
| 3. Der Verlust der Glaubwürdigkeit | 262 | ||
| 4. Das Sittliche in der Gruppe und im öffentlichen Leben | 264 | ||
| 5. Ortsbestimmung des Sittlichen | 266 | ||
| 6. Die Institutionalisierung der moralischen Diskussion | 268 | ||
| Ernst Günter Vetter: Gewerkschaften in einer liberalen Ordnung | 273 | ||
| I. | 273 | ||
| II. | 274 | ||
| III. | 275 | ||
| IV. | 276 | ||
| V. | 278 | ||
| Winfried Pahlow: Das dynamische Element im Unternehmerverhalten. Zur Analyse einer konstitutiven Bedingung wirtschaftlichen Wandels | 281 | ||
| 1. Problemstellung, Begriffe, Kriterien | 281 | ||
| 2. Die unabhängigen Variablen: Wertsystem und technischer Entwicklungsstand | 284 | ||
| 3. Veränderungen in Struktur und Organisation der Wirtschaft | 287 | ||
| 4. Marktphase und Unternehmertypus | 288 | ||
| 5. Das Moment der Zeit im Unternehmerverhalten | 291 | ||
| 6. Ergebnis und Schlußfolgerung | 293 | ||
| Ernst Wolf Mommsen: Die gesellschaftspolitische Verantwortung des Unternehmers | 295 | ||
| Werner Steuer: Die Grenzen der Tarifautonomie | 303 | ||
| 1. Abnehmende Flexibilität der Lohnpolitik | 303 | ||
| 2. Ursachen der verteilungsorientierten Lohnpolitik | 305 | ||
| 3. Unhaltbare Kaufkrafttheorie | 307 | ||
| 4. Die Rolle der Vollbeschäftigungsgarantie | 308 | ||
| 5. Ungleichgewicht von Macht und Verantwortung beseitigen | 311 | ||
| Wolfgang Schertz: Tarifgestaltung zwischen Innovationsnotwendigkeit und sozialer Verpflichtung | 315 | ||
| 1. Ausgangslage | 315 | ||
| 2. Besonderheiten des Industriebereiches Druck | 316 | ||
| 3. Veränderte soziale Rahmenbedingungen des technischen Fortschritts | 317 | ||
| 4. Neue Technologien und ihre Anwendung sind die Grundvoraussetzung der Wettbewerbswirtschaft | 319 | ||
| 4.1. Unternehmen können Innovation nicht ausweichen | 319 | ||
| 4.2. Innovationen machen die Volkswirtschaft international wettbewerbsfähig | 320 | ||
| 4.3. Innovationen verbessern die Arbeitsbedingungen | 321 | ||
| 5. Folgen der Anwendung neuer Technologien | 321 | ||
| 5.1. Kapitalbelastung steigt durch neue Produktionstechniken | 321 | ||
| 5.2. Innovationen erhöhen das Fehlschlagsrisiko und erfordern höhere Erfolgsprämien | 322 | ||
| 5.3. Innovation erfordert Steigerung der Mobilität | 323 | ||
| 6. Soziale Verpflichtung als Korrekturkriterium bei Investitionen | 326 | ||
| 7. Möglichkeiten und Grenzen der Tarifgestaltung | 327 | ||
| Heinz O. Vetter: Wissenschaftliche Politikberatung der Gewerkschaften und gewerkschaftliche Wissenschaftspolitik | 229 | ||
| I. | 229 | ||
| II. | 331 | ||
| III. | 332 | ||
| IV. | 334 | ||
| V. | 337 | ||
| 5. Struktur und Verteilung, Toleranzbereiche freiheitlicher Gesellschaftsordnung | 339 | ||
| Wilhelm Krelle: Maßnahmen und Pläne zur gleichmäßigeren Vermögensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland | 341 | ||
| 1. Die Bedeutung der Einkommens- und Vermögensverteilung | 341 | ||
| 2. Einige Vorbemerkungen zur Definition von Vermögen | 343 | ||
| 3. Die Entwicklung der Vermögen und ihrer Verteilung in der Bundesrepublik | 345 | ||
| 4. Bisherige Maßnahmen zur gleichmäßigeren Vermögensverteilung in der Bundesrepublik | 356 | ||
| 4.1. Sonderausgaben nach § 10 Einkommensteuergesetz | 356 | ||
| 4.2. Sparprämiengesetze | 357 | ||
| 4.3. Wohnungsbauprämien und andere Vergünstigungen für den privaten Wohnungsbau | 357 | ||
| 4.4. Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer | 358 | ||
| 4.5. Freiwillige Leistungen von Arbeitgebern: die Partnerschaftsbewegung | 359 | ||
| 5. Auswirkungen der bisherigen Maßnahmen zur gleichmäßigeren Vermögensverteilung | 361 | ||
| 6. Jetziger Stand der vermögenspolitischen Diskussionen in der Bundesrepublik. Pläne zur weiteren Förderung der Vermögensbildung | 362 | ||
| Hermann Adam: Realisierungschancen vermögenspolitischer Konzeptionen | 367 | ||
| 1. Typisierung der vermögenspolitischen Konzepte | 367 | ||
| 2. Realisierungschancen | 369 | ||
| 2.1. Staatliche Sparförderung | 369 | ||
| 2.2. Tarifvertraglich vereinbarte vermögenswirksame Leistungen (Investivlohn) | 370 | ||
| 2.3. Freiwillige betriebliche Vermögensbeteiligungen | 372 | ||
| 2.4. Die überbetriebliche Ertragsbeteiligung | 373 | ||
| 3. Ausblick | 375 | ||
| Volker Hauff: Strukturwandel, technischer Fortschritt und soziale Verantwortung | 377 | ||
| 1. Modernisierung der Volkswirtschaft | 377 | ||
| 2. Technischer Wandel am Beispiel Elektronik | 377 | ||
| 3. Innovation ist häufig ein Substitutionsprozeß | 378 | ||
| 4. Staatliche Förderung | 379 | ||
| 5. Technischer Wandel und strukturelle Veränderungen | 380 | ||
| Hans-Rudolf Peters: Ordnungspolitische Grenzen sektoraler Strukturpolitik in marktwirtschaftlich orientierten Ordnungen | 383 | ||
| 1. Problemstellung | 383 | ||
| 2. Erläuterung der thematischen Begriffe | 384 | ||
| 2.1. Begriff und Arten sektoraler Strukturpolitik | 384 | ||
| 2.2. Wirtschaftsordnung und Funktionen marktwirtschaftlich orientierter Ordnungen | 386 | ||
| 3. Systemimmanente Toleranzbreite und ordnungspolitische Grenzen | 388 | ||
| 4. Ziel- und ordnungskonforme strukturpolitische Mittelwahl | 389 | ||
| 5. Arten sektoraler Strukturpolitik und ihre ordnungspolitische Problematik | 391 | ||
| 5.1. Sektorale Strukturordnungspolitik | 391 | ||
| 5.2. Sektorale Strukturwandelpolitik | 395 | ||
| 5.3. Sektorale Strukturfolgenpolitik | 398 | ||
| 5.4. Sektorale Strukturplanungspolitik | 399 | ||
| Rolf Krengel: Zur Abhängigkeit der Bruttoproduktion und der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital von der sektoralen Struktur der Endnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland. Ergebnisse der Input-Output-Rechnung des DIW 1962 und 1972 | 403 | ||
| 1. Ziel der Untersuchung | 403 | ||
| 2. Theoretische Grundlagen | 403 | ||
| 3. Statistische Grundlagen | 405 | ||
| 3.1. Bruttoproduktion | 405 | ||
| 3.2. Beschäftigung | 405 | ||
| 3.3. Brutto-Anlagevermögen | 405 | ||
| 4. Die Abhängigkeit einiger statistischer Kennziffern von der Struktur der Endnachfrage | 407 | ||
| 5. Einige Ergebnisse der beiden Tabellen des statistischen Anhangs | 408 | ||
| 6. Die Abhängigkeit von der Struktur der Endnachfrage | 409 | ||
| 6.1. Bruttoproduktion | 409 | ||
| 6.2. Erwerbstätige | 409 | ||
| 6.3. Brutto-Anlagevermögen | 409 | ||
| 6.4. Arbeitsproduktivität | 410 | ||
| 6.5. Kapitalproduktivität | 410 | ||
| 6.6. Kapitalintensität | 410 | ||
| 7. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse | 411 | ||
| 8. Statistischer Anhang | 412 | ||
| Herbert Ehrenberg: Die Rolle der Steinkohle in der deutschen Energiepolitik | 423 | ||
| 1. Der Ausklang des Ölzeitalters | 423 | ||
| 2. Weiterer Energieverbrauchszuwachs unvermeidlich | 424 | ||
| 3. Begrenzung des Ölverbrauchszuwachses aus Solidarität zur Dritten Welt | 425 | ||
| 4. Die energiepolitische Strategie der Bundesregierung | 426 | ||
| 5. Probleme des energiepolitischen Zeithorizontes | 429 | ||
| Peter Rosenberg: Zur Interdependenz von Sozial- und Gesundheitspolitik. Probleme und Gestaltungsmöglichkeiten eines Systems der Gesundheitssicherung | 431 | ||
| 1. Die Aufgabengebiete der Sozial- und Gesundheitspolitik | 431 | ||
| 1.1. Unterschiedliche politische Strategien | 432 | ||
| 1.2. Ein Drittel des Sozialbudgets für „Gesundheit“ | 433 | ||
| 2. Das Recht der sozialen Krankenversicherung und dessen Wirkungen auf das Gesundheitswesen | 434 | ||
| 3. Fehlentwicklungen und Steuerungsprobleme im System der Gesundheitssicherung | 436 | ||
| 3.1. Therapieorientierte Forschung | 437 | ||
| 3.2. Ausbildungsinhalte und Berufsstruktur im Gesundheitswesen | 437 | ||
| 3.3. Prävention: Vorsorge besser als Früherkennung | 438 | ||
| 3.4. Effektivität und Effizienz der kurativen Versorgung | 440 | ||
| 4. Schlußfolgerungen für eine zielkonforme Gestaltung des Systems der Gesundheitssicherung | 441 | ||
| 6. Öffentliche Wirtschaft zwischen Politik und Recht | 445 | ||
| Hans Apel: Länderinteressen und gesamtstaatliche Handlungsfähigkeit | 447 | ||
| 1. Zweifel | 447 | ||
| 2. Kriterien | 448 | ||
| 3. Fehlverhalten | 448 | ||
| 3.1. Beispiele der Verantwortungslosigkeit | 449 | ||
| 3.2. Zu Lasten des Bundes | 450 | ||
| 4. Disparitäten | 451 | ||
| 5. Dem Bürger verpflichtet | 453 | ||
| Herbert Weichmann: Die Verschuldungsgrenze der öffentlichen Hand | 455 | ||
| 1. Einleitung | 455 | ||
| 2. Indikatoren für die Bewertung der Verschuldungsfähigkeit | 456 | ||
| 2.1. Vorbehalte bei der Bewertung der Indikatoren | 456 | ||
| 2.2. Verschiedener Charakter der Indikatoren | 456 | ||
| 2.2.1. Die verschiedenen Indikatoren | 456 | ||
| 2.2.1.1. Ökonomische Indikatoren | 456 | ||
| 2.2.1.2. Fiskalische Indikatoren | 458 | ||
| 2.2.1.3. Volkswirtschaftliche Indikatoren | 460 | ||
| 2.2.1.4. Sonstige Indikatoren | 462 | ||
| 3. Schluß | 462 | ||
| Fritz Fabricius: Der Einfluß der Europäischen Sozialcharta auf nationale rechtliche Bewertungen von Streik und Aussperrung an Grundsatzfragen dargestellt am Bundesrecht der Bundesrepublik Deutschland | 463 | ||
| 1. Einleitung | 463 | ||
| 2. Das Problem eines Streikrechts und eines Aussperrungsrechts in der Bundesrepublik | 465 | ||
| 2.1. Die unterschiedlichen rechtlichen Beurteilungen eines Streiks | 465 | ||
| 2.1.1. Keine Anerkennung eines Streikrechts im deutschen Recht | 465 | ||
| 2.1.2. Verfassungsrechtliche Gewährleistung des Streiks (der Aussperrung) | 466 | ||
| 2.1.3. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts | 468 | ||
| 2.1.4. Grenzen des Streiks (der Aussperrung) | 469 | ||
| 2.2. Besonderheiten für die Aussperrung | 470 | ||
| 2.3. Zusammenfassung | 470 | ||
| 3. Zweck, themenbezogener Inhalt und Auslegung der Europäischen Sozialcharta | 471 | ||
| 3.1. Zweck | 471 | ||
| 3.2. Themenbezogene Konkretisierung in Teil I | 472 | ||
| 3.3. Themenbezogene Konkretisierung in Teil II | 473 | ||
| 3.4. Auslegungszuständigkeit und Auslegungsmethoden | 474 | ||
| 3.5. Auslegung des Art. 6 Nr. 4 | 475 | ||
| 3.5.1. Anerkennung eines Streikrechts als Individualrechtkeine notwendige Verbindung zum Recht auf Vereinigungsfreiheit | 475 | ||
| 3.5.2. Grenzen des Streikrechts | 477 | ||
| 3.5.3. Anerkennung der Aussperrung in der Europäischen Sozialcharta | 479 | ||
| 4. Problemorientierte, weiterführende Zusammenfassung | 480 | ||
| 5. Streik und Aussperrung in der Wirtschaft einer freiheitlichen, individualistisch-demokratischen Gesellschaft | 483 | ||
| 5.1. Das Prinzip der Marktwirtschaft als Bestandteil einer individualistisch-demokratischen Gesellschafts-, Wirtschafts- und Rechtsordnung | 484 | ||
| 5.1.1. Das gesellschaftspolitische Modell einer individualistischen Gesellschaft | 484 | ||
| 5.1.2. Das Modell der freien Marktwirtschaft | 484 | ||
| 5.1.3 Naturrechtliche Bezüge des gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Grundprinzips | 485 | ||
| 5.2. Das Versagen des Marktes in bezug auf die Entwicklung der Rechtsstellung des Arbeitsnehmers und seine Ursachen – Streik als Folge | 486 | ||
| 5.2.1. Kein Eigentum an Produktionsmitteln | 486 | ||
| 5.2.2. Nichtbeachtung des naturrechtlichen, aus dem „angeborenen Recht der Freiheit“ fließenden Grundrechts „Arbeit führt zu Eigentum des Arbeiters am Produkt seiner Arbeit“ | 486 | ||
| 5.2.2.1. § 950 BGB und seine derzeitige Auslegung | 486 | ||
| 5.2.2.2. Begründung des Menschenrechts „Arbeit führt zu Eigentum des Arbeiters am Produkt seiner Arbeit“ | 487 | ||
| 5.2.2.3. Der Grundsatz „Arbeit führt zu Eigentum des Arbeiters am Produkt seiner Arbeit“ als Prinzip der Marktwirtschaft | 488 | ||
| 5.2.3. Auswirkungen des fehlenden Eigentums an den Produktionsmitteln und des Nichterwerbs des Eigentums an seiner Produktion für die Rechtsstellung des Arbeitnehmers | 490 | ||
| 6. Die rechtliche und tatsächliche Bedeutung von Streik und Aussperrung – Folgerungen aus der Nichtbeachtung des elementaren Menschenrechts „Arbeit führt zu Eigentum des Arbeiters am Produkt seiner Arbeit“ | 491 | ||
| 6.1. Anerkennung eines Streikrechts als Hilfsrecht zur Vermeidung von unerträglichen Folgen aus der Verletzung des elementaren Menschenrechts „Arbeit führt zu Eigentum“ | 491 | ||
| 6.2. Gegenstand und Zweck des Streikrechts – die Frage nach dem „gerechten Lohn“ | 492 | ||
| 6.3. „Gerechte Arbeitsbedingungen“, „gerechtes Entgelt“ und gewerkschaftliche Strategie | 493 | ||
| 6.4. Effizienz von Verhandlungen über Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen und von Streiks | 496 | ||
| 6.5. Rechtsnatur des Streiks | 496 | ||
| 6.6. Begrenzte Anerkennung eines Aussperrungsrechts | 499 | ||
| 7. Das Verhältnis des Art. 6 Nr. 4 der Charta zur innerstaatlichen Rechtsordnung | 499 | ||
| 8. Zusammenfassendes Ergebnis | 507 | ||
| Robert Weimar: Zur Funktionalität der Umweltgesetzgebung im industriellen Wachstumsprozeß | 513 | ||
| 1. Umweltgestaltung als Anforderung und Zielorientierung legislativen Handelns | 513 | ||
| 2. Instrumente in der Theorie der Umweltgesetzgebung | 514 | ||
| 3. Umweltpolitische Zielvorstellungen und problemorientierte Zielbildungsprozesse | 516 | ||
| 4. Zur Frage des Verursacherprinzips in der Umweltgesetzgebung | 519 | ||
| 5. Wertsetzung bei kollidierenden Politikzielen | 521 | ||
| 6. Perspektiven und Grenzen gesetzlicher Umweltstandards | 525 | ||
| Walter Hesselbach: Gemeinwirtschaftliche Aufgaben im wirtschaftlichen Konzentrationsprozeß | 527 | ||
| 1. Von der Markt- zur Unternehmenskonzentration | 529 | ||
| 2. Die Rolle der Großunternehmen | 530 | ||
| 3. Das Problem der Nachfragemacht | 532 | ||
| 4. Wirtschaftliche Größe im Wettbewerb | 533 | ||
| 5. Das Dilemma der Wettbewerbspolitik | 534 | ||
| 6. Strukturbezogene Wettbewerbspolitik: die Aufgabe der Gemeinwirtschaft | 536 | ||
| 7. Alternativen als Reformimpulse | 543 | ||
| Rudolf Meimberg: Zur Frage des Vorhandenseins von Alternativen unter marktwirtschaftlich geprägten Wirtschaftsordnungen | 545 | ||
| Ludwig Bress: Die Bewältigung technologischer Umbrüche ein Paradigma-Wechsel für die DDR-Forschung? | 557 | ||
| 1. Vorbemerkung | 557 | ||
| 2. Das Paradigma der Effizienz und die ordnungstheoretische Analyse der DDR | 560 | ||
| 3. Die Chance einer Neuformierung | 563 | ||
| 4. Entwurf eines technologischen Systemvergleichs | 564 | ||
| 4.1. Technologisches Problembewußtsein | 564 | ||
| 4.2. Institutionelle Bildungsinfrastruktur | 565 | ||
| 4.3. Reflexionspotential der amtierenden Eliten | 566 | ||
| 4.4. Ökonomische Infrastruktur und Innovationsbereitschaft | 568 | ||
| 4.5. Die ökonomische Integration und der Zugang zum internationalen Kapitaltransfer | 569 | ||
| 5. Auswertung | 571 | ||
| Ludwig Bußmann: Zum Zeitbedarf von politischen Innovationen | 573 | ||
| 1. Reformpolitik und Reformfähigkeit | 573 | ||
| 2. Der Zeitfaktor bei wirtschaftlicher Innovation | 574 | ||
| 3. Der Zeitbedarf von politischen Innovationen | 576 | ||
| 3.1. Der Prozeßcharakter von politischen Innovationen | 577 | ||
| 3.2. Bestimmungsgründe des Zeitbedarfes | 579 | ||
| 4. Der Zeitbedarf ausgewählter politischer Innovationen | 580 | ||
| 4.1. Die Mitbestimmung | 580 | ||
| 4.2. Die Vermögensbildung in Sozialkapitalfonds | 583 | ||
| 4.3. Der Praxisbezug des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums | 585 | ||
| 5. Zusammenfassende Schlußfolgerungen | 588 | ||
| Philipp Herder-Dorneich: Nicht-Markt-Ökonomik als Theorie der Sozialpolitik | 589 | ||
| 1. Das Benennungsproblem | 589 | ||
| 2. Theoriedefizite in der Sozialpolitik | 590 | ||
| 3. Die ökonomische Theorie der Sozialpolitik | 590 | ||
| 4. Erweiterung des neoklassischen Instrumentariums | 591 | ||
| 5. Nicht-Markt-Ökonomik als umfassender Theorieansatz | 592 | ||
| 6. Der Grundgedanke der Nicht-Markt-Ökonomik | 593 | ||
| 6.1. Vorteile für die Lehre (didaktische Vorteile) | 593 | ||
| 6.2. Vorteile für die Forschung (heuristische Vorteile) | 594 | ||
| 7. Ein Anwendungsbeispiel: Der Arbeitsmarkt | 594 | ||
| Gerwulf Singer: Legitimation im Spätkapitalismus Anmerkungen zu Jürgen Habermas’ Konsensustheorie der Wahrheit | 599 | ||
| 1. Legitimationsmodelle | 599 | ||
| 2. Rekonstruktives Modell der Legitimation | 603 | ||
| 2.1. Konsensustheorie der Wahrheit | 603 | ||
| 2.2. Ist Konsens Ergebnis diskursiver Willensbildung? | 607 | ||
| 2.2.1. Ideale Sprechgemeinschaft und Sprachinvarianz | 607 | ||
| 2.2.2. Paradigmatischer Konsens ist prästabilisiert | 611 | ||
| 2.2.3. Wahrheitskriterium und praktische Wahrheit | 616 | ||
| 3. Zusammenfassung und Bewertung | 618 | ||
| Karl Kühne: Die neuere Imperialismusdebatte | 621 | ||
| 1. Vorbemerkung | 621 | ||
| 2. Anpassung der Theorie an die neue Lage | 621 | ||
| 3. Die Doppeldeutigkeit des Imperialismus-Begriffs | 622 | ||
| 4. Neuere Theorien zum Neo-Imperialismus | 624 | ||
| 5. Frühe Ratschläge: „Imperialisten, kehrt auf die Schiffe zurück“ | 625 | ||
| 6. Die These vom hohen Gewinn der Metropolen | 626 | ||
| 7. Notwendigkeit neuer Erklärungen | 628 | ||
| 8. Das Rüstungsproblem | 629 | ||
| Namenregister | 633 | ||
| Sachregister | 639 |
