Logik als Erfahrungswissenschaft
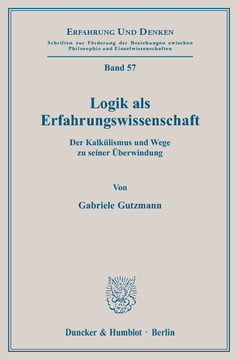
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Logik als Erfahrungswissenschaft
Der Kalkülismus und Wege zu seiner Überwindung
Erfahrung und Denken, Vol. 57
(1980)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Erstes Kapitel: Der Kalkülismus in der Logik | 13 | ||
| 1. Zur Herausbildung des gegenwärtigen Kalkülismus | 13 | ||
| 1.1 Nicht-Empirie | 15 | ||
| 1.2 Verdrängung der empirischen Logik | 17 | ||
| 2. Kalkülverwendungsweisen | 18 | ||
| 2.1 Zum Modellbegriff | 18 | ||
| 2.1.1 Urteile und Zielsetzungen | 20 | ||
| 2.1.2 Modelle | 22 | ||
| 2.1.3 Gegenstandsmodelle und Zeichenmodelle | 23 | ||
| 2.2 Formal-analogische Kalkülverwendungsweise | 24 | ||
| 2.3 Symbolische Kalkülverwendungsweise | 25 | ||
| 3. Drei Gestalten des Kalkülismus in der Logik | 27 | ||
| 3.1 Reiner Kalkülismus | 28 | ||
| 3.1.1 Kalküle als Gegenstand: P. LORENZEN | 28 | ||
| 3.1.1.1 Handlungskreis und Kalkülhandeln | 29 | ||
| 3.1.1.2 Nicht-empirische Wahrheiten | 30 | ||
| 3.1.1.3 Zum Regelbegriff | 32 | ||
| 3.1.1.4 Ambivalenz zwischen Zeichen und Figuren | 33 | ||
| 3.1.2 Kalkülstrukturen als Gegenstand: R. CARNAP | 34 | ||
| 3.1.2.1 Formen und Formbegriffe | 35 | ||
| 3.1.2.2. Nicht-Empirie | 36 | ||
| 3.1.2.3 Kalküle als Sprachen | 37 | ||
| 3.2 Kalküle und logischer Deutungsbezug | 38 | ||
| 3.2.1 Von der Syntax zur Semantik | 38 | ||
| 3.2.2 Verwendungsweisen von Kalkülen bei logischem Deutungsbezug | 39 | ||
| 3.2.3 Logische Deutungsbezüge von Kalkülen | 40 | ||
| 3.2.4 Gedeuteter Kalkülismus | 41 | ||
| 3.2.4.1 Intuitivismus: logische Gesetze | 41 | ||
| 3.2.4.2 Intuitivismus: Zur Beziehung zwischen Kalkülfigur und Bedeutung und Bezeichnetem | 43 | ||
| 3.2.4.3 Weitere Mechanismen, Deutungsbezug und Kalkülismus zu vereinbaren | 48 | ||
| 3.2.4.4 Die VEATCH-COPI-Kontroverse | 53 | ||
| 3.2.5 Kalkülismus mit Deutung | 56 | ||
| 3.3 Fazit | 58 | ||
| Zweites Kapitel: Logik als Erfahrungswissensdiaft? | 59 | ||
| 1. Nicht-empirische Positionen | 60 | ||
| 1.1 Piatonismus | 60 | ||
| 1.2 Nicht-platonistische Nicht-Empirie | 62 | ||
| 2. Empirische Positionen | 65 | ||
| 2.1 Sprache und Denken | 66 | ||
| 2.2 Einige Einwände gegen eine empirisch-psychologische Logik | 69 | ||
| 2.2.1 Unmöglichkeit | 70 | ||
| 2.2.2 Theoretische Einwände | 71 | ||
| 2.2.3 Moral | 76 | ||
| 2.3 Intentionen als Gegenstandsbereich einer nicht-kalkülistischen empirischen Logik | 76 | ||
| 3. Zur Relevanz nicht-kalkülistischer Logik für andere Bereiche der Wissenschaft | 79 | ||
| 3.1 Systemtheorie und Kybernetik | 81 | ||
| Drittes Kapitel: Intentionale Aussagenlogik | 85 | ||
| 1. Grundannahmen der Aussagenlogik | 86 | ||
| 2. Einfache Aussagen und Wahrheit | 87 | ||
| 2.1 Behandlung dieses Problems in der kalkülistischen Aussagenlogik | 87 | ||
| 2.1.1 Objektivismus | 88 | ||
| 2.1.2 Kritik objektivistischer Wahrheitstheorien | 89 | ||
| 2.2 Modelle zu einer intentionalen Logik von Aussagen bzw. Urteilen | 92 | ||
| 2.2.1 Zur Methode | 92 | ||
| 2.2.2 Ergebnisse der Introspektion | 94 | ||
| 2.2.3 Modelle | 95 | ||
| 2.2.3.1 Wahrheit und Richtigkeit | 98 | ||
| 2.2.3.2 Modalitäten | 101 | ||
| 2.2.4 Folgeprobleme | 103 | ||
| 2.2.4.1 Geltungsbedingungen | 103 | ||
| 2.2.4.2 Gegenstandsbezug | 106 | ||
| 2.2.4.3 Gegenstände wahrer negativer und unwahrer positiver Urteile | 110 | ||
| 2.2.4.4 Gleiche Sätze als Ausdruck verschiedener Zweck- Mittel-Beziehungen von Urteilen | 112 | ||
| 3. Aussageverknüpfungen | 113 | ||
| 3.1 Behandlung von Verknüpfungen in der traditionellen Aussagenlogik | 113 | ||
| 3.1.1 Verschiedene Funktionsbegriffe | 114 | ||
| 3.1.2 Verschiedene Funktionsbegriffe in der Aussagenlogik | 115 | ||
| 3.1.3 Argumente und Argumentwerte | 116 | ||
| 3.1.4 Beziehung der Wahrheitswerte von Verknüpfungs- und Bestandteilsaussagen zueinander | 118 | ||
| 3.2 Modelle zu einer intentionalen Logik von Aussage- bzw. Urteilsverknüpfungen | 119 | ||
| 3.2.1 Ergebnisse der Introspektion | 119 | ||
| 3.2.2 Modelle | 120 | ||
| 3.2.3 Folgeprobleme | 124 | ||
| 3.2.3.1 Wahrheitsbedingungen | 125 | ||
| Viertes Kapitel: Verwendung von Aussagenlogik: Gesetz und Kausalität | 130 | ||
| 1. Gesetz | 130 | ||
| 1.1 Möglichkeitsspielräume und Konnektivität | 132 | ||
| 1.1.1 Die Raben-Paradoxie | 135 | ||
| 1.2 Allgemeinheit und Transfer | 139 | ||
| 1.3 Vorschlag eines Gesetzesbegriffs | 144 | ||
| 1.4 Gesetze der Aussagenlogik | 147 | ||
| 1.5 Hinweis auf H. REICHENBACH | 151 | ||
| 2. Kausalität | 152 | ||
| 2.1 Zur Möglichkeit einer formalen Charakterisierung | 152 | ||
| 2.2 Verschiedene Auffassungen über Kausalität | 156 | ||
| 2.3 Ansätze und Probleme einer formalen Charakterisierung von Kausalität | 160 | ||
| 2.3.1 Mögliche Glieder der Kausalrelation | 160 | ||
| 2.3.2 Die Kausalrelation | 162 | ||
| 2.3.3 Zur Bestimmung von Kausalität mittels konnektiver Urteile und spezifischer Gliedangaben | 164 | ||
| 2.3.3.1 Überprüfungsbedingungen von Kausalurteilen | 165 | ||
| 2.3.3.2 Konnektive Beziehungen bei Berücksichtigung von Überprüfungsbedingungen | 166 | ||
| 2.4 Glieder von Kausalrelationen als Konstituenten von Konstitutionskomplexen | 171 | ||
| 2.4.1 Folgeprobleme | 172 | ||
| 2.5 Kausalketten, mehrfache Ursachen, äquivalente Ursachen und Wirkungen | 173 | ||
| 2.5.1 Kausalketten | 174 | ||
| 2.5.2 Mehrfache Ursachen | 175 | ||
| 2.5.3 Äquivalente Ursachen und Wirkungen | 176 | ||
| Literatur | 179 | ||
| Verzeichnis grundlegender Termini | 192 | ||
| Namenverzeichnis | 194 |
