Gegen- und Kompensationsgeschäfte als Marketing-Instrumente im Investitionsgüterbereich
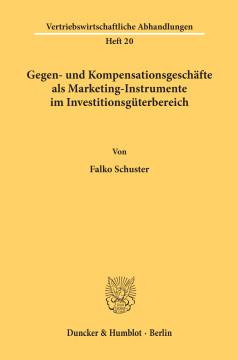
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Gegen- und Kompensationsgeschäfte als Marketing-Instrumente im Investitionsgüterbereich
Vertriebswirtschaftliche Abhandlungen, Vol. 20
(1979)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | V | ||
| Inhaltsverzeichnis | VII | ||
| Abbildungsverzeichnis | XI | ||
| I. Begründung der Aufgabenstellung und Erläuterung der Vorgehensweise | 1 | ||
| II. Begriffliche Abgrenzung | 9 | ||
| 1. Zum Begriff des Investitionsgutes | 9 | ||
| 2. Zum Begriff des Gegengeschäfts | 10 | ||
| III. Erfassung und Analyse reziproker Austauschvorgänge | 16 | ||
| 1. Erscheinungsformen des Gegengeschäfts | 16 | ||
| a) Überblick über die wichtigsten Kriterien zur Einteilung reziproker Austauschvorgänge | 16 | ||
| b) Klassifizierung der Gegengeschäfte im Hinblick auf einzelne Unterscheidungskriterien | 17 | ||
| (1) Ziele bzw. Motive gegengeschäftlichen Handelns | 17 | ||
| (2) Die Zahl der am Gegengeschäft beteiligten Parteien | 20 | ||
| (3) Der Status der am Gegengeschäft beteiligten Organisationen | 25 | ||
| (4) Die relative Machtposition und die Machtausübung der einzelnen Gegengeschäftspartei | 27 | ||
| (5) Die Form des Vertragsabschlusses | 30 | ||
| (6) Die zeitliche Abfolge von Realgüterleistung und Realgütergegenleistung | 34 | ||
| (7) Die Technik des Leistungsausgleichs | 35 | ||
| (8) Das wertmäßige Verhältnis von Realgüterleistung und Realgütergegenleistung | 37 | ||
| (9) Der Grad der materiellen Verbundenheit von Realgüterleistung und Realgütergegenleistung | 39 | ||
| (10) Der Grad der Geschlossenheit des Realgüterkreislaufes | 42 | ||
| (11) Die nationale Zugehörigkeit der am Gegengeschäft beteiligten Organisationen | 47 | ||
| (12) Der wertmäßige Umfang des Gegengeschäfts | 53 | ||
| c) Bestimmungsfaktoren und merkmaisspezifische idealtypische Ausprägungen des Gegengeschäfts — eine zusammenfassende Übersicht | 54 | ||
| 2. Geschäfte im Clearing und Switchgeschäfte als gegengeschäftsnahe Formen des internationalen Güteraustausches | 56 | ||
| a) Geschäfte im Clearing | 56 | ||
| b) Das Switchgeschäft | 60 | ||
| 3. Langfristige reziproke Beziehungen | 72 | ||
| IV. Der gegengeschäftspolitische Entscheidungsprozeß als besondere Form industriellen Absatz- und Beschaffungsverhaltens | 74 | ||
| 1. Die Grundstruktur gegengeschäftspolitischer Entscheidungen | 74 | ||
| 2. Die Besonderheiten industrieller Einkaufs- und Verkaufsprozesse | 76 | ||
| 3. Wechselseitige Beziehungen zwischen Umweltfaktoren und gegengeschäftspolitischen Entscheidungen | 82 | ||
| a) Die gesamtwirtschaftliche Situation | 82 | ||
| b) Die branchenspezifische Wettbewerbssituation und die Konkurrenzbeziehungen | 88 | ||
| c) Die Anbieter-Nachfrager-Beziehung | 98 | ||
| (1) Der grundsätzliche Einfluß der Macht | 98 | ||
| (2) Die den Abschluß von Gegengeschäften begünstigenden Faktoren | 99 | ||
| (a) Der Einfluß der Unternehmensgröße | 99 | ||
| (b) Die Breite des Absatzsortiments | 102 | ||
| (c) Rückwirkungen auf das Konkurrenzverhalten | 106 | ||
| (3) Die die Ablehnung von Gegengeschäften begünstigenden Faktoren | 111 | ||
| d) Die Multiorganisationalität auf der Anbieter- bzw. Nachfragerseite | 113 | ||
| e) Gesetzgebung und Rechtsprechung | 114 | ||
| 4. Wechselseitige Beziehungen zwischen dem Entscheidungsgremium als Ganzes und dem gegengeschäftspolitischen Entscheidungsprozeß | 120 | ||
| a) Die Entscheidungsgremien bei miteinander unverbundenen Absatz- und Beschaffungsentscheidungen als Elemente des gegengeschäftspolitischen Entscheidungsgremiums | 120 | ||
| b) Die Verschmelzung von Buying und Selling Center beim gegengeschäftspolitischen Entscheidungsprozeß | 123 | ||
| c) Die sich bei gegengeschäftspolitischen Entscheidungen ergebenden Probleme und Gestaltungsaufgaben | 127 | ||
| 5. Wechselseitige Beziehungen zwischen den Einstellungen und Verhaltensweisen einzelner Mitglieder des gegengeschäftspolitischen Entscheidungsgremiums und dem reziproken Entscheidungsprozeß | 132 | ||
| a) Die Bedeutung der Einstellungen und Verhaltensweisen der Einkäufer für den gegengeschäftspolitischen Entscheidungsprozeß | 132 | ||
| b) Die Bedeutung der Einstellungen und Verhaltensweisen der Verkäufer für den gegengeschäftspolitischen Entscheidungsprozeß | 147 | ||
| c) Die Bedeutung der Einstellungen und Verhaltensweisen der Entscheider für den gegengeschäftspolitischen Entscheidungsprozeß | 153 | ||
| d) Die Bedeutung der Einstellungen und Verhaltensweisen weiterer Funktionsträger im kombinierten Buying/Selling Center für den gegengeschäftspolitischen Entscheidungsprozeß | 157 | ||
| e) Gestaltungsaufgaben, die sich aus den Einstellungen und Verhaltensweisen der einzelnen Funktionsträger gegenüber dem gegengeschäftspolitischen Entscheidungsprozeß ergeben | 160 | ||
| 6. Wechselseitige Beziehungen zwischen der Untemehmungsorganisation und dem gegengeschäftspolitischen Entscheidungsprozeß | 162 | ||
| a) Hauptfragestellungen im Zusammenhang mit der organisatorischen Eingliederung der gegengeschäftspolitischen Funktion | 162 | ||
| b) Probleme einer dezentralisierten Gegengeschäftspolitik | 163 | ||
| c) Alternativen einer Zentralisierung der Gegengeschäftspolitik | 168 | ||
| d) Verbreitung, Aufgaben und hierarchische Einordnung von Spezialabteilungen für gegengeschäftspolitische Aufgaben | 172 | ||
| (1) Verbreitung von Spezialabteilungen für gegengeschäftspolitische Aufgaben | 172 | ||
| (2) Aufgaben einer Spezialabteilung für Gegengeschäfte | 174 | ||
| (3) Eingliederung einer Spezialabteilung für Gegengeschäfte in die Untemehmensorganisation | 182 | ||
| V. Ausgewählte Probleme einer Einbettung der Gegengeschäftspolitik in die Absatz- und Beschaffungsstrategie | 187 | ||
| 1. Auswirkungen der Gegengeschäftspolitik auf ausgewählte absatz- und beschaffungspolitische Basisentscheidungen | 187 | ||
| a) Der Einfluß der Gegengeschäftspolitik auf die Entscheidung über Eigenfertigung und Fremdbezug | 187 | ||
| b) Der Einfluß der Gegengeschäftspolitik auf die Entscheidung über Sofortabsatz und Weiterverarbeitung | 190 | ||
| c) Die Gegengeschäftspolitik als Kriterium der Lieferantenbewertung | 191 | ||
| d) Die Gegengeschäftspolitik als Kriterium der Abnehmerbewertung bzw. der Absatzmarktsegmentierung | 202 | ||
| e) Auswirkungen der Gegengeschäftspolitik auf die Zahl der Bezugsquellen und die „Treue“ zum Lieferanten | 205 | ||
| 2. Auswirkungen der Gegengeschäftspolitik auf ausgewählte absatz- und beschaffungspolitische Instrumentalentscheidungen | 215 | ||
| a) Gegengeschäftspolitische Entscheidungen im Bereich der Sortiments- und Produktpolitik | 215 | ||
| (1) Die Entscheidung über Leistungs- und Gegenleistungsart als Hauptproblem gegengeschäftspolitischer Entscheidungen im Bereich der Sortiments- und Produktpolitik | 215 | ||
| (2) Absatz- und beschaffungspolitische Probleme bei der Übernahme von Gegenleistungen ins bisherige Beschaffungssortiment | 218 | ||
| (3) Absatz- und beschaffungspolitische Probleme bei einer Übernahme von Gegenleistungen ins bisherige Absatzsortiment | 234 | ||
| (a) Berücksichtigung der Rückkaufgeschäfte | 234 | ||
| (b) Berücksichtigung von Gegengeschäften mit unverbundenen Realgüterleistungen | 244 | ||
| (4) Absatz- und beschaffungspolitische Probleme bei einer Übernahme von dem bisherigen Absatz- und Beschaffungssortiment unverwandten Gegenleistungen | 252 | ||
| b) Gegengeschäftspolitische Entscheidungen im Bereich der Distributionspolitik | 259 | ||
| c) Gegengeschäftspolitische Entscheidungen im Bereich der Entgelt- und Finanzierungspolitik | 275 | ||
| (1) Die grundsätzliche Beziehung zwischen Gegengeschäftspolitik, Entgeltart und Kreditgeschäft | 275 | ||
| (2) Auswirkungen der Gegengeschäftspolitik auf entgeltbzw. preispolitische Entscheidungen | 279 | ||
| (3) Auswirkungen der Gegengeschäftspolitik auf finanzierungspolitische Entscheidungen | 288 | ||
| d) Der kombinierte Einsatz des gegengeschäftspolitischen Instrumentariums — erläutert anhand eines Fallbeispiels | 292 | ||
| (1) Darstellung und Analyse eines einzelnen Gegengeschäfts | 292 | ||
| (2) Merkmalsausprägungen des dargestellten Gegengeschäfts und die mit ihnen verbundenen Marketing-Probleme | 305 | ||
| VI. Schlußbetrachtung: Gegengeschäfte und Marketingverständnis | 313 | ||
| Literaturverzeichnis | 317 |
