Selbstinteresse und Gemeinwohl
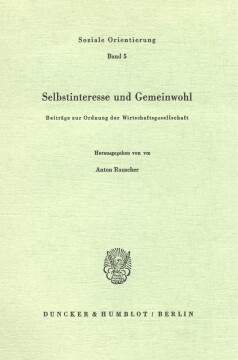
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Selbstinteresse und Gemeinwohl
Beiträge zur Ordnung der Wirtschaftsgesellschaft
Editors: Rauscher, Anton
Soziale Orientierung, Vol. 5
(1985)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Teil I: Unternehmensordnung Partizipation von „Arbeit und Kapital“ | 11 | ||
| Theo Mayer-Maly: Überwindung des Lohnvertrages? | 13 | ||
| I. Der Lohnvertrag als Strukturmodell | 13 | ||
| II. Die Arbeitsbeziehungen im geschichtlichen Wandel | 16 | ||
| III. Werksgenossenschaften | 18 | ||
| IV. „Bauhütte-Leitl-Modell“ | 19 | ||
| V. Das Modell Süßmuth | 20 | ||
| VI. Partizipationsmodelle | 22 | ||
| VII. Zwischenbilanz | 23 | ||
| VIII. Alternative Konzepte | 24 | ||
| IX. Interessengegensätze – harmonistische Ideologien – Sozialpartnerschaft | 25 | ||
| X. Programme und Positionen | 27 | ||
| 1. Karl Kummer | 27 | ||
| 2. Ota Šik | 28 | ||
| 3. Oswald von Nell-Breuning | 29 | ||
| 4. Laborem exercens | 31 | ||
| 5. Würdigung | 32 | ||
| XI. Lohnvertragsmodell und Mitbestimmung | 33 | ||
| XII. Sonderbereiche | 34 | ||
| XIII. Schlußbemerkungen | 35 | ||
| Gernot Gutmann: Arbeiterselbstverwaltung im Unternehmen. Zur ökonomischen Problematik eines humanitären Prinzips | 37 | ||
| Einleitung | 37 | ||
| Erstes Kapitel: Begriffliche Abgrenzungen | 38 | ||
| Zweites Kapitel: Arbeiterselbstverwaltung in Theorie und Praxis | 44 | ||
| I. Zur Theorie der Arbeiterselbstverwaltung | 45 | ||
| 1. Historische Wurzeln: Genossenschaftliche Arbeiterselbstverwaltung im Denken der Frühsozialisten | 45 | ||
| 2. Theoretische Entwürfe seit Ende des Zweiten Weltkriegs | 47 | ||
| a) Mikroökonomische Analysen der Arbeiterselbstverwaltung | 48 | ||
| aa) Kurzfristiges Unternehmensgleichgewicht | 49 | ||
| bb) Langfristiges Unternehmensgleichgewicht | 51 | ||
| b) Konzepte von Unternehmensverfassungen | 52 | ||
| aa) Die Mitarbeitergesellschaft von O. Šik | 53 | ||
| bb) Die laboristische Unternehmensverfassung nach A. Berchtold | 59 | ||
| cc) Das Unternehmensmodell der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung | 63 | ||
| dd) Die Gesellschaft auf Parten nach W. Engels und H. P. Steinbrenner | 66 | ||
| ee) Arbeiterselbstverwaltung (autogestion) im Programm der französischen Sozialisten | 69 | ||
| II. Arbeiterselbstverwaltung in der Praxis | 71 | ||
| 1. Die Unternehmensverfassung im Wirtschaftssystem Jugoslawiens | 71 | ||
| 2. Einzelexperimente in der Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland | 77 | ||
| a) Die Mitarbeitergesellschaft der Firma Joh. Friedrich Behrens in Ahrensburg | 79 | ||
| b) Die Martin Hoppmann GmbH in Siegen | 84 | ||
| c) Die Südstahl GmbH in Mertingen | 89 | ||
| d) Die Glashütte Süßmuth GmbH in Immenhausen | 90 | ||
| e) Die Unternehmensgruppe Porst | 94 | ||
| Drittes Kapitel: Ökonomische Probleme und ordnungstheoretische Implikationen der Arbeiterselbstverwaltung | 102 | ||
| I. Lehren aus der Praxis | 102 | ||
| II. Ergebnisse theoretischer Analysen | 107 | ||
| 1. Begrenztheit der Wettbewerbsfähigkeit | 107 | ||
| 2. Defizite in der Motivationsstruktur | 111 | ||
| Schlußbemerkungen | 114 | ||
| Literaturverzeichnis | 115 | ||
| Herbert Hax: Die arbeitsgeleitete Unternehmung. Kritische Überlegungen zu einer alternativen Unternehmenskonzeption für die Marktwirtschaft | 121 | ||
| I. Vom Phalanstère zur Mitarbeitergesellschaft | 121 | ||
| II. Grundzüge einer Theorie der arbeitsgeleiteten Unternehmung | 124 | ||
| 1. Zu Begriff und Problemstellung | 124 | ||
| 2. Die Unternehmung als Einkommensquelle | 126 | ||
| 3. Personalpolitische Probleme der arbeitsgeleiteten Unternehmung | 131 | ||
| a) Schaffung und Aufgabe von Arbeitsplätzen | 131 | ||
| b) Gestaltung der Arbeitsbedingungen | 135 | ||
| 4. Finanzierungsprobleme der arbeitsgeleiteten Unternehmung | 138 | ||
| a) Kreditfinanzierung | 138 | ||
| b) Beschaffung von Eigenkapital | 143 | ||
| aa) Externe Eigenfinanzierung | 143 | ||
| bb) Selbstfinanzierung | 145 | ||
| 5. Die Gründung arbeitsgeleiteter Unternehmungen | 148 | ||
| III. Arbeitsgeleitete Unternehmung und Wirtschaftsordnung | 150 | ||
| 1. Arbeitsgeleitete Unternehmungen in einer sozialistischen Marktwirtschaft | 150 | ||
| 2. Arbeitsgeleitete Unternehmungen in einer freien Marktwirtschaft | 151 | ||
| Literaturverzeichnis | 154 | ||
| Teil II: Wirtschaftsordnung – Konzepte, Vergleiche | 157 | ||
| Alfred Schüller: Zur Effizienz sozialistischer Marktwirtschaften | 159 | ||
| Erstes Kapitel: Problemstellung und institutioneller Rahmen sozialistischer Marktwirtschaften | 159 | ||
| I. Problemstellung: Sozialistische Marktwirtschaft versus Soziale Marktwirtschaft | 159 | ||
| II. Handlungsrechtliche Grundstruktur sozialistischer Marktwirtschaften | 163 | ||
| Zweites Kapitel: Systemindifferente Effizienzkriterien | 166 | ||
| I. Das Informations- und Koordinationsproblem | 166 | ||
| II. Das Kompetenz- und Anreizproblem | 168 | ||
| III. Das Kontrollproblem | 169 | ||
| Drittes Kapitel: Effizienzdefizite der sozialistischen Planwirtschaft als Entstehungsgrund für sozialistische Marktwirtschaften | 170 | ||
| I. Nicht erfüllbare Informationsanforderungen | 170 | ||
| II. Die Neigung zur Gleichgewichtslosigkeit im Koordinationsprozeß | 172 | ||
| 1. Irreparable Koordinationsmängel im intersektoralen Planzusammenhang | 172 | ||
| 2. Unproduktive Wachstumszyklen | 173 | ||
| 3. Unlösbare Koordinationskonflikte im intertemporalen Planzusammenhang | 174 | ||
| 4. Geringe Transaktionseffizienz | 174 | ||
| III. Innovationsfeindlicher Kompetenzkonformismus und Anreiz zum verschwenderischen Verhalten | 175 | ||
| 1. Die Neigung zum bürokratischen Kompetenzkonformismus | 175 | ||
| 2. Anreize zur verschwenderischen Aufwandsmaximierung | 176 | ||
| IV. Das unlösbare Kontrollproblem | 178 | ||
| Viertes Kapitel: Effizienzprobleme sozialistischer Marktwirtschaften | 179 | ||
| I. Das Beispiel des ungarischen Marktsozialismus | 179 | ||
| 1. Das Grundproblem: Zentrale versus marktmäßige Koordination | 179 | ||
| 2. Informations- und Koordinationsprobleme im ungarischen Lenkungsdualismus | 181 | ||
| a) Auf der Suche nach einem funktionsfähigen Preissystem | 181 | ||
| b) Verstärkter Staatsdirigismus als Antwort auf außen- und binnenwirtschaftliche Koordinationsprobleme | 183 | ||
| c) Die ungelöste Frage der bedarfsgerechten Lenkung der Produktionsstruktur | 185 | ||
| d) Die Schattenwirtschaft als Informationsquelle | 186 | ||
| 3. Das unbewältigte Kompetenz- und Anreizproblem | 188 | ||
| a) Das unvermeidliche Auseinanderfallen von Kompetenz und Verantwortung | 188 | ||
| b) Das eigentumsrechtlich begründete Vorwalten zentralverwaltungswirtschaftlicher Erfolgsziele | 101 | ||
| 4. Zur Konkurrenz von Staatskontrolle und Marktkontrolle | 193 | ||
| a) Staatliche Investitionslenkung schließt wirksame Marktkontrolle aus | 193 | ||
| b) Das Problem einer kompetitiven Angebotsstruktur | 194 | ||
| c) Die Idee einer staatsunabhängigen Kontrolle der Unternehmen | 196 | ||
| II. Das Beispiel des jugoslawischen Marktsozialismus | 198 | ||
| 1. Das Grundproblem: Verhandlungskoordination versus Preiskoordination | 198 | ||
| 2. Koordinationsschwächen des Selbstverwaltungsmechanismus | 202 | ||
| a) Die Privilegierung etablierter Interessen | 202 | ||
| b) Die Neuerungsfeindlichkeit des Selbstverwaltungsmechanismus | 204 | ||
| c) Die Neigung der Arbeiterselbstverwaltung zur regionalen Autarkie | 205 | ||
| 3. Konsequenzen der „Arbeiterdemokratie“ für die Lösung des Kompetenz- und Anreizproblems | 205 | ||
| a) Die unternehmerische Scheinkompetenz der Arbeiter | 205 | ||
| b) Anreize zu einem unbeschränkten Produzentensozialismus | 207 | ||
| aa) Bildung hegemonialer Produzentenkartelle | 207 | ||
| bb) Der systemimmanente Anreiz zur kollektiven Ausbeutung | 209 | ||
| 4. Eigentumsbedingte Kontrollinsuffizienzen des jugoslawischen Marktsozialismus | 211 | ||
| a) Das Problem: Mobilisierung von Eigen-, Konkurrenz- und Staatskontrollen | 211 | ||
| b) Die Lösung des Problems: Öffnung des Selbstverwaltungssystems für marktwirtschaftliche Lösungen | 215 | ||
| Fünftes Kapitel: Schlußfolgerungen | 217 | ||
| I. Politische und ordnungsstrukturelle Effizienzschranken des Marktsozialismus | 217 | ||
| II. Lehren aus den marktsozialistischen Erfahrungen für die Soziale Marktwirtschaft | 219 | ||
| 1. Lehren für die Informations- und Koordinationseffizienz | 221 | ||
| 2. Lehren für die Kompetenz- und Anreizeffizienz | 225 | ||
| 3. Lehren für die Kontrolleffizienz | 226 | ||
| Hans Willgerodt: Thesen zum „demokratischen Sozialismus“ | 229 | ||
| I. Die Krise des demokratischen Sozialismus | 229 | ||
| II. Das Verhältnis des demokratischen Sozialismus zu Freiheit, Marktwirtschaft und Staat | 248 | ||
| III. Ziele der Wirtschaftspolitik im demokratischen Sozialismus | 263 | ||
| IV. Die einzelnen Grundlagen der Marktwirtschaft aus der Sicht des demokratischen Sozialismus | 268 | ||
| 1. Das Privateigentum an den Produktionsmitteln | 268 | ||
| 2. Das Privateigentum im allgemeinen | 269 | ||
| 3. Die Steuerungsfunktion der Märkte | 270 | ||
| 4. Geldwesen und öffentliche Finanzen | 272 | ||
| 5. Die Sozialpolitik | 274 | ||
| 6. Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen | 275 | ||
| V. Ergebnis | 277 | ||
| Anton Rauscher: Katholische Soziallehre und liberale Wirtschaftsauffassung | 279 | ||
| I. Die Kritik am Liberalismus in der Enzyklika „Laborem exercens“ | 280 | ||
| II. Vom Paläo-Liberalismus zum Neo-Liberalismus | 282 | ||
| III. Der Weg zur Sozialen Marktwirtschaft | 288 | ||
| IV. Verpaßte Chancen | 293 | ||
| V. Antiliberale Konjunktur | 299 | ||
| VI. Die Angriffe auf die Soziale Marktwirtschaft | 307 | ||
| VII. Gemeinsamkeiten und offene Fragen | 314 | ||
| Teil III: Gemeinwohl – Kriterien, Organisation, Kompetenzen | 319 | ||
| Ulrich Matz: Aporien individualistischer Gemeinwohlkonzepte | 321 | ||
| I. Begriffsklärungen | 321 | ||
| 1. Individualismus | 321 | ||
| 2. Problematisierung des Gemeinwohlbegriffs | 323 | ||
| II. Utilitaristische Ansätze | 325 | ||
| 1. Der klassische Utilitarismus | 326 | ||
| a) Das Selbstinteresse als ethisches Axiom | 326 | ||
| b) Politische Aggregation der Interessen | 330 | ||
| 2. Zur Problematik der Wohlfahrtsfunktion in der Ökonomischen Theorie der Politik | 338 | ||
| a) Normative Aspekte der Ökonomischen Theorie der Politik | 338 | ||
| b) Die Widersprüchlichkeit des Prinzips des „Größten Glücks der größten Zahl“ | 340 | ||
| III. Vertragstheoretische Ansätze | 343 | ||
| 1. Identität der individuellen Positionen und Homogenität der Interessen: realistische Prämissen des Vertragsschlusses? | 345 | ||
| 2. Aporetik des Vertrags | 350 | ||
| IV. Schluß | 356 | ||
| Robert Hettlage: Wohlfahrtsplanung und Kollektiventscheidung | 359 | ||
| Einleitung | 359 | ||
| Erstes Kapitel: Planung, Wohlfahrt und Normdiskussion | 360 | ||
| I. Planung, Wirtschaftsplanung, Gesellschaftsplanung | 360 | ||
| II. Planungsgeschichte und Planungsaktualität | 367 | ||
| 1. Saint-Simon: Planung und die „progressio rationis“ | 367 | ||
| a) Bacon und die Reorganisation des Wissens | 368 | ||
| b) Saint-Simon und die segensreiche Macht der Wissenselite | 369 | ||
| c) Die Selbstauflösung der Herrschaft | 373 | ||
| 2. Karl Mannheim und die geplante Freiheit | 375 | ||
| a) Die Begründung der Planungsnotwendigkeit in der Gesellschaft | 375 | ||
| b) Die Rolle der Planer und das Problem der Planungskontrolle | 378 | ||
| 3. N. Luhmann: Planung der Systemrationalität | 381 | ||
| a) Der systemtheoretische Ansatz | 381 | ||
| b) Systemrationalität und reflexive Planung | 382 | ||
| c) Die Problematik | 384 | ||
| 4. Zusammenfassung | 386 | ||
| Zweites Kapitel: Wohlfahrtsplanung und Kollektiventscheidung | 388 | ||
| I. Wohlfahrtsplanung von oben („Die Planwirtschaft“) | 390 | ||
| 1. Die weltanschauliche Grundposition | 390 | ||
| 2. Das zentralisierte Entscheidungsverfahren und seine Folgen in der Praxis | 392 | ||
| II. Wohlfahrtsplanung von unten („Die Marktwirtschaft“) | 396 | ||
| 1. Die weltanschaulichen Grundlagen | 396 | ||
| 2. Das dezentrale Entscheidungsverfahren und seine Wohlfahrtsproblematik | 398 | ||
| a) Die neoklassische Handlungslogik und das Pareto-Optimum | 398 | ||
| b) Die moderne Entscheidungstheorie und das Problem des „social choice“ | 400 | ||
| c) Die Neue Politische Ökonomie (NPÖ) und die Gruppenverhandlung | 405 | ||
| d) Die Ergebnisse marktwirtschaftlich orientierter Wirtschaftspolitik und deren Kritik | 409 | ||
| aa) Strukturkritik | 411 | ||
| bb) Kulturkritik | 411 | ||
| cc) Funktionskritik | 412 | ||
| Drittes Kapitel: Saint-Simonismus in Aktion – Die „Planification“ | 413 | ||
| I. Auf der Suche nach neuen Entscheidungsverfahren bei der Wohlfahrtsplanung | 413 | ||
| 1. Die Begründung der Planification | 414 | ||
| 2. Die Suche nach einem Mittelweg | 417 | ||
| II. Das Entscheidungsverfahren der Planification | 418 | ||
| 1. Die erste Stufe der Wohlfahrtsplanung: Die „prévision“ | 419 | ||
| a) Die Idee | 420 | ||
| b) Die Praxis | 422 | ||
| 2. Die zweite Stufe der Wohlfahrtsplanung: Die „concertation“ | 424 | ||
| a) Die Idee | 424 | ||
| b) Die Praxis | 426 | ||
| 3. Die dritte Stufe der Wohlfahrtsplanung: Die „action“ | 428 | ||
| a) Die Idee | 430 | ||
| b) Die Praxis | 430 | ||
| aa) „Imperative“ Planerfüllung im öffentlichen Sektor | 432 | ||
| bb) „Indikative“ Planimplementation im Privatsektor | 432 | ||
| III. Die Schwächen des Entscheidungsverfahrens der Planification | 433 | ||
| 1. Die Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis | 433 | ||
| a) Kompetenzgrenzen der Planifikateure | 434 | ||
| b) Konsensgrenzen | 437 | ||
| c) Verantwortungsgrenzen | 440 | ||
| 2. Das Saint-Simonistische Erbe | 442 | ||
| a) Der „industrial-scientific complex“ und die Rolle der „Produzenten“ | 442 | ||
| b) Die „Action“: Von der Herrschaft über Personen zur Verwaltung von Sachen | 444 | ||
| Viertes Kapitel: Lernschritte zur Humanisierung der Planung | 447 | ||
| I. Zwei Demonstrationseffekte der Planification | 447 | ||
| 1. Der Plan als Formulierung der gesellschaftlichen Sinngebung | 447 | ||
| 2. Die Suche nach dem kollektiven Willen | 450 | ||
| II. Die Planung der Planung: einige Regeln über den Aufbau kollektiver Entscheidungsprozesse | 452 | ||
| 1. Entscheidungsregeln für die Erstellung des Zielkatalogs | 453 | ||
| 2. Entscheidungsregeln für die Planimplementierung | 454 | ||
| a) Die Planung der Interessenartikulation | 454 | ||
| b) Die Planung individueller Freiheitsräume | 456 | ||
| Christian Watrin: Gesellschaftliche Wohlfahrt. Zur volkswirtschaftlichen Sicht der Gemeinwohlproblematik | 461 | ||
| I. Sicherung und Verbreitung des allgemeinen Wohlstandes – die ökonomische Interpretation der Gemeinwohlidee | 461 | ||
| 1. Von der Staatswissenschaft zur politischen Ökonomie | 461 | ||
| 2. Gesellschaftlicher Wohlstand – das Identifikationsproblem | 465 | ||
| II. Die Maximierung der gesellschaftlichen Wohlfahrt – das utilitaristische Erbe | 467 | ||
| III. Zur Kritik der gesellschaftlichen Wohlfahrtsmaximierung | 473 | ||
| 1. Bewertung und Werturteil | 473 | ||
| 2. Zur Praktikabilität gesellschaftlicher Wohlfahrtsfunktionen | 476 | ||
| a) Kollektives Entscheidungsmodell, Gruppengröße, Auswahlproblematik und Zeithorizont | 476 | ||
| b) Arrow-Paradox und kollektive Entscheidungsverfahren | 478 | ||
| IV. Pareto-Regel und Einstimmigkeitspostulat – der vertragstheoretische Ansatz | 481 | ||
| 1. Katallaktik versus Ökonomik | 481 | ||
| 2. Wicksells Einstimmigkeitskriterium | 483 | ||
| V. Der Beitrag der Ökonomie zur Gemeinwohlproblematik – Gesellschaftliche Wohlfahrt als regulatives Prinzip | 485 | ||
| Literaturverzeichnis | 491 | ||
| Alfred Klose: Zur Gemeinwohlproblematik. Perspektiven einer gemeinwohlorientierten Politik aus der Sicht christlicher Sozialethik | 495 | ||
| I. Zur Problematik | 495 | ||
| II. Qualitative Kriterien der Wohlfahrtsbestimmung | 497 | ||
| III. Ein neuer Gemeinwohlbegriff bei den alternativen Bewegungen? | 501 | ||
| IV. Überragende Bedeutung der Eigenverantwortung des Menschen | 505 | ||
| V. Umfassender sozialer Wandel und Wohlfahrtsentwicklung | 506 | ||
| VI. Übereinstimmende Gemeinwohlziele | 509 | ||
| VII. Zur organisatorischen Seite des Gemeinwohls | 513 | ||
| VIII. Neuorientierung der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Ziele | 516 | ||
| IX. Um eine modifizierte Marktwirtschaft? | 519 | ||
| X. Ein Beispiel einer gemeinwohlwidrigen Politik | 526 | ||
| XI. Das Gemeinwohl ist wesenhaft mit dem Freiheitsprinzip verbunden | 529 | ||
| XII. Schlußfolgerungen für eine gemeinwohlorientierte Politik | 534 | ||
| 1. Gemeinwohl: Vielfalt und Einheit | 534 | ||
| 2. Freiheit und Sicherheit | 536 | ||
| 3. Chancengleichheit bei der Verwirklichung existentieller Lebenszwecke | 538 | ||
| 4. Friedensordnung und Gemeinwohl | 540 | ||
| 5. Gesellschaftspolitik als umfassende Gestaltungsaufgabe | 542 | ||
| Verzeichnis der Mitarbeiter | 545 |
