Wehrbeauftragter und Gewaltenteilung
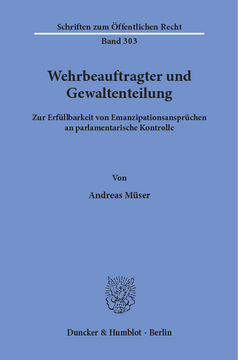
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Wehrbeauftragter und Gewaltenteilung
Zur Erfüllbarkeit von Emanzipationsansprüchen an parlamentarische Kontrolle
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 303
(1976)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 11 | ||
| Einleitung | 13 | ||
| A. Ausgangspunkt und Anlaß dieser Untersuchung | 13 | ||
| B. Die Fragestellung | 16 | ||
| I. Bemerkungen zur Methode | 16 | ||
| 1. Die Eigenart des hier verwendeten politikwissenschaftlichen Ansatzes | 16 | ||
| a) Allgemeine Grundlagen | 16 | ||
| b) Konkretisierung des Ansatzes für das Amt des Wehrbeauftragten | 21 | ||
| 2. Problem der Übernahme in eine rechtswissenschaftliche Untersuchung | 22 | ||
| a) Zum Problem des ,ob´ der Reduktion einer politischen Fragestellung | 22 | ||
| b) Das Problem des ,wie' | 23 | ||
| II. Formulierung der Fragestellung | 24 | ||
| Erster Teil: Die Emanzipationsfunktion des Wehrbeauftragten | 25 | ||
| A. Der Begriff der Emanzipationsfunktion bzw. des Emanzipationsinteresses | 25 | ||
| I. Allgemeines | 25 | ||
| II. Konkretisierung für diese Untersuchung | 26 | ||
| 1. Sicherung des Primats des Politischen als emanzipatorische Leistung | 26 | ||
| a) Armee als Mittel der Politik | 26 | ||
| b) Wahrung von bürgerlichen Grundrechten als Ziel staatlicher Machtausübung | 28 | ||
| 2. Entspannung des inneren Gefüges der Armee als emanzipatorische Leistung | 30 | ||
| a) „Freiheit der Rücken" — Die Reformbewegung am Anfang des 19. Jahrhunderts | 31 | ||
| b) Die Innere Führung — Die Reformbewegung in der Mitte des 20. Jahrhunderts | 33 | ||
| III. Ergebnis | 38 | ||
| B. Die Intention der rechtlichen Konstruktion (Art. 45 b GG und WBG) | 39 | ||
| I. Historische Grundlagen | 39 | ||
| 1. Das schwedische Vorbild | 39 | ||
| 2. Der Wehrbeauftragte im Kontext der deutschen Nachkriegsgeschichte | 42 | ||
| II. Die Einführung des Wehrbeauftragten durch den Bundestag in die Rechtsordnung der BRD nach den Gesetzgebungsmaterialien | 44 | ||
| 1. Die Kompromißlage | 44 | ||
| 2. Konkretisierung in bezug auf das Amt des Wehrbeauftragten | 47 | ||
| a) Die Haltung der CDU/CSU-Fraktion | 47 | ||
| b) Die Haltung der SPD-Fraktion | 50 | ||
| 3. Die Haltung der Parteien zum Gesetz selbst | 51 | ||
| C. Ergebnis zum 1. Teil | 52 | ||
| Zweiter Teil: Möglichkeiten des Wehrbeauftragten zur Funktionserfüllung nach seinem systematischen Standort | 53 | ||
| A. Diskussion über den systematischen Standort des Wehrbeauftragten | 54 | ||
| I. Bedeutung des Art. 45 b GG für den systematischen Standort des Wehrbeauftragten | 54 | ||
| 1. Doppelstellung aus Doppelfunktion? | 54 | ||
| a) Normative Überlegungen | 55 | ||
| aa) Scheincharakter der Doppelfunktion | 55 | ||
| bb) Argumente aus der Entstehungsgeschichte | 56 | ||
| b) Praktische Überlegungen | 57 | ||
| c) Ergebnis | 58 | ||
| 2. Der Wehrbeauftragte als permanenter Untersuchungsausschuß | 58 | ||
| 3. Ergebnis | 59 | ||
| II. Bedeutung des WBG für die Stellung des Wehrbeauftragten zum Parlament | 59 | ||
| 1. Das Auslegungsziel oder die Methode von Maurer | 60 | ||
| a) Wehrbeauftragter — Parlament — Öffentlichkeit | 60 | ||
| b) Wehrbeauftragter — Opposition | 61 | ||
| c) Zusammenfassung | 61 | ||
| 2. Das Verhältnis Wehrbeauftragter — Parlament im Spiegel des WBG | 62 | ||
| a) Die Wahl des Wehrbeauftragten | 62 | ||
| aa) Quorum | 62 | ||
| bb) Amtszeit und Abberufung | 62 | ||
| b) Die Befugnisse des Wehrbeauftragten | 63 | ||
| aa) Das Initiativrecht des Wehrbeauftragten | 64 | ||
| bb) Auswirkungen der Initiativen des Wehrbeauftragten | 64 | ||
| α) Das „Weisungsrecht" des Wehrbeauftragten | 64 | ||
| β) Die Berichterstattung des Wehrbeauftragten | 66 | ||
| (1) Der Inhalt der Berichte | 67 | ||
| (2) Die Behandlung der Berichte | 69 | ||
| (3) Das Rederecht des Wehrbeauftragten | 71 | ||
| III. Ergebnis zu A. | 72 | ||
| 1. Das Verhältnis von WBG und GG | 72 | ||
| 2. Wehrbeauftragter und Gewaltenteilung | 73 | ||
| B. Das Verhältnis von Parlament und Regierung | 73 | ||
| I. Der historisch-ideengeschichtliche Aspekt oder „Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus" | 73 | ||
| 1. Die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie bis 1918 | 73 | ||
| 2. Die parlamentarische Demokratie von 1918 bis 1945 | 79 | ||
| 3. Staatstheoretische Entwicklung des Begriffs der Gewaltenteilung nach 1945 | 83 | ||
| a) Bildung des Wortlauts von Art. 20 Abs. 2 GG als „negatives Bekenntnis" | 83 | ||
| b) Auslegung des Begriffs der Gewaltenteilung | 86 | ||
| aa) Die Gewaltenteilung in der Sicht der Wehrverfassungsrechtler | 86 | ||
| α) Auslegung ohne Problematisierung der Gewaltenteilung | 86 | ||
| β) Auslegung mit Problematisierung der Gewaltenteilung | 91 | ||
| (1) Beispiel Lepper | 91 | ||
| (2) Beispiel Ehmke | 92 | ||
| (3) Beispiel Runte | 93 | ||
| (4) Beispiel Lerche | 94 | ||
| (5) Beispiel v. d. Heydte u. a. | 95 | ||
| (6) Ergebnis | 96 | ||
| Y) Exkurs: Mögliche Gründe für ein solches Ergebnis | 97 | ||
| bb) Die Gewaltenteilungslehre nach der Rechtsprechung und der allgemeinen Staatslehre | 98 | ||
| α) Die Verfassungsrechtsprechung | 98 | ||
| β) Die Lehre | 100 | ||
| (1) Beispiel Hahn | 100 | ||
| (2) Beispiel Werner Weber | 101 | ||
| (3) Die Grundgesetzkommentatoren | 103 | ||
| (4) Beispiel Luhmann | 106 | ||
| (5) Beispiel Hesse | 110 | ||
| (a) Die Wandlung des Gewaltenteilungsbegriffs bei Konrad Hesse | 110 | ||
| (b) Das Verhältnis von Norm und Wirklichkeit bei Konrad Hesse — Rechtstheoretischer Hintergrund | 114 | ||
| (c) Ergebnis der Auseinandersetzung mit Konrad Hesse | 119 | ||
| (6) Kritik dieser Auslegungsentwicklung | 120 | ||
| 4. Ergebnis der Untersuchung des ideengeschichtlichen Aspekts | 122 | ||
| II. Der politisch-praktische Aspekt des Verhältnisses von Parlament und Regierung | 123 | ||
| 1. Entstehung und Stabilisierung der Regierung | 123 | ||
| 2. Folgen für die parlamentarische Kontrolle von Regierung und Verwaltung (Verteidigungsbereich) | 130 | ||
| a) Struktur der parlamentarischen Willensbildung | 130 | ||
| aa) Systematische Erwägungen | 130 | ||
| bb) Verteidigungsspezifische Erwägungen | 131 | ||
| b) Insbesondere: Möglichkeiten des Wehrbeauftragten | 133 | ||
| c) Entwicklungsmöglichkeiten des Amtes des Wehrbeauftragten | 135 | ||
| aa) Gefahr der „Parlamentarisierung der Militärführung" | 136 | ||
| bb) Funktionswandel des Amtes des Wehrbeauftragten | 138 | ||
| III. Ergebnis der Untersuchung des politisch-praktischen Aspekts der Gewaltenteilung im Vergleich zu deren ideengeschichtlichen Aspekt | 138 | ||
| Dritter Teil: Verifizierung der Ergebnisse dieser Untersuchung und Erörterung eines Funktionswandels des Amtes des Wehrbeauftragten anhand seiner Jahresberichte | 140 | ||
| A. Die Entwicklung von 1959 - 1967 | 140 | ||
| I. Der Jahresbericht 1959 | 140 | ||
| II. Der Jahresbericht 1960 | 141 | ||
| III. Der Jahresbericht 1961 | 142 | ||
| IV. Die Jahresberichte 1962/63 | 143 | ||
| V. Die Jahresberichte 1964 - 1967 | 144 | ||
| B. Die Entwicklung bis heute | 146 | ||
| I. Die Jahresberichte 1968/69 | 146 | ||
| II. Der Jahresbericht 1970 | 150 | ||
| III. Die Jahresberichte 1971 ff. — Einsichten des Wehrbeauftragten | 152 | ||
| 1. Der Jahresbericht 1971 | 152 | ||
| 2. Der Jahresbericht 1972 | 152 | ||
| 3. Der Jahresbericht 1973 | 157 | ||
| 4. Der Jahresbericht 1974 | 160 | ||
| a) Wehrbeauftragter und Parlament | 160 | ||
| b) Wehrbeauftragter und Exekutive | 161 | ||
| 5. Der Jahresbericht 1975 — Der Wechsel im Amt | 163 | ||
| Zusammenfassung | 166 | ||
| Literaturverzeichnis | 168 |
