Die staatliche Verantwortung für die Risiken der Technik
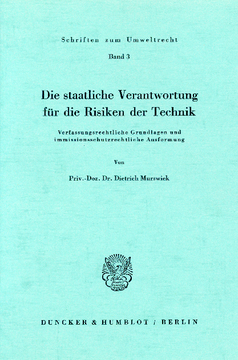
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die staatliche Verantwortung für die Risiken der Technik
Verfassungsrechtliche Grundlagen und immissionsschutzrechtliche Ausformung
Schriften zum Umweltrecht, Vol. 3
(1985)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Von den »Schriften zum Umweltrecht« (SUR) sind seit 1981 über 190 Bände erschienen. Die Schriften zum Umweltrecht begleiten die Entwicklung des modernen deutschen und europäischen Umweltrechts damit seit über 30 Jahren - also schon nahezu seit der Etablierung des Umweltrechts als eigenständiges Rechtsgebiet in Deutschland - umfassend und stets hochaktuell durch die Publikation von Monografien und Sammelbänden mit umweltrechtlicher Schwerpunktsetzung. Die Schriftenreihe erfasst alle Rechtsgebiete des Umweltrechts und geht über öffentlich-rechtliche Fragestellungen hinaus. Sie erfasst u.a. auch zivil- und strafrechtliche sowie völkerrechtliche und europarechtliche Themen. Herausgeber der Schriftenreihe ist Prof. Dr. Michael Kloepfer von der Humboldt-Universität zu Berlin. Einen großen Anteil am Erfolg der Schriften zum Umweltrecht hat auch die Arbeit des an der Humboldt-Universität zu Berlin ansässigen Forschungszentrums Umweltrecht e.V. (FZU), dessen Präsident Prof. Dr. Michael Kloepfer ist.((vorletzten Satz für die Homepage entfernen))
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 14 | ||
| § 1 Einleitung | 19 | ||
| Erster Teil: Verantwortung und technisches Risiko: Grundbegriffe | 29 | ||
| § 2 Verantwortung | 29 | ||
| A. Verantwortung als ethisches Prinzip | 29 | ||
| I. Verantwortung als Rede und Antwort stehen | 29 | ||
| II. Verantwortung als Zurechnung | 31 | ||
| III. Verantwortung als Pflichtgemäßheit des Verhaltens und als besondere Form der Verpflichtung | 32 | ||
| IV. Verantwortung und Haftung | 34 | ||
| V. Verantwortung als materiales Prinzip? | 34 | ||
| VI. Gesinnungs- und Verantwortungsethik | 36 | ||
| VII. Technik und Verantwortungsethik | 38 | ||
| B. Verantwortung im Rechtssinne | 39 | ||
| I. Verantwortung im formalen Sinne | 40 | ||
| II. Verantwortung im materiellen Sinne | 41 | ||
| 1. Verantwortung und Haftung | 41 | ||
| 2. Verantwortimg für einen Gegenstand | 43 | ||
| 3. Haftung ohne Verantwortimg? | 44 | ||
| a) Verantwortung für das Handeln anderer? | 45 | ||
| b) Verantwortimg für Gefährdungspotentiale | 46 | ||
| c) Verantwortlichkeit für erlaubte Eingriffe | 47 | ||
| d) Die Verursacherverantwortlichkeit | 48 | ||
| 4. Die Verantwortung juristischer Personen | 49 | ||
| 5. Verantwortung mehrerer Subjekte | 50 | ||
| III. Verantwortung und Entlastung | 50 | ||
| IV. Die Eigenverantwortlichkeit | 51 | ||
| V. „Politische" Verantwortung als demokratische Verantwortung | 53 | ||
| 1. Die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung | 53 | ||
| 2. Rechtliche und „politische" Verantwortung | 55 | ||
| C. Der Staat als Subjekt von Verantwortung für technische Risiken | 57 | ||
| I. Rechtliche und politische Verantwortung von Staatsorganen | 57 | ||
| II. Staatliche Verantwortung für privatwirtschaftlich betriebene Technik? | 58 | ||
| 1. Verantwortung durch Identifikation? | 58 | ||
| 2. Zurechnung kraft Veranlassung | 59 | ||
| 3. Zurechnung kraft Rechtsetzung | 61 | ||
| a) Verantwortung aufgrund konkreter Genehmigung? | 61 | ||
| b) Zurechnung aufgrund normativer Regelung? | 62 | ||
| c) Resümee | 69 | ||
| 4. Zurechnung wegen Unterlassens | 70 | ||
| 5. Rechtliche und politische Verantwortlichkeit | 70 | ||
| § 3 Technik und Technologie | 71 | ||
| A. Technik | 71 | ||
| B. Technologie | 79 | ||
| § 4 Risiko | 80 | ||
| A. Der Begriff des Risikos | 81 | ||
| B. Risiko und Gefahr | 83 | ||
| C. Sicherheit | 86 | ||
| D. Restrisiko | 87 | ||
| Zweiter Teil: Die staatliche Verantwortung für die Risiken der Technik nach dem Grundgesetz | 88 | ||
| 1. Kapitel: Verfassungsrechtliche Pflichten | 88 | ||
| 1. Abschnitt: Verfassungsrechtliche Pflichten zum Schutz von Individualrechtsgütern | 88 | ||
| § 5 Grundrechtliche Unterlassungspflichten als Grenzen der Ermächtigung zu privaten Grundrechtsbeeinträchtigungen | 89 | ||
| A. Ermächtigung zur privaten Grundrechtsbeeinträchtigung als Grundrechtseinschränkung | 89 | ||
| I. Die These des Bundesverfassungsgerichts | 89 | ||
| II. Die Grenzen der Ermächtigung zu privaten Grundrechtsbeeinträchtigungen | 91 | ||
| 1. Eingriffsermächtigung als Duldungsverpflichtung | 91 | ||
| 2. Relativität der grundrechtlichen Schutzgüter? | 93 | ||
| B. Kriterien für die Grundrechtseinschränkung zugunsten Privater | 99 | ||
| § 6 Grundrechtliche Schutzpflichten als Störungsabwehrpflichten | 101 | ||
| A. Schutzpflichten als Gewährleistungspflichten | 102 | ||
| I. Die Pflicht zum Schutz der Individualrechtsgüter | 102 | ||
| II. Die grundrechtliche Bedeutung der staatlichen Schutzpflicht | 106 | ||
| B. Einzelne Schutzpflichten | 108 | ||
| I. Die Pflicht zum Verbot privater Grundrechtsbeeinträchtigungen als primäre Schutzpflicht | 108 | ||
| II. Sekundäre Schutzpflichten als Schutzgewährungspflichten | 111 | ||
| 1. Streitentscheidungs-und Rechtsdurchsetzungspflichten | 112 | ||
| a) Rechtsschutz und Zwangsvollstreckung | 112 | ||
| b) Unterlassungsansprüche | 112 | ||
| c) Störungsbeseitigungs- und Schadensersatzansprüche | 113 | ||
| 2. Schutz der öffentlichen Sicherheit | 113 | ||
| a) Die Pflicht zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit | 114 | ||
| b) Die Pflicht zum Einschreiten im konkreten Fall | 115 | ||
| c) Die Pflicht zur Überwachung | 117 | ||
| aa) Allgemeines | 117 | ||
| bb) Die Pflicht zum Grundrechtsschutz durch Verfahren | 118 | ||
| 3. Schutz durch Sanktionen | 119 | ||
| 4. Schutz durch fördernde oder erzieherische Verhaltensbeeinflussung | 120 | ||
| C. Schutzpflichten als Leistimgspflichten? | 123 | ||
| D. Die Pflicht zum Schutz der Menschenwürde | 125 | ||
| E. Völkerrechtliche Schutzpflichten | 126 | ||
| § 7 Grundrechtlich begründete Pflicht zur Risikovorsorge? | 127 | ||
| A. „Grundrechtsgefährdung" als Grundrechtsverletzung? | 127 | ||
| B. Der Vorbehalt des Gesetzes im Hinblick auf „Grundrechtsgefährdungen" | 134 | ||
| C. Die Pflicht zum Schutz gegen „Grundrechtsgefährdungen" seitens Privater | 138 | ||
| § 8 Schutz und Freiheit: Der Umfang der verfassungsrechtlichen Pflicht zur Risikoabwehr | 138 | ||
| A. Schutz und Freiheit | 139 | ||
| I. Freiheit von „Gefahren" als Mindestposition gegenüber der Freiheit zur Beliebigkeit und die Sozialadäquanz von Risiken unterhalb der Gefahrenschwelle | 140 | ||
| II. Die Erforderlichkeit der allgemeinen Risikotragungspflicht | 143 | ||
| B. Ausschluß von „Gefahren" oder von „erheblichen Gefahren" als verfassungsrechtlicher Sicherheitsstandard? | 145 | ||
| C. Grundrechtsgewährleistimg nach Maßgabe technologischer „Situationsprägung"? | 146 | ||
| § 9 Der relationale Gefahrenbegriff als Maßstab der Schutzpflicht | 149 | ||
| A. Die Bezugsgröße für die Konkretisierung der Schutzpflicht: Individualrisiko oder Kollektivrisiko? | 151 | ||
| I. Individualrechtlicher Bezug der Schutzpflicht und kollektives Risiko | 151 | ||
| 1. Zum Meinungsstand | 152 | ||
| 2. Steigerung der Pflicht zum Schutz des im Kollektiv betroffenen einzelnen? | 153 | ||
| 3. „Objektive Funktion" der Grundrechte und Kollektivrisiko | 154 | ||
| a) „Objektive Funktion" und Vielzahl von einem potentiellen Schadensereignis Betroffener | 154 | ||
| b) „Objektive Funktion" und Wahrscheinlichkeit der Schädigung einzelner | 155 | ||
| aa) Individualrechtsschutz und Individualisierbarkeit | 155 | ||
| bb) Objektive Pflicht zum Individualrechtsschutz, Bevölkerungsrisiko und objektives Individualrisiko | 159 | ||
| II. Die Berücksichtigung des Kollektivrisikos als Gebot des Gleichheitssatzes | 161 | ||
| B. Grenzen der Quantifizierbarkeit und Wertungskompetenz des Gesetzgebers | 165 | ||
| I. Verfassungsrechtliche Kriterien für die Bewertung des Schadenspotentials | 167 | ||
| 1. „Wertordnimg" als ordinale Wertskala? | 167 | ||
| 2. Die Unzulänglichkeit einer ordinalen Rangskala der Schutzgüter und die Unmöglichkeit ihrer vollständigen Herstellung | 170 | ||
| 3. Subjektive Begründung einer Kardinalskala der Schutzgüter unter Berücksichtigung der Beeinträchtigungsintensität?. | 172 | ||
| 4. Objektive Schadensbewertung aufgrund der Beeinträchtigungsintensität | 175 | ||
| a) Differenzierung nach der Beeinträchtigungsintensität in bezug auf ein Schutzgut | 175 | ||
| b) Rechtsgutübergreifende Quantifizierung | 177 | ||
| c) Rechtssubjektübergreifende Quantifizierung | 178 | ||
| II. Die Wertungskompetenz des Gesetzgebers | 179 | ||
| § 10 Pflicht zum „dynamischen Rechtsgüterschutz"? | 181 | ||
| A. Die Pflicht zum „dynamischen Rechtsgüterschutz" und ihre Grenze | 181 | ||
| B. Zur „Nachbesserungspflicht" des Gesetzgebers | 184 | ||
| § 11 Die Bedeutung der Unterscheidung von Normalbetriebs- und Störfallrisiken für die Schutzpflichten des Staates | 188 | ||
| A. Das Störfallrisiko als Ingerenzverursachungsrisiko | 189 | ||
| B. Ingerenzrisiken als Beeinträchtigungen mit dem Risiko der Schädigung oder der SchadensVergrößerung | 190 | ||
| I. Die Ingerenz als Eingriff | 190 | ||
| 1. Allgemeines | 190 | ||
| 2. Insbesondere: das Recht auf Freiheit von Einwirkungen auf den Körper | 192 | ||
| 3. Bagatelleingriff und Eingriffsrechtfertigung | 193 | ||
| II. Ingerenz, zumutbare Beeinträchtigung und Schaden | 196 | ||
| III. Das Ingerenzrisiko | 198 | ||
| § 12 Sekundäre Schutzpflichten und sekundäre Risiken | 199 | ||
| A. Die Pflicht zur Störungsbeseitigung | 200 | ||
| B. Die Pflicht zum Schutz durch Überwachimg oder Sanktionen | 201 | ||
| § 13 Langzeitrisiken und zeitliche Dimension der Schutzpflichten | 206 | ||
| A. Grundrechtsschutz für künftige Generationen | 207 | ||
| I. Objektive Schutzpflicht und zeitliche Auswirkungen heutiger Maßnahmen | 207 | ||
| II. Einwände gegen die Zukunftswirkung staatlicher Schutzpflichten | 209 | ||
| B. Langzeitrisiken und Grundrechtsschranken | 212 | ||
| § 14 Staatliche Schutzpflicht und subjektiver Schutzanspruch | 216 | ||
| A. Die grundsätzliche Entsprechung von Schutzpflicht und Schutzanspruch | 216 | ||
| B. Risiko und subjektive Beeinträchtigung | 217 | ||
| I. Risiko und subjektive Betroffenheit | 218 | ||
| II. Risiko und Rechtfertigung | 219 | ||
| III. Schutzanspruch und Gleichheitssatz | 222 | ||
| 2. Abschnitt: Verfassungsrechtliche Pflichten zum Schutz von Gemeinschaftsgütern | 225 | ||
| § 15 Die Pflicht zum Schutz verfassungsrechtlicher Gemeinschaftsgüter als verfassungsrechtliche Pflicht | 225 | ||
| A. Der Schutz originärer verfassungsrechtlicher Gemeinschaftsgüter | 225 | ||
| B. Der Schutz der realen Voraussetzungen verfassungsrechtlicher Schutzgüter | 227 | ||
| I. Die staatliche Schutzpflicht | 227 | ||
| II. Individueller Anspruch auf Sicherung von „Grundrechtsvoraussetzungen"? | 228 | ||
| § 16 Probleme der Bewertimg von Gemeinschaftsgütern | 230 | ||
| A. FundamentalitätsVerhältnisse als Bewertungsrahmen | 230 | ||
| B. Beeinträchtigungsintensität und Kollektivrisiko | 231 | ||
| C. Bewertungskompetenz und Prognosespielraum | 231 | ||
| 2. Kapitel: Verfassungsrechtliche Grenzen der Schutzbefugnisse | 233 | ||
| § 17 Grundrechte des Risikoverursachers und Verhältnismäßigkeit | 233 | ||
| A. Staatliche Schutzpflichten, Freiheit des Risikoerzeugers und Verhältnismäßigkeit | 236 | ||
| B. Risikoabwehr unterhalb der Gefahrenschwelle und Verhältnismäßigkeit | 242 | ||
| I. Ingerenzverursachungsverbot und Verhältnismäßigkeit | 245 | ||
| II. Risikoabwehr und Verhältnismäßigkeit | 249 | ||
| 1. Starre Sicherheitsstandards | 250 | ||
| 2. Bestimmte Sicherheit+svorkehrungen | 252 | ||
| 3. Risikominimierung | 252 | ||
| III. Der „Grundsatz der Ausgewogenheit" | 254 | ||
| C. Risikovorsorge unterhalb der Gefahrenschwelle und Gleichheitssatz | 255 | ||
| D. Besitzstandsschutz als Vertrauensschutz | 256 | ||
| I. Eigentumsgarantie als Besitzstandsschutz | 256 | ||
| 1. Die zwei Dimensionen der Eigentumsgarantie | 256 | ||
| 2. Besitzstandsschutz durch andere Freiheitsrechte | 257 | ||
| II. Eigentumsgarantie als Eigentumswertgarantie | 260 | ||
| III. Besitzstandsschutz als Dispositionsschutz | 262 | ||
| § 18 Sonstige Schranken der Schutzbefugnisse | 268 | ||
| A. Überblick | 268 | ||
| B. Insbesondere: Der Auftrag zur Wohlstands Vorsorge | 270 | ||
| C. Pflichten und Pflichtbegrenzungen aus Kompetenznormen? | 271 | ||
| I. Pflicht zur 2ulassung von Risiken aus Kompetenznormen? | 271 | ||
| II. Kompetenznormen als „Grundrechtsschranken"? | 272 | ||
| § 19 Resümee: Der Umfang der verfassungsrechtlichen Schutzpflichten und die politische Verantwortimg des Gesetzgebers für technische Risiken | 276 | ||
| A. Zusammenfassende Thesen zum Zweiten Teil | 276 | ||
| I. Begründung der Schutzpflichten | 276 | ||
| II. Schutzpflichten gegenüber Risiken | 277 | ||
| III. Subjektiver Schutzanspruch | 279 | ||
| IV. Grenzen der Schutzbefugnisse | 279 | ||
| B. Folgerungen hinsichtlich der politischen Verantwortung des Gesetzgebers | 280 | ||
| Dritter Teil: Probleme der Verwaltungsverantwortung im technischen Sicherheitsrecht am Beispiel der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsvoraussetzung der §§ 6 Nr.l, 5 Nr.l BImSchG | 288 | ||
| § 20 Der Sicherheitsstandard des § 5 Nr. 1 BImSchG | 291 | ||
| A. Gegenstand der „Grundpflicht" des § 5 Nr. 1 | 291 | ||
| I. Allgemeines | 291 | ||
| II. Verursachungs- und Wirkungsstandard | 295 | ||
| B. Die Pflicht zur Duldung „unerheblicher" Beeinträchtigungen: Das Bundes-Immissionsschutzgesetz als Industrieförderungsgesetz | 301 | ||
| I. „Erheblichkeit" - Deutungsmöglichkeiten | 302 | ||
| II. Interpretation eines unbestimmten Rechtsbegriffs bei kontradiktorischer Zwecksetzung | 306 | ||
| 1. Schutzzweck und Förderungszweck | 306 | ||
| 2. Die Begrenzung des Schutzzwecks durch den Förderungszweck | 310 | ||
| 3. Die maximal zulässige Beeinträchtigung | 314 | ||
| a) Unzumutbarkeit beziehungsweise Gemeinschädlichkeit als Grenze der maximal zulässigen Beeinträchtigung | 314 | ||
| b) Zumutbarkeit und Zweck der Beeinträchtigung | 316 | ||
| 4. Die Zumutbarkeitsgrenze als Grenze der maximal zulässigen Beeinträchtigimg und „Erheblichkeit" im Sinne der herrschenden Meinung | 318 | ||
| a) „Einfachgesetzliche Zumutbarkeitsschwelle" als Kompromißlinie? | 319 | ||
| b) Gewerbefreiheit als Beeinträchtigungsverursachungsfreiheit? | 323 | ||
| c) Güterabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Genehmigung von Industrieanlagen und der privaten Sicherheit? | 325 | ||
| d) Das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme im Nachbarschafts Verhältnis | 326 | ||
| aa) Gegenseitigkeit und Zumutbarkeit | 326 | ||
| bb) Das Gebot der „Rücksichtnahme auf die Umgebung" | 328 | ||
| e) Übernahme des Unzumutbarkeitskriteriums aus dem Polizeirecht? | 329 | ||
| f) „Erheblichkeit" und § 22 BImSchG | 330 | ||
| C. Das erlaubte Risiko | 331 | ||
| I. Wortlaut und Meinungsstand | 332 | ||
| II. Einschränkung des Sicherheitsstandards aus dem Gesetzeszusammenhang | 335 | ||
| 1. Die vom Gesetz akzeptierte technische Realität | 335 | ||
| 2. Vermeidung von Gefahren als Mindestsicherheitsstandard | 335 | ||
| 3. Risikoabwehr unterhalb der Gefahrensch welle als Optimierungsgebot | 336 | ||
| 4. Kein Schutz gegen „unerhebliche" Risiken | 338 | ||
| 5. Vereinbarkeit der Auslegung mit § 5 Nr. 2 BImSchG | 340 | ||
| III. Beschränkung der Sicherheitspflichten durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip | 342 | ||
| D. Immissionsvorbelastung und Luftbewirtschaftung | 343 | ||
| I. Kontradiktorische Zweckprogrammierung und Unanwendbarkeit des Optimierungsmodells | 344 | ||
| II. Das Fehlen materiell-rechtlicher Konkretisierungskriterien | 347 | ||
| III. Bipolare Zweckprogrammierung der Interpretation doppelseitiger Rechtssätze und Luftbewirtschaftungsermessen | 353 | ||
| 1. Das Modell der bipolaren Zweckprogrammierung der Interpretation doppelseitiger Rechtssätze | 354 | ||
| 2. Die Divergenz von Immissionsvermeidungs- und Immissionsduldungspflicht in § 5 N r . l BImSchG und das Luftbewirtschaftungsermessen der Verwaltung | 357 | ||
| 3. Ermessensbindungen | 362 | ||
| 4. Luftbewirtschaftungsermessen und Grundgesetz | 365 | ||
| IV. Konsequenzen des Interpretationsvorschlags, insbesondere für die Funktion der TA Luft | 369 | ||
| 1. Tendenzielle SicherheitsVerbesserung | 369 | ||
| 2. Ermöglichung von Immissionsvorsorge | 370 | ||
| 3. Dogmatische Grundlegung für bereits etablierte Bewirtschaftungspraxis | 371 | ||
| 4. Beitrag zur Harmonisierung des Umweltrechts | 372 | ||
| 5. Bewirtschaftungsermessen und Rechtssicherheit: Zur Verbindlichkeit der TA Luft | 372 | ||
| § 21 Gefahr, Gefahrenverdacht, Gefährlichkeitsverdacht | 378 | ||
| A. Das Problem: Gefahrenprognose ohne empirisch „gesicherte" Grundlage? | 378 | ||
| B. Gefahr und Erkenntnis | 382 | ||
| C. Bundes-Immissionsschutzgesetz und Gefährlichkeitsverdacht | 390 | ||
| § 22 „Sicherstellung" der „Grundpflichten"-Erfüllung gemäß § 6 Nr. 1 BImSchG | 392 | ||
| A. Die Funktion der „Sicherstellung" gemäß § 6 Nr. 1 BImSchG | 392 | ||
| B. Der Zeitraum, auf den sich die Prognose bezieht | 394 | ||
| C. Der Sicherheitsstandard des § 6 BImSchG | 397 | ||
| § 23 Schlußbemerkung | 399 | ||
| Literaturverzeichnis | 404 | ||
| Sachregister | 420 |
