Gemeindliche Betätigungen rein erwerbswirtschaftlicher Art und »Öffentlicher Zweck« kommunaler wirtschaftlicher Unternehmen
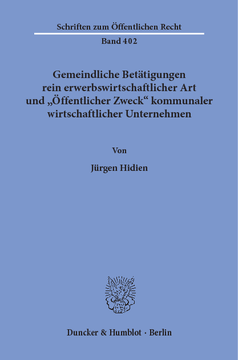
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Gemeindliche Betätigungen rein erwerbswirtschaftlicher Art und »Öffentlicher Zweck« kommunaler wirtschaftlicher Unternehmen
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 402
(1981)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 16 | ||
| Einleitung | 19 | ||
| 1. Einführende Überlegungen | 19 | ||
| 2. Problemstellung | 20 | ||
| 3. Gang der Untersuchung | 23 | ||
| 1. Teil: Zu den Grundlagen | 24 | ||
| § 1 Die rechtlichen Voraussetzungen der kommunalen Wirtschaftstätigkeit | 24 | ||
| A. Die Rechtsgrundlagen | 24 | ||
| I. Die deutsche Gemeindeordnung vom 30.1.1935 | 24 | ||
| 1. §§ 67 ff. DGO | 24 | ||
| 2. Die amtliche Begründung zu § 67 DGO | 26 | ||
| II. Die Gemeindeordnungen der einzelnen Bundesländer ab 1945 | 27 | ||
| B. Der Anwendungsbereich der §§ 67 ff. DGO | 31 | ||
| I. Mögliche Normadressaten | 31 | ||
| II. Der Anwendungsbereich des § 67 DGO im Hinblick auf § 69 DGO | 32 | ||
| III. Der Begriff des wirtschaftlichen Unternehmens in § 67 DGO | 34 | ||
| 1. Der gegenständliche Bereich | 34 | ||
| 2. Die begriffliche Problematik | 39 | ||
| a) Ausgangssituation | 39 | ||
| b) Rechtsprechung und Literatur | 40 | ||
| 3. Eingrenzungen | 41 | ||
| a) Begriffsverständnis | 41 | ||
| b) Begriffsmerkmale | 42 | ||
| aa) Das formale Popitz-Kriterium | 42 | ||
| bb) Wertschöpfung | 43 | ||
| cc) Dauerhafte Organisationseinheit | 43 | ||
| dd) Verselbständigung | 43 | ||
| ee) Fremdbedarfsdeckung | 44 | ||
| ff) Wirtschaftliche Arbeitsmethoden | 44 | ||
| gg) Zwischenergebnis | 44 | ||
| 4. Ausgrenzungen | 45 | ||
| a) Einrichtungen des § 67 Abs. 2 DGO | 45 | ||
| b) „Öffentlicher Zweck" | 45 | ||
| c) Vermögensverwaltung | 46 | ||
| d) Daseinsvorsorgende Tätigkeit | 46 | ||
| e) Entgeltlichkeit | 47 | ||
| f) Gewinnerzielungsabsicht | 48 | ||
| IV. Schutz des Besitzstandes | 48 | ||
| C. Ergebnis | 49 | ||
| § 2 Bestandsaufnahme zum Verhältnis von „öffentlichem Zweck" und rein erwerbswirtschaftlicher Betätigung | 51 | ||
| A. Der „öffentliche Zweck": Sprachgebrauch in anderen Gesetzen | 51 | ||
| B. Die Rechtsprechung zum Begriff des öffentlichen Zwecks | 52 | ||
| I. Einleitung | 52 | ||
| II. Die Rechtsprechung vor Erlaß der DGO | 54 | ||
| III. Die Rechtsprechung zu den Nachfolgebestimmungen | 56 | ||
| 1. Kommunales Bestattungswesen | 56 | ||
| 2. Kommunales Reisebüro | 58 | ||
| 3. Kommunale Verkehrs- und Versorgungsbetriebe | 58 | ||
| 4. Kommunales Anzeigengeschäft | 59 | ||
| 5. Blockeisverkauf durch kommunalen Schlachthof | 60 | ||
| 6. Kommunale Turnhallenüberlassung | 61 | ||
| 7. Verkauf von KfZ-Kennzeichenschildern durch einen Landkreis | 61 | ||
| 8. Kommunale Wohnungsvermittlung | 63 | ||
| 9. Kommunale Beteiligung an Speditionsunternehmen | 64 | ||
| C. Das Schrifttum zum Begriff des öffentlichen Zwecks | 64 | ||
| I. Einleitung | 64 | ||
| II. Das Schrifttum vor Erlaß der DGO | 64 | ||
| III. Das Schrifttum zu § 67 DGO | 68 | ||
| IV. Das Schrifttum zu den Nachfolgebestimmungen des § 67 | 69 | ||
| D. Ergebnis und Kritik | 73 | ||
| § 3 Rechtstheoretische Grundlegung | 77 | ||
| A. Problemstellung | 77 | ||
| B. Charakterisierungen der Rechtsnatur des „öffentlichen Zwecks" | 77 | ||
| C. Die Struktur des Begriffs „öffentlicher Zweck" | 78 | ||
| I. Unterscheidung von normtheoretischen und staatstheoretischen Argumentationen | 78 | ||
| II. Normtheoretische Argumentationen | 82 | ||
| 1. Wertbegriffe | 82 | ||
| 2. Generalklauseln | 83 | ||
| 3. Typenbegriffe | 84 | ||
| 4. Vagheit | 85 | ||
| 5. Mehrdeutigkeit | 88 | ||
| 6. Porosität | 89 | ||
| 7. Dispositionsbegriffe | 91 | ||
| 8. Leerformeln | 93 | ||
| D. Ergebnis | 93 | ||
| § 4 Rechtsmethodische Grundlegung | 95 | ||
| A. Zur Methodik im Allgemeinen | 95 | ||
| I. Berechtigung der Darlegungen | 95 | ||
| II. Begriff und Sinn von Methodik | 96 | ||
| B. Die Auslegungs- und Anwendungslehren | 97 | ||
| I. Einleitung | 97 | ||
| II. Die Auslegungslehren | 98 | ||
| III. Die Anwendungslehren | 100 | ||
| 1. Die syllogistische Lehre von der Subsumtion | 101 | ||
| 2. Die Theorien normfreien Entscheidens | 102 | ||
| 3. Die Gleichsetzungslehren | 102 | ||
| 4. Stellungnahme | 103 | ||
| IV. Zum Verfahren der Konkretisierung | 104 | ||
| 1. Allgemeine Umschreibung | 104 | ||
| 2. Normtextauslegung bei vagen Begriffen | 107 | ||
| a) Weder subjektive noch objektive Theorie | 107 | ||
| b) Grammatische Auslegung | 107 | ||
| aa) Positive und negative Kandidaten | 108 | ||
| bb) Neutrale Kandidaten | 108 | ||
| 3. Weitere Konkretisierungselemente | 111 | ||
| a) Kontextabhängigkeit der Aspekte | 111 | ||
| b) Besonderheiten des Rechtsgebiets | 112 | ||
| c) Einzelnormbezug | 113 | ||
| d) Sachgehalte | 114 | ||
| aa) Sachbezug der Norm | 114 | ||
| bb) Interdisziplinäre Konzeption | 116 | ||
| e) Einzelfallbezug | 116 | ||
| C. Ergebnis | 118 | ||
| 2. Teil: Zur Konkretisierung des Begriffs „öffentlicher Zweck" | 119 | ||
| Problemstellung | 119 | ||
| § 5 Verfassungsrechtliche Vorgaben | 121 | ||
| Einleitung | 121 | ||
| A. Gewährleistung der erwerbswirtschaftlichen Betätigung der Kommunen durch das Grundgesetz? | 122 | ||
| I. Positive Hinweise des Verfassungsrechts | 122 | ||
| II. Gewerbefreiheit der öffentlichen Hand (Kommunen), Art. 2 I, 12 I, 14 GG | 122 | ||
| III. Art. 28 II GG | 124 | ||
| B. Verbote oder Einschränkungen? | 126 | ||
| I. Verstoß gegen die im Grundgesetz verwirklichte Wirtschaftsverfassung? | 126 | ||
| II. Die Zulässigkeit öffentlich-erwerbswirtschaftlicher Betätigung im Lichte einzelner Grundrechtsbestimmungen | 127 | ||
| 1. Zur Fiskalgeltung der Grundrechte | 127 | ||
| 2. Wettbewerbsschutz als Konkurrentenschutz, Art. 2 I, 12 I, 14 GG? | 128 | ||
| 3. Grundrecht auf Chancengleichheit, Art. 3 Abs. 1 GG? | 129 | ||
| 4. Das Verbot kalter Sozialisierung, Art. 15 GG? | 129 | ||
| 5. Das Subsidiaritätsprinzip als allgemeiner Rechtsgrundsatz der Verfassung? | 130 | ||
| 6. Erwerbswirtschaftliche Zwecksetzung und „öffentlicher Zweck" als allgemeines Rechtsprinzip | 131 | ||
| C. Ergebnis | 136 | ||
| § 6 Die rein erwerbswirtschaftliche Betätigung als negativer Kandidat des Gemeinwohlbegriffs „öffentlicher Zweck" in § 67 Abs. 1 DGO | 138 | ||
| Problemstellung | 138 | ||
| A. Grammatische Auslegung | 139 | ||
| I. Gegenstand | 139 | ||
| II. Zum Zweckbegriff | 140 | ||
| 1. Bedeutung | 140 | ||
| 2. Grundstruktur | 141 | ||
| 3. Weitere Kennzeichen | 144 | ||
| a) Zweck-Setzung | 144 | ||
| b) Zweck-Realisation | 145 | ||
| c) Zweck-Feststellbarkeit | 145 | ||
| III. Zum mehrdeutigen Begriff des Öffentlichen | 146 | ||
| 1. Ansatz | 146 | ||
| 2. Zu den Bedeutungen des Rechtswortes „öffentlich" | 147 | ||
| a) Seine Grundbedeutung: Faktische Offenheit für einen Adressatenkreis | 148 | ||
| b) Staatsbezogene Öffentlichkeit | 150 | ||
| c) Öffentlich als Bestandteil von Wertbegriffen | 151 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 152 | ||
| IV. „Öffentlicher Zweck" als Gemeinwohlbegriff | 152 | ||
| 1. „Öffentlicher Zweck" als Wertbegriff | 152 | ||
| 2. Das Subjekt der Zweckvorstellungen in § 67 Abs. 1 | 153 | ||
| 3. Die Wertschöpfung des Subjekts in § 67 Abs. 1 — umschreibende Definition des „öffentlichen Zwecks" | 157 | ||
| V. Öffentliche und rein erwerbswirtschaftliche Zwecke qua Wortlaut als Antitopoi | 160 | ||
| 1. Die maßgebliche Bedeutung des mehrdeutigen Ausdrucks „öffentlicher Zweck" | 161 | ||
| 2. Erwerbswirtschaftliche Chance und Vorranggrundsatz | 165 | ||
| VI. Ergebnisse der grammatischen Auslegung | 167 | ||
| B. Historische Auslegung | 168 | ||
| C. Genetische Auslegung | 168 | ||
| I. Gegenstand | 168 | ||
| II. § 67 DGO | 170 | ||
| 1. Ökonomische und politische Interessen | 170 | ||
| 2. Kodifizierung | 174 | ||
| III. Die Nachfolgebestimmungen des § 67 DGO | 177 | ||
| 1. Problematik | 177 | ||
| 2. Nationalsozialistische Einflüsse | 177 | ||
| 3. Übernahme durch Landesgesetzgeber | 180 | ||
| D. Systematische Auslegung | 184 | ||
| I. Ansatzpunkte | 184 | ||
| II. Verbot der rein erwerbswirtschaftlichen Betätigung durch andere kommunalrechtliche Vorschriften? | 185 | ||
| 1. §§ 1, 2, 61 als Zulässigkeitsschranken? | 185 | ||
| 2. Andere gemeinwohlhaltige Vorschriften | 189 | ||
| III. Zulässigkeit der rein erwerbswirtschaftlichen Betätigung aufgrund allgemeiner Wirtschaftsgrundsätze? | 191 | ||
| E. Teleologische Auslegung | 193 | ||
| I. Einleitung | 193 | ||
| II. Rein erwerbswirtschaftliche Betätigung und Gemeinwohl | 193 | ||
| 1. Finanzpolitische Zielsetzung | 194 | ||
| 2. Kommunalpolitische Zielsetzung | 195 | ||
| 3. Wirtschaftspolitische Zielsetzung | 197 | ||
| 4. Volkswirtschaftliche Zielsetzung | 198 | ||
| 5. Zwischenergebnis | 200 | ||
| III. Die Zulassung einer begrenzten Erwerbswirtschaft | 200 | ||
| 1. Substanzerhaltung | 201 | ||
| 2. Schutz der Privatwirtschaft | 203 | ||
| IV. Die beteiligten Interessen | 203 | ||
| F. Dogmatische Elemente | 207 | ||
| I. Allgemeine Tendenz zur Berücksichtigung finanzieller Gesichtspunkte | 207 | ||
| II. Gegenstimmen auf Einzelnormebene, § 67 Abs. 1 DGO | 209 | ||
| 1. Die Auffassung von Erb | 209 | ||
| 2. Die Auffassung von Kratzer | 211 | ||
| 3. Die Auffassung von Niederleithinger | 212 | ||
| G. Rechtspolitische Elemente | 214 | ||
| I. Gegenstand | 214 | ||
| II. Die finanzpolitische Argumentation von Backhaus | 215 | ||
| H. Ergebnisse der Normkonkretisierung | 217 | ||
| § 7 Gemeinwohlprinzip und ökonomische Erfolgsprinzipien — Unterschiede zwischen kommunaler und privater Wirtschaft | 220 | ||
| A. Wirtschaftliche Handlungsprinzipien kommunaler Unternehmen | 220 | ||
| I. Wirtschaftsbegriff | 220 | ||
| II. Ökonomisches Prinzip: Minimum- und Maximumprinzip | 221 | ||
| III. Gemeinwohlbindung der kommunalen Unternehmung | 223 | ||
| Β. Wirtschaftlicher Handlungsumfang | 227 | ||
| I. Finanzierungskonzeption der privaten Unternehmung | 227 | ||
| II. Finanzierungskonzeption der kommunalen Unternehmung | 230 | ||
| 1. Unternehmenstypen | 230 | ||
| 2. Kostendeckende Wirtschaft | 232 | ||
| 3. Ertragserwirtschaftung | 234 | ||
| a) Untergrenze | 234 | ||
| b) Obergrenze | 235 | ||
| aa) Gewinnmaximierung | 236 | ||
| (1) Begründung der Ablehnung | 236 | ||
| (2) Spannungsverhältnis zwischen Finanzierungs- und Leistungszielen | 239 | ||
| (3) Modifikationen des Gewinnmaximierungsprinzips | 240 | ||
| bb) Positive Obergrenze: Das Angemessenheitsprinzip | 242 | ||
| (1) Empirische Geltung | 242 | ||
| (2) Normative Geltung | 243 | ||
| (3) Kompetenzieller Begriff | 244 | ||
| cc) Negative Obergrenze: Gemeinwohl-Gefährdung | 246 | ||
| 4. Zwei weitere Unterschiede zwischen privaten und kommunalen Unternehmungen | 247 | ||
| a) Mittelbeschaffung | 248 | ||
| b) Mittelverwendung | 249 | ||
| C. Ergebnis | 251 | ||
| Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse | 253 | ||
| Literaturverzeichnis | 257 |
