Die Entmündigung wegen Geisteskrankheit und Geistesschwäche
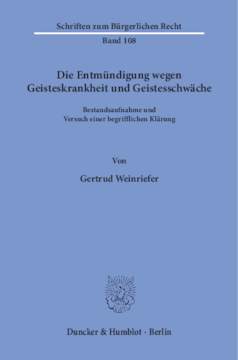
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Entmündigung wegen Geisteskrankheit und Geistesschwäche
Bestandsaufnahme und Versuch einer begrifflichen Klärung
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 108
(1987)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung | 17 | ||
| Erster Teil: Die Entwicklung des Rechtsinstituts der Entmündigung und der Einfluß der Medizin | 20 | ||
| A. Die rechtsgeschichtlichen Vorbilder | 20 | ||
| I. Code Civil und preußisches Allgemeines Landrecht | 20 | ||
| II. Die gemeinrechtliche Lehre | 21 | ||
| 1. Geisteszustand und (rechtsgeschäftliche) Handlungsfähigkeit | 21 | ||
| 2. Die Vormundschaft als Schutz für die Handlungsunfähigen | 22 | ||
| 3. Das Verfahren | 24 | ||
| 4. Die cura prodigi: Rechtsfürsorge durch Rechtsentziehung | 24 | ||
| III. Der richterliche Akt der Rechtsentziehung als Voraussetzung der Vormundschaft | 25 | ||
| 1. Modernes Rechtsdenken und römisch-rechtliche Tradition | 25 | ||
| 2. Die Übereinstimmung medizinischer und rechtlicher Begriffe | 26 | ||
| 3. Der Wandel in der Medizin und sein Einfluß auf das Recht | 26 | ||
| B. Zivilprozeßordnung und Bürgerliches Gesetzbuch | 27 | ||
| I. Das Entmündigungsverfahren: Die Rechtsentziehung rückt in den Vordergrund | 27 | ||
| 1. Die Beratungen | 28 | ||
| 2. Versuch eines Ausgleichs zwischen Rechtsentziehung und Fürsorge | 29 | ||
| II. Die Voraussetzungen der Entmündigung nach § 6 I Nr. 1 BGB | 30 | ||
| 1. Geisteskrankheit: Grund für die Entmündigung und Ursache der natürlichen Geschäftsunfähigkeit | 30 | ||
| 2. Die Stellungnahme der medizinischen Sachverständigen | 31 | ||
| 3. Der weitere Gang der Beratungen | 32 | ||
| a) Der Anfang einer Unklarheit: § 6 I Nr. 1 im Verhältnis zu § 104 Nr. 2 BGB | 32 | ||
| b) Geistesschwäche als Entmündigungsgrund | 33 | ||
| c) Das Auseinanderfallen von rechtlicher und medizinischer Terminologie | 33 | ||
| d) Die Unklarheit der Rechtsbegriffe | 34 | ||
| e) Der Zweck der Entmündigung | 35 | ||
| f) Trunksucht als Entmündigungsgrund – Zeichen für soziale Fürsorge durch das Recht | 36 | ||
| III. Die Vormundschaft als Kehrseite der Entmündigung | 37 | ||
| 1. Keine Vormundschaft über Erwachsene ohne Entmündigung | 37 | ||
| 2. Vormundschaft als „künstliches Familienverhältnis“ | 38 | ||
| 3. Die Selbständigkeit des Vormunds | 39 | ||
| 4. Das Übergewicht der vermögensrechtlichen Vorschriften und die unbestimmte Befugnis zur Personensorge | 39 | ||
| 5. Die Pflegschaft im Gegensatz zur Vormundschaft: Das Prinzip der Freiwilligkeit | 40 | ||
| C. Zusammenfassung und Ergebnis | 41 | ||
| I. Die Entmündigung: Der Versuch, alte Rechtslehren geänderten Verhältnissen anzupassen | 41 | ||
| II. Verdeutlichung der Ergebnisse des 1. Teils: Entmündigung und Vormundschaft im Spiegel der Kritik und Rechtsvergleichung | 43 | ||
| 1. Formelle, aber nicht materielle Gerechtigkeit | 43 | ||
| 2. Liberales Ordnungsdenken, das den Gedanken der sozialen Fürsorge außer acht läßt | 44 | ||
| 3. Das schweizerische Zivilgesetzbuch | 45 | ||
| Zweiter Teil: Entmündigung und Psychiatrie | 47 | ||
| A. Grundlagen in der älteren Lehre der forensischen Psychiatrie | 47 | ||
| I. Die notwendige medizinische Entscheidungshilfe | 47 | ||
| 1. Welche Frage soll der Sachverständige beantworten? | 47 | ||
| 2. Die Hoffnung auf eindeutige medizinische Befunde | 48 | ||
| 3. Grundannahmen der Psychiatrie | 48 | ||
| II. Die Grundlagen der „psychiatrischen“ Auslegung des § 6 I Nr. 1 BGB | 49 | ||
| 1. Der Gesetzeszweck | 50 | ||
| 2. Die Tatbestandsmerkmale des § 6 I Nr. 1 BGB | 50 | ||
| III. Die Psychopathie als Erweiterung der psychiatrischen Systematik | 50 | ||
| 1. Der Begriff | 51 | ||
| a) Die Unterscheidung von Wertnorm und Durchschnittsnorm | 51 | ||
| b) Gründe, weshalb die Psychopathie nicht als Krankheit gelten soll | 52 | ||
| 2. Psychopathie als Geistesschwäche im Sinne des Rechts | 52 | ||
| a) Der Gesetzeszweck als Richtschnur | 53 | ||
| b) Die Methode des Gutachters | 53 | ||
| c) Die Schwierigkeit, sich auf einen rein medizinischen Befund zu beschränken | 54 | ||
| d) Die Entmündigung als soziale Fürsorge | 55 | ||
| IV. Zusammenfassung und Ergebnis | 55 | ||
| 1. Unklarheiten auf beiden Seiten | 55 | ||
| 2. Das Ineinandergreifen von Recht und Psychiatrie | 56 | ||
| B. Systematik und Krankheitsbegriff der heutigen Psychiatrie | 56 | ||
| I. Die Grundlagen | 57 | ||
| 1. Die Aufgabe des Krankheitsbegriffs | 57 | ||
| a) Wertnorm und Durchschnittsnorm | 58 | ||
| b) Die naturwissenschaftliche Grundlage | 59 | ||
| II. Die Tauglichkeit des Krankheitsbegriffs für das bürgerliche Recht | 59 | ||
| 1. Der Zusammenhang zwischen rechtlicher Entlastung und Krankheit | 59 | ||
| 2. Die unscharfen Grenzen | 60 | ||
| 3. Die Unterscheidung zwischen natürlicher Geschäftsunfähigkeit (§ 104 Nr. 2 BGB) und dem Rechtszustand, den die Entmündigung bewirkt | 60 | ||
| a) Der Bezugspunkt der beiden Vorschriften | 60 | ||
| b) Die Sozialprognose als Gesichtspunkt für eine Entmündigung | 61 | ||
| 4. Psychiatrische Systematik und Entmündigung | 61 | ||
| a) Psychische Variationen | 62 | ||
| b) Psychosen | 62 | ||
| 5. Die Auffassung Langelüddekes: Alle Tatbestandsmerkmale des § 6 I Nr. 1 BGB sind Gegenstand der psychiatrischen Beurteilung | 62 | ||
| C. Der Psychiatriebegriff in der Kritik | 64 | ||
| I. Die Kritik Jaspers | 64 | ||
| 1. Wertnorm und Durchschnittsnorm | 64 | ||
| 2. Die Zeitgebundenheit des Krankheitsbegriffs | 65 | ||
| II. Die Antipsychiatrie | 65 | ||
| III. Die Thesen Foucaults | 66 | ||
| 1. Geschichtliche Grundlagen | 66 | ||
| 2. Die Wandlung des Begriffs „Wahnsinn“ | 67 | ||
| 3. Die Verbindung von Recht und Psychiatrie | 68 | ||
| 4. Der alte juristische Begriff der Geisteskrankheit und der neue, auf ihm aufbauende der Psychiatrie | 68 | ||
| 5. Geisteskrankheit als moralische Straffälligkeit | 69 | ||
| D. Zusammenfassung und Ergebnis | 69 | ||
| I. Der Krankheitsbegriff der Psychiatrie – geprägt von medizinischen, sozialen und normativen Elementen | 69 | ||
| II. Die Auslegung des § 6 I Nr. 1 BGB in der forensischen Psychiatrie | 70 | ||
| III. Die Aufgabenteilung zwischen dem Richter und dem Sachverständigen | 70 | ||
| IV. Der Unterschied zwischen § 6 I Nr. 1 und § 104 Nr. 2 BGB | 71 | ||
| V. Geschäftsfähigkeit und „Sozialfähigkeit“ | 71 | ||
| Dritter Teil: Die Entmündigung in Rechtswissenschaft und Rechtsprechung | 73 | ||
| A. Die Rechtswissenschaft im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs | 73 | ||
| I. Psychiatrisch-juristische Zusammenarbeit | 73 | ||
| 1. Die Verbindung von Recht und Psychiatrie | 74 | ||
| 2. Die Unfähigkeit, seine Angelegenheiten zu besorgen | 74 | ||
| 3. Das Verhältnis des § 6 I Nr. 1 zu § 104 Nr. 2 BGB | 75 | ||
| II. Die Tatbestandsmerkmale des § 6 I Nr. 1 BGB als reine Rechtsbegriffe | 75 | ||
| 1. Die fehlende Eignung des medizinischen Krankheitsbegriffs für die Entmündigung | 75 | ||
| 2. Geisteskrankheit und Geistesschwäche als Rechtsbegriffe | 76 | ||
| III. Die vermittelnden Lösungsansätze | 77 | ||
| 1. Die Formeln der „herrschenden Lehre“ | 77 | ||
| 2. Der Zweck als Richtschnur für die Auslegung | 78 | ||
| IV. Ergebnis | 78 | ||
| 1. Die Auffassung, geistige Störungen seien hirnorganisch bedingt, und ihre Folgen | 79 | ||
| 2. Die Folgen eines juristisch-ökonomischen Krankheitsbegriffs | 80 | ||
| B. Das nationalsozialistische Verständnis | 81 | ||
| I. Der Zusammenhang zwischen Entmündigung und Vormundschaft | 82 | ||
| II. Die Auslegung des § 6 BGB | 82 | ||
| III. Ergebnis | 83 | ||
| 1. Die medizinische Begründung | 83 | ||
| 2. Die Verbindung von Vormundschaft und Entmündigung | 83 | ||
| C. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts | 86 | ||
| I. Die Entmündigung als Mittel des rechtsgeschäftlichen Schutzes | 86 | ||
| II. Die quantitative Ordnung im Tatbestand des § 6 I Nr. 1 BGB | 86 | ||
| 1. Die Abgrenzung von Geisteskrankheit und Geistesschwäche | 86 | ||
| 2. Der Umfang der Angelegenheiten | 87 | ||
| III. Die inhaltliche Bestimmung der Tatbestandsmerkmale des § 6 I Nr. 1 BGB | 87 | ||
| 1. Das Verhältnis von § 6 I Nr. 1 und § 104 Nr. 2 BGB | 87 | ||
| 2. Geisteskrankheit und Geistesschwäche als medizinische Störung | 88 | ||
| a) Die Psychopathie als Geistesschwäche im Sinne des Rechts | 88 | ||
| b) Der „Querulantenwahnsinn“ als Entmündigungsgrund | 88 | ||
| 3. Der Begriff der Angelegenheiten | 90 | ||
| IV. Ergebnis | 91 | ||
| 1. Ungenügende inhaltliche Bestimmung | 91 | ||
| 2. Ansätze einer Auseinandersetzung mit der Psychiatrie | 92 | ||
| D. Rechtswissenschaft und Rechtsprechung nach 1945 | 93 | ||
| I. Die Rechtswissenschaft | 93 | ||
| 1. Der Zweck der Entmündigung | 93 | ||
| 2. Geisteskrankheit und Geistesschwäche | 93 | ||
| 3. Die Angelegenheiten | 94 | ||
| II. Die Rechtsprechung: Der Aufstieg der Ersatzformen | 94 | ||
| 1. Die vorläufige Vormundschaft | 95 | ||
| 2. Die Zwangspflegschaft | 96 | ||
| a) Die rechtliche Begründung der Zwangspflegschaft | 96 | ||
| b) Die Stellung des geistig Gebrechlichen im Verfahren | 97 | ||
| c) Die Auswirkungen der Zwangspflegschaft auf die Vorschrift des § 6 I Nr. 1 BGB | 98 | ||
| III. Zusammenfassung und Ergebnis | 99 | ||
| 1. Die Ersatzformen – ein Prüfstein für die herkömmliche Auslegung des § 6 I Nr. 1 BGB | 99 | ||
| 2. Rechtsverlust als Rechtsfürsorge | 100 | ||
| 3. Der Begriff der Geschäftsfähigkeit | 101 | ||
| Vierter Teil: Die Entmündigung in der amtsgerichtlichen Praxis | 102 | ||
| A. Darstellung der Verfahren | 102 | ||
| I. Grundlagen der Untersuchung | 102 | ||
| II. Die Entmündigungsanträge: Die Antragsteller und ihre Beweggründe | 103 | ||
| 1. Die privaten Antragsteller | 104 | ||
| a) Entmündigungsanträge gegen ältere Menschen | 105 | ||
| b) Geistig Behinderte | 106 | ||
| c) Psychische Krankheit | 107 | ||
| d) Trunksüchtige | 108 | ||
| 2. Die Entmündigungsanträge der Staatsanwaltschaft | 108 | ||
| a) Psychische Krankheit | 108 | ||
| b) Andere Gründe | 110 | ||
| 3. Die Anträge der Gemeinde gegen Trunksüchtige | 110 | ||
| III. Der Gang des Verfahrens nach der Antragstellung | 112 | ||
| 1. Die vorläufige Vormundschaft | 112 | ||
| 2. Der Auftrag an den Gutachter | 113 | ||
| 3. Die Anhörung der zu Entmündigenden | 113 | ||
| a) Die Ermittlungen des Richters | 114 | ||
| b) Die Stellungnahmen der zu Entmündigenden | 114 | ||
| IV. Der Sachverständige | 116 | ||
| 1. Die Gutachten für psychisch Kranke | 116 | ||
| a) Vorläufige Vormundschaft und Aussetzung des Verfahrens – ein von Sachverständigen empfohlener Entmündigungsersatz | 116 | ||
| b) Gutachten im Entmündigungs- und Unterbringungsverfahren | 119 | ||
| 2. Die Gutachten für geistig Behinderte | 120 | ||
| a) Völlig hilflose und pflegebedürftige Behinderte | 120 | ||
| b) Fälle, in denen eine soziale Betreuung angestrebt wird | 121 | ||
| 3. Die Gutachten bei Trunksüchtigen | 122 | ||
| V. Das Verfahren nach Erstellung des Gutachtens | 123 | ||
| 1. Verfahren, die mit einer Entmündigung enden | 123 | ||
| a) Psychisch Kranke | 123 | ||
| b) Geistig Behinderte | 125 | ||
| c) Trunksüchtige | 126 | ||
| 2. Verfahren, die nicht mit einer Entmündigung abschließen | 126 | ||
| a) Ersatzformen | 126 | ||
| b) Anträge, die sich als unbegründet erweisen | 126 | ||
| c) Pflegschaft an Stelle von Entmündigung | 127 | ||
| B. Auswertung | 129 | ||
| I. Vormundschaft als Ziel der Entmündigung | 129 | ||
| 1. Die Vormundschaft bei psychisch Kranken – Mittel der privatrechtlichen Unterbringung | 130 | ||
| a) Vormundschaftliche Rechte, die keine Grundlage in der Entmündigung haben | 131 | ||
| b) Die Gefahr, daß das Vormundschaftsrecht die Entmündigungsgründe erweitert | 131 | ||
| c) Die Möglichkeit, den Mündel unterzubringen, als Entmündigungsgrund | 132 | ||
| 2. Die Vormundschaft als Ersatz der elterlichen Sorge bei geistig Behinderten | 134 | ||
| a) Fürsorgebedürfnis ohne notwendigen Rechtsverlust | 134 | ||
| b) Die in der Praxis fehlenden Grenzen zwischen Entmündigung und Pflegschaft | 135 | ||
| 3. Die Vormundschaft für Jugendliche, die mit 18 Jahren noch nicht mündig werden sollen | 136 | ||
| a) Die Vormundschaft als Mittel der „pädagogischen Einwirkung“ | 136 | ||
| b) Eine für nichtig erklärte Vorschrift des Bundessozialhilfegesetzes im Vergleich mit § 6 I Nr. 1 BGB | 137 | ||
| II. Der Fürsorgegedanke als Verfahrensprinzip | 139 | ||
| 1. Die Entmündigung: Wohltat und nicht Eingriff | 139 | ||
| 2. Der zu Entmündigende als „Gegenstand“ der Fürsorge | 139 | ||
| 3. Der Entmündigungsantrag – ein Präjudiz | 140 | ||
| III. Die Entscheidungsmacht des Sachverständigen | 141 | ||
| 1. Die Sachverständigenermittlung | 141 | ||
| 2. Der Entmündigungsbeschluß: Das richterlich „beurkundete“ Gutachten | 142 | ||
| IV. Die „Ersatzformen“ der Entmündigung – insbesondere die vorläufige Vormundschaft | 143 | ||
| 1. Die Absicht des Gesetzgebers | 144 | ||
| 2. Die Aussetzung nach § 681 ZPO – Mittel der „künstlichen Dehnung“ des Entmündigungsverfahrens und der vorläufigen Vormundschaft | 144 | ||
| a) Die Begründung | 144 | ||
| b) Die Schwächen der Begründung | 145 | ||
| 3. Die Verbindung von Aussetzung und vorläufiger Vormundschaft | 146 | ||
| V. Die rechtspolitischen Vorschläge und das österreichische Sachwalterrecht: Bestätigung für die vorgefundene Praxis | 147 | ||
| 1. Die „Psychiatrie-Enquête“ | 147 | ||
| 2. Die Empfehlungen der Kommission für das Recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit | 148 | ||
| 3. Ein besonderes Rechtsinstitut für geistig Behinderte | 148 | ||
| 4. Das österreichische Sachwalterrecht | 149 | ||
| C. Zusammenfassung und Ergebnis | 151 | ||
| I. Die Vormundschaft: Ein Auffangbecken für persönliche und soziale Hilfen, zu denen gesetzlich nur die Entmündigung führt | 151 | ||
| II. Das medizinische Verständnis beherrscht die Entmündigung | 152 | ||
| III. Die Praxis: Vorwegnahme der Regelungen, die in der Reformdiskussion vorgeschlagen werden | 152 | ||
| Fünfter Teil: Versuch einer begrifflichen Klärung | 154 | ||
| A. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme als Grundlage der begrifflichen Klärung | 154 | ||
| I. Der Konflikt zwischen unterschiedlichen Bezugspunkten: Rechtsgeschäftliche oder persönliche und soziale Handlungsfähigkeit | 154 | ||
| II. Ein System persönlicher und sozialer Betreuung in den Begriffen des bürgerlichen Rechts | 155 | ||
| B. Der Zweck als Richtschnur der Auslegung des § 6 I Nr. 1 BGB | 158 | ||
| I. Welches ist der Zweck der Vorschrift des § 6 I Nr. 1 BGB? | 159 | ||
| 1. Die Systematik des Gesetzes | 159 | ||
| 2. Hat die Personensorge des Vormunds Einfluß auf den Zweck der Entmündigung? | 159 | ||
| II. Die Begriffe Geisteskrankheit und Geistesschwäche | 161 | ||
| III. Das Unvermögen, seine Angelegenheiten zu besorgen | 163 | ||
| IV. Ergebnis | 164 | ||
| Literaturverzeichnis | 166 |
