Paradeigmata
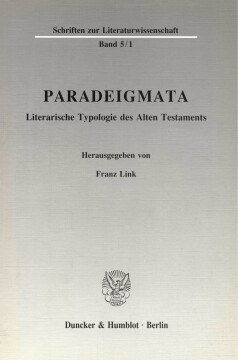
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Paradeigmata
Literarische Typologie des Alten Testaments. 1. Teil: Von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert
Editors: Link, Franz
Schriften zur Literaturwissenschaft, Vol. 5/1
(1989)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Die als »literarische Typologie des Alten Testaments« hier vorgelegten Untersuchungen gehen davon aus, daß Werke der schönen Literatur oder deren Motive in ähnlicher Weise als Antitypen zu den entsprechenden Typen des Alten Testaments betrachtet werden können wie die Antitypen des Neuen Testaments in der biblischen Exegese. Der Rückbezug auf das im Alten Testament vorgegebene Muster erlaubt es, die jeweils zeitgenössisch bedingte Eigenheit herauszuarbeiten. Wenn, wie in Thomas Manns »Joseph und seine Brüder«, das biblische Geschehen neu erzählt wird, vermag dessen Verständnis der alten Geschichte aus der Perspektive unserer Zeit neu erschlossen zu werden; Geschehen unserer Zeit wird durch den Bezug, in den es etwa in Joseph Roths »Hiob« zur biblischen Geschichte gesetzt wird, an dieser gemessen. Es geht in den hier vorgelegten Studien nicht darum, den vorgegebenen Text bis zur Sinnlosigkeit im Sinne dekonstruktivistischer Theorie zu befragen, sondern bescheidener und pragmatischer darum, die Wiederkehr der durch das Alte Testament begrenzten Anzahl von Grundmustern in der Literatur zu untersuchen. Neben anderen Quellen solcher Grundmuster - wie etwa den »Metamorphosen« Ovids - genießt das Alte Testament die Besonderheit des ursprünglich angenommenen Offenbarungscharakters, der auch im säkularisierten Bereich als Autorität nachzuwirken vermochte. Methodisch knüpfen die Studien an die Forschungen zur literarischen Übertragung der exegetischen Typologie in die Literatur durch Auerbach, Schwietering, Ohly u.a. an, bedienen sich aber eines in der neueren Forschung gebräuchlich werdenden, der obigen Beschreibung entsprechenden Typologiebegriffs. Dabei werden unterschiedliche Ansätze gefunden, wenn z.B. Alois Wolf nachweist, wie das Prinzip des typologischen Verweisens in der mittelalterlichen Literatur von der Bibel auf andere Stoffbereiche übertragen wird, wenn Ruprecht Wimmer auf die Schwierigkeit der Überführung der typologischen Darstellung in die rationalistische Konstruktion abhebt, Hans-Werner Ludwig für seine Interpretation von William Blake einen engeren Typologiebegriff in Abgrenzung zu den verschiedenen Tendenzen in der gegenwärtigen Forschung entwickelt oder Erich Kleinschmidt von einer »Poetik der Auflösung« bei seiner Betrachtung der Hiob-Mythe in der Literatur des 20. Jahrhunderts spricht. Nach der methodischen Einleitung unter dem Titel »Möglichkeiten einer literarischen Typologie des Alten Testaments« untersuchen 45 Beiträge an repräsentativen Beispielen der Weltliteratur solche Möglichkeiten. Dabei werden fast alle Bücher des Alten Testaments berührt und kommen alle Zeiten - vom 1. Jahrhundert nach Christus bis zur unmittelbaren Gegenwart zur Zeit des Abschlusses der Studien (1988) - und eine ausgewogene Breite der verschiedenen Literaturen zu Wort. Die altägyptische Literatur wird in einem Anhang als Präfiguration zur Sprache gebracht. Die Breite der Studien erlaubt eine Auswertung im abschließenden Kapitel unter dem Titel »Erträge einer literarischen Typologie des Alten Testaments«. Unter Hinzuziehung weiterer Materialien und im Rückgriff auf weitere Forschungen zu dem Gegenstand kommt hierbei die Behandlung der verschiedenen biblischen Muster zu einer vergleichenden Betrachtung, wird die Entwicklung von den Anfängen bis in unsere Gegenwart aufgezeigt und auf die unterschiedlichen Realisationen in den verschiedenen nationalen, konfessionellen oder anderen Bereichen verwiesen.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhalt | 7 | ||
| Möglichkeiten einer literarischen Typologie des Alten Testaments | 11 | ||
| LOTHAR RUPPERT: Liebe und Bekehrung: Zur Typologie des hellenistisch-jüdischen Romans. Josef und A senat | 33 | ||
| I. | 33 | ||
| II. | 34 | ||
| III. | 34 | ||
| IV. | 36 | ||
| V. | 38 | ||
| VI. | 40 | ||
| VII. | 41 | ||
| VIII. | 41 | ||
| IX. | 41 | ||
| FELIX BÖHL: Die Gestalt Sauls in der frühen jüdischen Überlieferung | 43 | ||
| MARGOT SCHMIDT: Alttestamentliche Typologien in den Paradieseshymnen von Ephräm dem Syrer | 55 | ||
| 1. Das Bild Adams | 56 | ||
| 1.1 Urstand: Das „Lichtkleid des Paradieses“ oder das „Kleid der Herrlichkeit“ | 56 | ||
| 1.2 Adams Fall: er wurde nackt und häßlich wie Nabuchodonosor und Ozias | 57 | ||
| 1.3 Rückgewinnung des „Lichtkleides“ durch Christus, den neuen Adam – Nabuchodonosor, Typus der Rückkehr | 60 | ||
| 2. Das Gleichnis in Moses: Sinnbild der Vergöttlichung durch stufenweise Schau | 64 | ||
| 2.1 Mose, Zeuge Gottes durch das Buch – Verkündigung | 66 | ||
| 2.2 Das Buch Mose enthält die Symbole Christi | 68 | ||
| 3. Die Kosmographie des Paradieses als Typus der stufenweisen Beseligung und kosmischen Durchdringung | 69 | ||
| 3.1 Die Mitte des Paradieses: Die Schau des Unschaubaren, Ort der Anbetung | 72 | ||
| 3.2 Die Mitte des Paradieses: Das Brautgemach, Ort der Glückseligkeit | 76 | ||
| 4. Das Paradies, ein Typus der Kirche | 78 | ||
| ALOIS WOLF: „Non veni solvere sed adimplere ...“: Zu den möglichen typologischen Hintergründen eines mittelalterlichen Gestaltungsprinzips | 83 | ||
| HANS-JÜRGEN DILLER: Typologie in den englischen Fronleichnamsspielen: wann liegt sie vor und was bewirkt sie? | 103 | ||
| Zur Verwendung des Begriffs in der Forschung | 103 | ||
| Exemplarische Analysen | 108 | ||
| 1. Kriterien | 108 | ||
| 2. Die Opferung Isaaks im Chester-Zyklus | 108 | ||
| 3. Das Brome Abraham Play | 110 | ||
| 4. Die Opferung Isaaks im N-Town-Zyklus | 112 | ||
| Zusammenfassung | 114 | ||
| WILLI ERZGRÄBER: Abraham, Moses und David in William Langlands. Piers Plowman | 115 | ||
| VITO R. GIUSTINIANI: Das Alte Testament in der italienischen Literatur | 141 | ||
| HEINZ SCHULTE-HERBRÜGGEN: Alttestamentliche Typologien in Dantes Divina Comedia | 153 | ||
| ERIKA GLASSEN: Die Josephsgeschichte im Koran und in der persischen und türkischen Literatur | 169 | ||
| HUBERTUS SCHULTE HERBRÜGGEN: Wo ist dein Bruder Abel? Brudermord: Ein biblischer Motivtypus und seine Variationen in der englischen Literatur bis Shakespeare | 181 | ||
| Der biblische Motivtypus des Brudermords | 181 | ||
| Exkurs: Kain und Abel in der darstellenden Kunst | 185 | ||
| Das Motiv des Brudermords in der englischen Literatur bis Shakespeare | 186 | ||
| 1. Bibelepik | 187 | ||
| 2. Säkularisierende Ablösungsstufen | 191 | ||
| 3. Brudermord als losgelöstes Motiv in der Literatur | 195 | ||
| Ergebnis | 199 | ||
| MANFRED TIETZ: Die Gestalt des Königs David im spanischen Theater des Siglo de Oro: Tirso de Molina, Felipe Godínez und Pedro Calderón de la Barca | 203 | ||
| I. | 203 | ||
| II. | 205 | ||
| III. | 207 | ||
| IV. | 208 | ||
| V. | 213 | ||
| VI. | 217 | ||
| VII. | 223 | ||
| VIII. | 224 | ||
| VOLKER KAPP: Racines Esther und die Diskussion über die Bedeutung der biblischen Themen im klassischen französischen Drama | 227 | ||
| Der Esther-Stoff im französischen Theater des 17. Jahrhunderts als literaturgeschichtliches Problem | 227 | ||
| Die Vorstellung vom Erhabenen als Voraussetzungen für Racines Bearbeitung des Esther-Stoffes | 229 | ||
| Racines Esther als biblisches Theater des Erhabenen | 232 | ||
| FIDEL RÄDLE: Das Alte Testament im Drama der Jesuiten | 239 | ||
| Exegese und Drama | 239 | ||
| Ein Exempel: Baldes Jephtias | 242 | ||
| Die Bilanz aus den Periochen | 245 | ||
| Gattungen und Arten dramatischer Typologie | 247 | ||
| LUTZ RÖHRICH: Adam und Eva in der Volksliteratur | 253 | ||
| KLAUS WEISS: Typologie des Alten Testaments in John Miltons Samson Agonistes: Probleme, Analysen und Sichtweisen | 281 | ||
| URSULA BRUMM: Der Typ des Moses in den Meditationen von Edward Taylor | 299 | ||
| HANS GALINSKY: Typologisches Deuten zwischen kolonialem Puritanismus und Frühaufklärung. Drei Proben aus dem Lebenswerk Benjamin Tompsons (1642–1714) | 309 | ||
| RUPRECHT WIMMER: Ins Paradies verschlagen: Johann Gottfried Schnabels „geschickte Fiction“ von der Insel Felsenburg | 333 | ||
| I. | 333 | ||
| II. | 337 | ||
| III. | 340 | ||
| IV. | 345 | ||
| V. | 348 | ||
| HANS-WERNER LUDWIG: „In Eternity all is Vision“: Typologisches und apokalyptisches Denken bei William Blake | 351 | ||
| Typologese und Allegorese: Zum Forschungsstand | 352 | ||
| Allegory und vision: Konträre Seins- und Wahrnehmungsweisen | 357 | ||
| Blakes prophetisches Selbstverständnis | 362 | ||
| Jerusalem – Albion/London | 368 | ||
| Typologie in Blakes Ikonographie | 371 | ||
| Blake – „Literalist of the Imagination“ | 373 | ||
| GÜNTHER BLAICHER: Byrons Cain: Vom „negativen“ Typus zum Prototyp der Moderne | 375 | ||
| KLAUS LEY: Typologie und Bewußtseinsgeschichte: „La Judith moderne“ im historischen Roman bei Vigny, Mérimée, Balzac, Hugo und Flaubert | 393 | ||
| Charlotte Corday und die Episode der Jeanne de Belfiel in Vignys Cinq-Mars | 393 | ||
| Mémirée und Balzac in der Auseinandersetzung mit Vignys Typologiekonzept | 397 | ||
| Intertextualität im historischen Roman: Balzacs „Judith“ bei Hugo und Flaubert | 404 | ||
| UWE BAUMANN: Herman Melvilles Moby-Dick und das Alte Testament | 411 | ||
| Leviathan | 415 | ||
| Ahab | 421 | ||
| CHRISTOPH DAXELMÜLLER: Ester und die Ministerkrisen: Wandlungen des Esterstoffes in jüdischdeutschen und jiddischen Purimspielen | 431 | ||
| Purim, oder: ein Fest wird zum Theater | 432 | ||
| Purimspiele, Purimspieler: Die Ankunft der Theatertruppe | 438 | ||
| Purimspiele: Ein Beitrag zu Geschichte der Parodie | 443 | ||
| Themen, Typen und Motive | 450 | ||
| Akt I, oder: Die biblische Estererzählung | 450 | ||
| Akt II, oder: Der Narr, der sich in den Arsch blicken läßt | 451 | ||
| Intermezzo, oder: Der Auftritt des Herrn von Goethe | 452 | ||
| Akt III: Trunkenheit oder: Die verkehrte Welt | 454 | ||
| Akt: IV: Von Weibern, Kleidermoden und Kindern | 458 | ||
| Epilog: Der unsterbliche Haman | 461 | ||
| FRITZ PAUL: Ismael, Hiob, Jakob: Alttestamentarische Typologie bei August Strindberg | 465 | ||
| I. | 465 | ||
| II. | 468 | ||
| III. | 470 | ||
| IV. | 473 | ||
| V. | 479 | ||
| VI. | 482 | ||
| ANNEMARIE LINK-HEYDEMANN: Altägyptische Präfigurationen zu den biblischen Geschichten von Joseph, Moses und David | 487 |
