Die Frau in Gesellschaft und Kirche
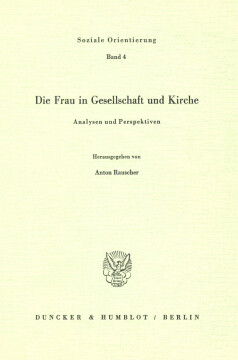
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Frau in Gesellschaft und Kirche
Analysen und Perspektiven
Editors: Rauscher, Anton
Soziale Orientierung, Vol. 4
(1986)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| I. Emanzipation und gesellschaftlicher Wandel | 9 | ||
| Gerhard Schmidtchen: Wohin gehen die Frauen? Soziologische und politische Überlegungen anhand einer Langzeitstudie | 11 | ||
| I. Die veränderte Situation der Frauen | 11 | ||
| II. Maßstäbe | 14 | ||
| III. Perspektiven | 16 | ||
| Literaturhinweise | 21 | ||
| Ursula Männle: Die Frau im Wandel der politischen Kultur | 23 | ||
| I. Zur Frage nach dem Wesen der Frau | 24 | ||
| II. Die Stellung der Frau im öffentlichen Leben Historische Aspekte | 26 | ||
| III. Von den Anfängen und Zielen der Frauenbewegungen in Deutschland | 30 | ||
| IV. Zur politischen Rolle der Frau in der Bundesrepublik Deutschland | 35 | ||
| Anton Rauscher: Die Auswirkungen des Wandels der sozio-ökonomischen Verhältnisse auf die Stellung und Rolle der Frau | 41 | ||
| I. Die Situation in der vorindustriell-agrarischen Gesellschaft | 43 | ||
| II. Die arbeitsteilige Wirtschaftsgesellschaft | 45 | ||
| III. Der Umbruch nach dem Zweiten Weltkrieg | 48 | ||
| IV. Für kombinatorische Lösungen im Spannungsverhältnis von Familie und Beruf | 52 | ||
| Literaturhinweise | 56 | ||
| Hartmut Kreß: Perspektiven des Wertewandels | 59 | ||
| I. Veränderungen in der Einstellung zur Religion Folgerungen für die kirchliche Praxis | 61 | ||
| II. Die gewandelte Situation der Frau Rückwirkungen auf Grundsatzfragen der Theologie | 64 | ||
| III. Wertewandel und gesellschaftliche Realität | 69 | ||
| Eugen Kleindienst: Emanzipation und Partnerschaft | 73 | ||
| I. Einige Befunde | 74 | ||
| 1. Prioritäten der Lebensorganisation | 74 | ||
| 2. Neue Formen der Partnerschaft | 75 | ||
| 3. Partnererwartungen | 76 | ||
| 4. Verschiebungen des „geistigen Klimas“ | 77 | ||
| 5. Zum Profil der Veränderungen | 78 | ||
| II. Analytische Überlegungen | 79 | ||
| 1. Partnerschaft im Kontext der Emanzipation | 80 | ||
| 2. Freie Partnerschaft als Produkt der Emanzipation | 82 | ||
| 3. Sensibilität für Kommunikatives und Soziales | 83 | ||
| III. Ziele der Emanzipation | 85 | ||
| IV. Die Chance kirchlicher Verkündigung | 86 | ||
| V. Ausblick | 87 | ||
| II. Beruf, Ehe und Familie | 89 | ||
| Renate Hellwig: Die Konflikte von Familie und Beruf als gesellschaftspolitische Herausforderung | 91 | ||
| I. Eine Konfliktlösung als strikte Alternative: „Entweder Beruf oder Familie“ scheidet heutzutage für Frauen aus | 91 | ||
| 1. Einstellungsänderungen bei Frauen | 91 | ||
| 2. Die Ursachen der Einstellungsänderungen bei Frauen | 92 | ||
| II. Neuere Konfliktlösungsmodelle, die sowohl Familie als auch Beruf ermöglichen, bieten sich an | 95 | ||
| 1. Familie als Schwerpunkt für die Frau | 96 | ||
| 2. Beruf als Schwerpunkt für die Frau | 101 | ||
| a) Die Alleinstehenden, Geschiedenen und Verwitweten | 101 | ||
| b) Die Unternehmerin, Professorin, Managerin, Ärztin, Politikerin usw. zwischen Beruf und Familie | 103 | ||
| III. Ausblick | 104 | ||
| Ulrich J. Giebel: Die Stellung der Frau im Erwerbsleben | 107 | ||
| I. Gleichstellung von Mann und Frau | 107 | ||
| II. Schutzvorschriften für Frauen | 109 | ||
| III. Öffentlich-rechtliches Frauenarbeitsschutzrecht | 112 | ||
| IV. Mutterschutz | 114 | ||
| V. Die Kostenwirkung gesetzlicher Schutzregelungen bei Frauen und Müttern für die Unternehmen | 119 | ||
| VI. Auswirkung des Frauenschutzes auf das Beschäftigungsverhalten der Unternehmen | 122 | ||
| VII. Gleichstellung im Erwerbsleben | 129 | ||
| Max Wingen: Entscheidung zum Kind zwischen persönlichen Interessen, familialen Leistungen und Gemeinwohl | 135 | ||
| I. Die demographische Ausgangslage im Übergang zu den achtziger Jahren | 136 | ||
| II. Eine Zwischenbilanz zum besseren Verständnis des veränderten generativen Verhaltens | 138 | ||
| 1. Änderungen des generativen Verhaltens als multikausales Phänomen | 139 | ||
| 2. Geänderte Rahmenbedingungen des generativen Verhaltens | 140 | ||
| 3. Der Wandel normativer Vorstellungen | 140 | ||
| 4. Fortschreitender „Rationalisierungsprozeß“ | 141 | ||
| 5. Neue Leitbilder und Lebensstile | 142 | ||
| 6. Vergrößerung individueller Entscheidungs- und Handlungsfreiräume | 144 | ||
| 7. Konkurrenz individueller und gesellschaftlicher Interessen | 146 | ||
| III. Familienpolitik zwischen individueller und gesellschaftlicher Rationalität | 148 | ||
| IV. Ansatzpunkte einer auch demographisch akzentuierten, generationensolidarischen Familienpolitik | 150 | ||
| 1. Das Erziehungsgeld als Beispiel sozialökonomischer Hilfen der Familienpolitik | 151 | ||
| 2. Sozialpädagogische Handlungsfelder einer bevölkerungsbewußten Familienpolitik | 155 | ||
| V. Ausblick | 158 | ||
| Ursula Lehr: Die Frau in der zweiten Lebenshälfte | 162 | ||
| I. Verengte wissenschaftliche Fragestellungen | 162 | ||
| II. Die undifferenzierte Sicht „der“ Frau | 163 | ||
| III. Älterwerden als Frau – epochale Aspekte | 165 | ||
| 1. Die Erhöhung der Lebenserwartung | 166 | ||
| 2. Die ältere Frau in einer „graying world“ | 166 | ||
| 3. Veränderungen im Lebenszyklus | 168 | ||
| 4. Das veränderte Verhältnis zwischen den Generationen | 173 | ||
| IV. Konsequenzen der aufgezeigten epochalen Veränderungen für das Leben der Frau | 178 | ||
| 1. Die Notwendigkeit einer Korrektur traditioneller Rollenvorstellungen | 178 | ||
| 2. Die Notwendigkeit eines Trainings geistiger und sozialer Fähigkeiten als Geroprophylaxe | 179 | ||
| V. Die Rolle der Frau im Rahmen familiärer intergenerationeller Beziehungen | 181 | ||
| 1. Die Familie – ein dynamischer Prozeß lebenslanger Interaktion aller Familienmitglieder | 181 | ||
| 2. Die Frau im Schnittpunkt unterschiedlicher Rollenanforderungen: zur Problematik der Vereinbarkeit von Mutter-, Großmutter- und Tochterrolle | 184 | ||
| 3. Intergenerationelle familiäre Konfliktsituationen | 186 | ||
| 4. Die Notwendigkeit einer differentiellen Sicht intergenerationeller familiärer Kontakte | 187 | ||
| 5. Quantität familiärer intergenerationeller Interaktion auf Kosten der Qualität | 188 | ||
| 6. Familienzentriertheit der Frau – ein Garant oder eine Gefahr für eine Lebensqualität im Alter? | 190 | ||
| VI. Die Frau in der zweiten Lebenshälfte: Konsequenzen für eine Familien-, Frauen- und Altenpolitik! | 191 | ||
| Literaturhinweise | 194 | ||
| III. Frau, Glaube und Kirche | 199 | ||
| Teresa Bock: Aufgaben und Mitarbeit der Frauen in der Kirche | 201 | ||
| I. Die Diskrepanz zwischen Postulat und Wirklichkeit | 201 | ||
| II. Der Beitrag der Frauenbewegung | 203 | ||
| III. Spezifische Defizite | 205 | ||
| IV. Notwendige Folgerungen | 209 | ||
| Martin Honecker: Frau, Kirche und Gesellschaft. Schwerpunkte des sozialethischen Interesses aus evangelischer Sicht | 213 | ||
| I. Die EKD-Studie „Die Frau in Familie, Kirche und Gesellschaft“ | 213 | ||
| II. Die Stellung der Frau im kirchlichen Dienst | 223 | ||
| III. Zum Problem von Ehe und Familie | 226 | ||
| Hans Rotter: Kirchliche Begründung von Ehe und Familie im Vergleich mit bestehenden Normen | 229 | ||
| I. Normen und sittliches Verhalten, Einführende Überlegungen | 229 | ||
| II. Einstellungen zu Ehe und Familie in der heutigen Gesellschaft | 233 | ||
| III. Einzelne Problemfelder | 235 | ||
| 1. „Ehe auf Probe“ | 235 | ||
| 2. Ehescheidung | 237 | ||
| 3. „Unberührt in die Ehe“ | 237 | ||
| 4. Die Kinderzahl | 240 | ||
| 5. Die Abtreibung | 241 | ||
| Hanspeter Heinz: Auf der Suche nach der Sendung der Frau in unserer Zeit. Grundsätzliche pastoraltheologische Überlegungen | 245 | ||
| I. Gott und die Frau | 249 | ||
| 1. Der soziologische Befund | 250 | ||
| a) Stärkeres Selbstbewußtsein | 250 | ||
| b) Kultivierung des Personseins | 251 | ||
| c) Aktivierung sozialer Aktion und persönlicher Kommunikation | 251 | ||
| d) Suche nach Sinn, Orientierung und Kraft | 252 | ||
| e) Zusammenfassung und Zuspitzung | 253 | ||
| 2. Theologische Reflexion | 254 | ||
| a) Die Grundregel | 254 | ||
| b) Erstes Beispiel | 255 | ||
| c) Zweites Beispiel | 257 | ||
| d) Ein hermeneutisches Modell | 258 | ||
| 3. Pastorale Orientierung | 258 | ||
| a) Mut zum Endgültigen | 259 | ||
| b) Mut zum Vorläufigen | 260 | ||
| c) Erste Konsequenzen für rechte Selbstverwirklichung | 261 | ||
| II. Frau und Kirche | 262 | ||
| 1. Der soziologische Befund | 263 | ||
| a) Teilnahme am Gottesdienst | 264 | ||
| b) Religiöse Kindererziehung | 266 | ||
| c) Bereitschaft zu kirchlichen Diensten | 266 | ||
| d) Diskussion um das Priestertum der Frau | 267 | ||
| 2. Theologische Reflexion | 268 | ||
| a) Glaubhaft ist nur Liebe | 268 | ||
| b) Person ist mehr als Funktion | 270 | ||
| c) Gegenseitiger Dienst von Amt und anderen Charismen | 271 | ||
| d) Sakramentale Mittlerschaft | 272 | ||
| 3. Pastorale Orientierung | 274 | ||
| a) Geduld lernen | 274 | ||
| b) Hören lernen | 275 | ||
| c) Dienen lernen | 275 | ||
| d) Miteinander Maria sein | 277 | ||
| III. Frau und Mann | 277 | ||
| 1. Der empirische Befund | 278 | ||
| a) Religionssoziologische Daten | 278 | ||
| b) Hinweise aus Biologie und Psychologie | 280 | ||
| c) Kulturgeschichtliche Erfahrungen | 282 | ||
| d) Ansätze für ein Leitbild? | 283 | ||
| 2. Theologische Reflexion | 284 | ||
| a) Das Buch der Schöpfung | 284 | ||
| b) Das Buch der Geschichte | 288 | ||
| 3. Pastorale Orientierung | 289 | ||
| a) Aufbau einer „Zivilisation der Liebe“ | 289 | ||
| b) Erziehung zur Einheit | 290 | ||
| Autorinnen- und Autorenverzeichnis | 293 |
