Der Bereicherungswegfall in Parallele zur hypothetischen Schadensentwicklung
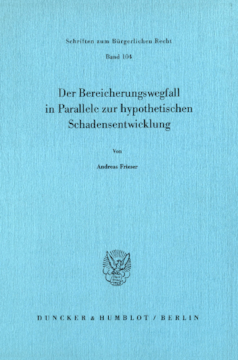
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der Bereicherungswegfall in Parallele zur hypothetischen Schadensentwicklung
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 104
(1987)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| ERSTER TEIL: Die „Bereicherung“ als konstituierendes Element der Kondiktionshaftung, entwickelt aus der Gegenüberstellung von schadens- und bereicherungsrechtlichen Grundsätzen | 15 | ||
| 1. Abschnitt: Einordnung der Frage nach der „Bereicherung“ in die Diskussion über die Grundlagen des Bereicherungsrechts | 15 | ||
| A. § 818 Abs. 3 BGB als zentrale Vorschrift im bereicherungsrechtlichen System? | 15 | ||
| B. § 818 Abs. 3 BGB als kaum erklärliche Privilegierung des Bereicherungsschuldners aus der Sicht des „modernen“ Bereicherungsrechts | 18 | ||
| I. Der Gegensatz zwischen „alter“ und „moderner“ Lehre | 18 | ||
| II. Grundlage der „modernen“ Lehre – Trennung von Eingriffs- und Leistungskondiktion | 20 | ||
| 2. Abschnitt: Funktionaler Zusammenhang zwischen Schadens- und Bereicherungshaftung | 29 | ||
| A. Die Gemeinsamkeiten der beiden Haftungsarten | 29 | ||
| I. Bisherige Darstellung des Zusammenhanges (Beispiel: Vorteils- bzw. Nachteilsausgleichung) | 29 | ||
| II. Die gemeinsame Haftungsstruktur vor dem Hintergrund einer monokausalen Erklärung beider Haftungen | 33 | ||
| 1. Ausgangspunkt beider Haftungen: Reaktion auf Rechtsverletzung | 33 | ||
| 2. Die rechtswidrige Handlung im Schadens- und Bereicherungsrecht | 38 | ||
| B. Der Naturalrestitutionsanspruch im Schadens- und Bereicherungsrecht | 46 | ||
| I. Die gemeinsame Funktion des Anspruchs in beiden Haftungssystemen | 46 | ||
| II. Die Besonderheit der Naturalrestitution im Bereicherungsrecht | 56 | ||
| 1. Die Anordnung der Naturalrestitution im Gesetz | 56 | ||
| 2. Naturalrestitutionsanspruch und vermögensorientierte Lehre | 59 | ||
| III. Naturalrestitutionsanspruch und Haftung auf den objektiven Wert als Beispiele für eine verfehlte praktische Verwirklichung der bisher erkannten Gemeinsamkeiten von Schadens- und Bereicherungshaftung | 67 | ||
| 1. Der objektive Wert der beschädigten Sache als Mindestschaden | 67 | ||
| 2. Der objektive Wert der erlangten Sache als Bemessungsgrundlage der Bereicherungshaftung | 80 | ||
| C. Zusammenfassung | 93 | ||
| ZWEITER TEIL: Gemeinsamkeiten bei der Berechnung von Schaden und Bereicherung | 95 | ||
| 1. Abschnitt: Der schadensrechtliche Interessebegriff | 95 | ||
| A. Einleitung | 95 | ||
| B. Der Interessebegriff in der schadensrechtlichen Diskussion | 97 | ||
| I. Interessebegriff und Differenzrechnung | 97 | ||
| II. Kritik am rechnerischen Interessebegriff | 99 | ||
| III. Interessebegriff und Vergleich zweier Lagen | 100 | ||
| 1. Differenz und Differenzrechnung | 100 | ||
| 2. Die vergleichende Betrachtungsweise im Schadensbegriff der herrschenden Meinung | 105 | ||
| IV. Interessebegriff und subjektive Orientierung des Schadensersatzes | 107 | ||
| 1. Herleitung der subjektiven Orientierung aus dem Wesen des Interessebegriffs – Auseinandersetzung mit Mertens | 107 | ||
| 2. Subjektive Orientierung und Zustandsvergleich in den Fällen der entgangenen Nutzung | 115 | ||
| V. Interessebegriff und Berücksichtigung hypothetischer Umstände | 124 | ||
| 1. Der entgangene Gewinn | 125 | ||
| 2. Der hypothetische Kausalverlauf | 140 | ||
| VI. Zusammenfassung | 154 | ||
| 2. Abschnitt: Der bereicherungsrechtliche Interessebegriff | 158 | ||
| A. Einleitung | 158 | ||
| B. Die Sicht der Gesetzesverfasser | 158 | ||
| C. Die einzelnen Komponenten des bereicherungsrechtlichen Interessebegriffs | 163 | ||
| I. Darstellung der Prinzipien anhand der Diskussion um die Saldotheorie | 163 | ||
| 1. Ausgangslage: Gesamtbetrachtung oder Analyse des Schuldnervermögens? | 163 | ||
| 2. Entwicklung der Saldotheorie | 164 | ||
| 3. Die aus der Kritik an der Saldotheorie entwickelten Lösungsvorschläge der Literatur | 169 | ||
| 4. Entwicklung einer „Bereicherungs“haftung mit Hilfe des bereicherungsrechtlichen Interessebegriffs | 182 | ||
| 5. Der Ersparnisgedanke im Bereicherungsrecht | 191 | ||
| 6. Praktische Bedeutung des Hypothesegedankens | 195 | ||
| II. Zusammenfassung | 201 | ||
| DRITTER TEIL: Die parallele Bestimmung des Haftungsumfanges im Schadens- und Bereicherungsrecht, dargestellt an den Fällen BGHZ 53, 144 und 57, 137 | 205 | ||
| 1. Abschnitt: Einführung | 205 | ||
| A. Die zugrundeliegenden Sachverhalte | 205 | ||
| B. Grundsätzliche Überlegungen zu den beiden Fällen | 206 | ||
| 2. Abschnitt: Die schadensrechtliche Lösung | 208 | ||
| A. Die Tendenz zu einem einheitlichen Rückabwicklungssystem – Kritik | 208 | ||
| B. Die schadensrechtlichen Entscheidungsgründe in BGHZ 57, 137 im einzelnen | 210 | ||
| C. Kritik dieses Entscheidungsabschnitts | 212 | ||
| I. Zur Adäquanztheorie | 212 | ||
| II. Zur Schutzzwecktheorie: Grundlage und Kritik dieses Ansatzes | 213 | ||
| D. Der Hypothesegedanke als Anknüpfungspunkt der Schadensbeschränkung | 219 | ||
| I. Allgemeine Überlegungen in den Rezensionen | 219 | ||
| II. Der Hypothesegedanke und die Frage des nichtigen Vertrages | 221 | ||
| III. Der Hypothesegedanke in den Rezensionen | 229 | ||
| E. Sachfremde Erwägungen der BGH-Lösung – Kritik | 234 | ||
| I. Der Strafgedanke | 234 | ||
| II. Die vom BGH herangezogene Anspruchsgrundlage | 237 | ||
| III. Die Argumentation mit § 254 BGB | 238 | ||
| F. Zusammenfassung | 239 | ||
| 3. Abschnitt: Die bereicherungsrechtliche Lösung | 241 | ||
| A. Kritische Betrachtung der Argumentation des BGH unter Berücksichtigung der Literaturmeinungen | 241 | ||
| I. Überwindung der Saldotheorie | 241 | ||
| 1. Argumentation mit der fehlenden Schutzwürdigkeit des Betrügers | 241 | ||
| 2. Begründung aus § 819 BGB | 245 | ||
| II. Anwendung des Gedankens aus § 254 BGB | 248 | ||
| B. Eigene Lösung | 252 | ||
| I. Die Frage nach der Bereicherung | 252 | ||
| II. Der Hypothesegedanke und die aktuell vorhandene Vermögensmehrung | 254 | ||
| III. Der Ersparnisgedanke in den Täuschungsfällen | 255 | ||
| C. Verhältnis der gefundenen Lösung zum gesetzlichen Rücktrittsrecht | 257 | ||
| D. Zusammenfassung | 261 | ||
| Literaturverzeichnis | 263 |
