Abstimmungs- und Auswahlprobleme im Bildungs- und Beschäftigungssystem
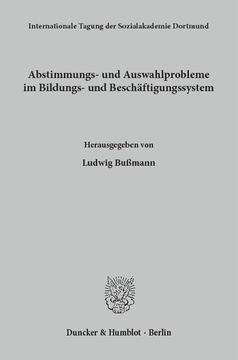
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Abstimmungs- und Auswahlprobleme im Bildungs- und Beschäftigungssystem
Editors: Bußmann, Ludwig
Internationale Tagungen der Sozialakademie Dortmund, Vol. 15
(1982)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Reimut Jochimsen: Begrüßungsrede | 9 | ||
| Björn Engholm: Begrüßungsrede | 13 | ||
| Siegfried Bleicher: Begrüßungsrede | 21 | ||
| Einführung | 29 | ||
| Ludwig Bußmann: Die Bedeutung von Auswahl und Abstimmung für die Bildungs- und Beschäftigungspolitik | 29 | ||
| A. Vorbemerkungen | 29 | ||
| B. Zu den Begriffen „Auswahl" und „Abstimmung" | 30 | ||
| I. Auswahl | 31 | ||
| II. Abstimmung | 32 | ||
| C. Auswahlprobleme im Bildungs- und Beschäftigungssystem | 33 | ||
| I. Ziele der Auswahl | 34 | ||
| II. Kriterien der Auswahl | 34 | ||
| III. Instrumente der Auswahl | 36 | ||
| D. Abstimmungsprobleme im Bildungs- und Beschäftigungssystem | 37 | ||
| I. Theoriedefizite | 37 | ||
| II. Entkopplung oder Abstimmung? | 38 | ||
| Literatur | 39 | ||
| Jutta Kaminsky, Klaus Schendel und Walter Scheuerle: Abstimmungsprobleme im Bildungs- und Beschäftigungssystem der Bundesrepublik Deutschland | 41 | ||
| A. Problemaufriß | 41 | ||
| B. Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Bildungs- und Beschäftigungssystem | 43 | ||
| I. Private und öffentliche Interessen in der Bildungs- und Beschäftigungspolitik | 43 | ||
| 1. Unternehmerinteressen | 43 | ||
| 2. Arbeitnehmerinteressen | 45 | ||
| 3. Staatliche Bildungs- und Beschäftigungspolitik | 46 | ||
| II. Wandel der Qualifikationsanforderungen | 48 | ||
| 1. Qualifikationsentwicklung | 48 | ||
| 2. Thesen zur Qualifikationsentwicklung | 49 | ||
| 3. Kritische Bemerkungen zu den dargestellten Thesen zur Qualifikationsentwicklung | 50 | ||
| 4. Schlußfolgerungen zu den Qualifikationsthesen | 52 | ||
| III. Bildungspolitische Ansatzpunkte | 54 | ||
| 1. Bildungsplanung und Prognoseverfahren | 54 | ||
| 2. Schlußfolgerungen zur Bildungsplanung und den Prognoseverfahren | 57 | ||
| C. Beziehungen zwischen Qualifikation und Arbeitsmarkt | 57 | ||
| I. Zweimal vier Problembereiche | 58 | ||
| 1. Übergänge zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem | 58 | ||
| 2. Qualifikationen, die nicht festlegen | 62 | ||
| 3. Globale, vertikale, horizontale, qualitative Abstimmung | 64 | ||
| 4. Kurz- und langfristige Betrachtung | 65 | ||
| 5. Das Berechtigungswesen | 65 | ||
| 6. Der mehrdeutige Entkoppelungsbegriff | 66 | ||
| 7. Gegenwärtige und künftige Versorgungslage | 66 | ||
| 8. Kurze Anmerkungen zum vorangegangenen Abschnitt | 66 | ||
| II. Thesen zur Lage in den vier Problembereichen | 68 | ||
| 1. Schulabgänger und Ausbildungsplätze (Problemfeld G I) | 68 | ||
| 2. Vertikale Einzelbilanzen für Schulabgänger und Ausbildungsplätze (Problemfeld VI) | 69 | ||
| 3. Horizontale Einzelbilanzen für Schulabgänger und Ausbildungsplätze (Problemfeld HI) | 71 | ||
| 4. Qualitative Verzahnung zwischen Allgemeinbildung und Ausbildungswesen (Problemfeld QI) | 72 | ||
| 5. Globale Verhältnisse zwischen Ausbildungsabsolventen und freien Arbeitsplätzen (Problemfeld GII) | 73 | ||
| 6. Die vertikale Qualifikationsstruktur der Ausbildungsabsolventen und der Arbeitsplätze (Problemfeld V II) | 75 | ||
| 7. Die Fachrichtungsstruktur der Absolventen und der Arbeitsplätze (Problemfeld H II) | 77 | ||
| 8. Die vom Ausbildungssystem vermittelten Qualifikationen und die Arbeitsplatzanforderung (Problemfeld Q II) | 79 | ||
| III. Zusammenfassende Betrachtung | 81 | ||
| D. Schlußfolgerungen zur Abstimmung zwischen dem Bildungs- und Beschäftigungssystem aus der Sicht der Arbeitnehmer | 81 | ||
| I. Probleme im Bildungs- und Beschäftigungssystem | 81 | ||
| 1. im Bildungssystem | 81 | ||
| 2. im Beruflichen Ausbildungssystem | 82 | ||
| 3. im Beschäftigungssystem | 82 | ||
| II. Schlußfolgerungen für das Bildungssystem | 82 | ||
| III. Schlußfolgerungen für die berufliche Ausbildung | 84 | ||
| IV. Schlußfolgerungen für das Beschäftigungssystem | 86 | ||
| Erster Hauptteil: Grundsatzfragen der Auswahl und der Abstimmung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem | 89 | ||
| Reinhard Wohlleben: Grundsatzprobleme der Koordination und Selektion im Bildungs- und Beschäftigungssyetem | 91 | ||
| A. Vorüberlegungen | 91 | ||
| B. Globale Aspekte | 91 | ||
| I. Phase 1: Übergang von der „allgemeinbildenden Schule" in die Berufsausbildung bzw. in die Erwerbstätigkeit | 93 | ||
| II. Phase 2: Übergang von der Berufsausbildung in die Erwerbstätigkeit | 94 | ||
| III. Phase 3: Stabilisierung im Besdiäftigungssystem | 95 | ||
| C. Zusammenfassung und Schlußbetrachtung | 96 | ||
| Maria Weber: Die Rolle der Gewerkschaften bei der Gestaltung des Bildungs- und Beschäftigungssytems der Bundesrepublik Deutschland | 97 | ||
| A. Themenabgrenzung | 97 | ||
| B. Recht auf Arbeit und Recht auf Bildung | 97 | ||
| I. Für uns geht es dabei um entscheidende Rechte für Arbeitnehmer — um das Recht auf Arbeit und das Redit auf Bildung | 97 | ||
| II. Was gehört nun zum Recht auf Bildung unter dem besonderen Aspekt der Zugangsmöglichkeiten zum Beruf? | 98 | ||
| III. Bildung als Prinzip der Berufsfindung | 99 | ||
| C. Gewerkschaftliche Forderungen zur Bildungsreform | 99 | ||
| D. Zu den Bedingungen des Beschäftigungssystems | 106 | ||
| Hans G. Rolff: Selektions- und Allokationeprozesse im expandierenden Bildungesystem | 111 | ||
| A. Abgehängte und konkurrenzerzeugende Allokation | 111 | ||
| I. Bildungsabschlüsse und Statuszuweisung | 112 | ||
| II. Die Statusinteressen der Neuen Mittelklasse | 114 | ||
| B. Aufgeschobene und verschärfte Selektion | 117 | ||
| I. Entmonopolisierung des Gymnasiums | 117 | ||
| II. Gedrosselte Öffnung der Bildungsgänge | 120 | ||
| C. Sozialisatorische Folgen: Gestückelte Meritokratisierung | 123 | ||
| D. Wem hat die Bildungsexpansion genützt? | 128 | ||
| I. Sozialstatistisches Fazit | 128 | ||
| II. Gesellschaftliches Fazit | 131 | ||
| Literatur | 134 | ||
| Günter Bechtle: Selektions- und Allokationsprozesse im Beschäftigungssystem | 137 | ||
| A. Ein theoretisches Ausgangspostulat | 137 | ||
| B. Die Bedeutung von Qualifizierungsprozessen für die Selektion und Allokation von Arbeitskraft | 138 | ||
| I. Zum Phänomen betriebsspezifischer Qualifizierung | 139 | ||
| II. Aktuelle Ergebnisse aus der empirischen Sozialforschung zum Zusammenhang von Qualifizierung, betrieblicher Rationalisierung und Allokationsprozessen | 143 | ||
| III. Der „Fall Italien" und die besondere Bedeutung der gewerkschaftlichen Politik für die Selektion und Allokation von Arbeitskräften | 147 | ||
| C. Abschließende Bemerkung | 155 | ||
| Zweiter Hauptteil: Internationale Erfahrungen mit Auswahl und Abstimmung in unterschiedlichen Bildungs- und Beschäftigungssystemen | 157 | ||
| Georges Dupont und Burkart Sellin: Abstimmungsprobleme in einigen Bildungs- und Beschäftigungssystemen Westeuropas | 159 | ||
| A. Einführung | 159 | ||
| Β. Königreich Belgien | 160 | ||
| I. Bildungssystem | 160 | ||
| II. Beschäftigungssystem | 160 | ||
| III. Koordinierung | 160 | ||
| C. Dänemark | 161 | ||
| I. Bildungssystem | 161 | ||
| II. Beschäftigungssystem | 161 | ||
| III. Koordinierung | 162 | ||
| D. Bundesrepublik Deutschland | 162 | ||
| I. Bildungssystem | 162 | ||
| II. Beschäftigungssystem | 163 | ||
| III. Koordinierung | 163 | ||
| E. Frankreich | 165 | ||
| I. Bildungssystem | 165 | ||
| II. Beschäftigungssystem | 165 | ||
| III. Koordinierung | 165 | ||
| F. Republik Irland | 166 | ||
| I. Bildungssystem | 166 | ||
| II. Beschäftigungssystem | 167 | ||
| III. Koordinierung | 167 | ||
| G. Italien | 168 | ||
| I. Bildungssystem | 168 | ||
| II. Beschäftigungssystem | 168 | ||
| III. Koordinierung | 169 | ||
| H. Niederlande | 170 | ||
| I. Bildungssystem | 170 | ||
| II. Beschäftigungssystem | 170 | ||
| III. Koordinierung | 171 | ||
| I. Vereinigtes Königreich | 172 | ||
| I. Bildungssystem | 172 | ||
| II. Beschäftigungssystem | 172 | ||
| III. Koordinierung | 172 | ||
| J. Zusammenfassung | 173 | ||
| I. Bildungssystem | 173 | ||
| II. Beschäftigungssystem | 173 | ||
| III. Koordinationsprobleme | 174 | ||
| Literatur | 176 | ||
| Boris P. Wladimirow: Koordination und Auswahl im Bildungs- und Beschäftigungssystem der UdSSR | 177 | ||
| A. Wechselbeziehungen zwischen Beschäftigungs- und Bildungsbereich | 177 | ||
| Β. Grundprinzipien des sowjetischen Bildungssystems | 186 | ||
| I. Elemente des Bildungswesens | 186 | ||
| II. Bildungsinhalte | 189 | ||
| III. Koordination | 190 | ||
| C. Die berufliche Selbstbestimmung | 196 | ||
| Lew W. Wosnjessenski: Berufsausbildung und Lösung der Beschäftigungsprobleme in der UdSSR | 203 | ||
| A. Stellung und Rolle von Arbeit und Bildungswesen | 203 | ||
| B. Programm zur Volksbildung und Berufsausbildung | 207 | ||
| C. Das System der Volksbildung | 212 | ||
| D. Die Rolle der Gewerkschaften im Ausbildungs- und Beschäftigungssystem der UdSSR | 217 | ||
| E. Instrumente der Arbeitskräfteplanung | 222 | ||
| F. Perspektiven | 225 | ||
| Fritz Macher: Koordination und Selektion im Bildungs- und Beschäftigungssyetem der Deutschen Demokratischen Republik | 227 | ||
| A. Grundlagen des Bildungs- und Beschäftigungs-Systems der Deutschen Demokratischen Republik | 227 | ||
| B. Das einheitliche sozialistische Bildungssystem in der Deutschen Demokratischen Republik | 230 | ||
| I. Grundsätzliche gesetzliche Regelungen | 230 | ||
| II. Aufbauetappen | 231 | ||
| III. Bestandteile des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems | 233 | ||
| IV. Die Hauptaufgaben der einzelnen Bestandteile des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems | 234 | ||
| V. Der dialektische Zusammenhang zwischen Arbeitsmittelmetamorphose und Persönlichkeitsentwicklung | 242 | ||
| C. Möglichkeiten der Gestaltung von Arbeitstätigkeiten | 246 | ||
| I. Vorgehensweisen | 246 | ||
| II. Eingriffsmöglichkeiten | 247 | ||
| III. Ansatzstellen für die Gestaltung von Arbeitstätigkeiten im Prozeß der technisch-konstruktiven Fertigungsvorbereitung | 247 | ||
| Antoni Rajkiewicz: Koordination und Selektion im Bildungs- und Beschäftigungssystem der Volksrepublik Polen | 251 | ||
| A. Einführung | 251 | ||
| B. Grundzüge des Bildungssystems der Volksrepublik Polen | 253 | ||
| I. Das Redit auf Bildung und die Bildungsplanung | 253 | ||
| II. Das Recht auf Arbeit, die Planung und Koordination der Beschäftigung | 257 | ||
| III. Probleme und Selektion | 261 | ||
| C. Schlußfolgerungen | 264 | ||
| Baruch Haklai: Koordination und Selektion im Bildungs- und Beschäftigungssystem Israels | 267 | ||
| A. Konflikte und Unterschiede zwischen Beschäftigung und Ausbildung | 267 | ||
| B. Trennung von Bildungs- und Beschäftigungssystem | 268 | ||
| C. Schlußbemerkung | 272 | ||
| Anhang | 272 | ||
| A. Einleitung | 272 | ||
| Β. Integrierung der Erziehungssysteme und der Berufsvorbereitung in Israel | 276 | ||
| I. Entwicklung der technologischen Erziehung und ihre Erweiterung | 277 | ||
| 1. Geschichtlicher Rückblick | 277 | ||
| 2. Das Ziel der technologischen Erziehung | 279 | ||
| 3. Wege der Berufserziehung | 280 | ||
| 4. Die Ausbildung von Technikern und Werkstattingenieuren | 282 | ||
| II. Das Lehrlingswesen | 286 | ||
| 1. Das Lehrlingsgesetz von 1953 | 286 | ||
| 2. Die Lehrlingsschulen | 287 | ||
| 3. Unterrichtsbetonte Lehrlingsausbildung | 287 | ||
| 4. Besondere Regelungen | 292 | ||
| III. Randbemerkungen zur obigen Übersicht | 295 | ||
| 1. Vorbereitung für das Arbeitsleben | 295 | ||
| 2. Anlernen und Ausbildung in der Arbeit | 296 | ||
| 3. Die Aufgabe der Betriebe als Orte der Berufsbildung | 296 | ||
| 4. Das Lehrlingswesen | 296 | ||
| 5. Qualität der Fachausbildung | 297 | ||
| 6. Diskrepanz zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung | 297 | ||
| 7. Überbrückung der Unterschiede zwischen Berufserziehung und -ausbildung | 297 | ||
| 8. „Permanentes Lernen" | 298 | ||
| C. Zusammenfassung | 300 | ||
| I. Der wirtschaftliche Wert der Bildung | 300 | ||
| II. Der Wert der Erziehung | 301 | ||
| III. Schlußwort | 302 | ||
| Gösta Rehn: Koordination und Selektion im Bildungs- und Beschäftigungssystem Schwedens | 305 | ||
| I. Allgemeine Übersicht | 305 | ||
| 1. Einleitung | 305 | ||
| 2. Nachkriegsentwicklung des Schulwesens | 307 | ||
| 3. Die Erwachsenenbildung und ihre Organisationen | 309 | ||
| a) Arbeitsmarktausbildung | 309 | ||
| b) Kommunale Erwachsenenschulen | 310 | ||
| c) Volkshochschulen | 310 | ||
| d) Fernunterricht in verschiedenen Formen | 311 | ||
| e) Die Bildungsorganisationen | 311 | ||
| 4. Allgemeine Bemerkungen über Koordinations- und Selektionsprinzipien | 312 | ||
| 5. Aufgaben der Schulreformen | 314 | ||
| II. Die Grundschule | 315 | ||
| 1. Einführung und Entwicklung | 315 | ||
| 2. Aktuelle Reformarbeit in der Grundschule | 318 | ||
| 3. Die Frage der Zeugnisse | 320 | ||
| III. Die Gymnasialschule | 321 | ||
| 1. Reformentwicklung | 321 | ||
| 2. Organisation der Gymnasialschule | 322 | ||
| 3. Koordination und Selektion bei den Gymnasialschulen | 324 | ||
| IV. Die höhere Ausbildung | 326 | ||
| 1. Eine reformierte Hochschule | 326 | ||
| 2. Die Organisation des Studiums | 328 | ||
| 3. Berechtigung und Auswahl | 329 | ||
| 4. Finanzierung und Koordination | 330 | ||
| 5. Administration der Hochschule | 332 | ||
| 6. Kommentar | 333 | ||
| V. Die Arbeitsmarktpolitik | 334 | ||
| 1. Allgemeines | 334 | ||
| 2. Koordination und Planung | 336 | ||
| 3. Die tägliche Selektionsproblematik | 337 | ||
| VI. Studien- und Berufsorientierung | 338 | ||
| 1. Arbeitslebenskenntnis als Expertenaufgabe und Studienfach | 338 | ||
| 2. Praktische Arbeitskunde | 340 | ||
| 3. Aufgabenkoordination auf der lokalen Ebene | 341 | ||
| VII. Kurzes Schlußwort | 342 | ||
| Dritter Hauptteil: Die Gestaltung der Auswahlprozesse und ihrer Mechanismen im Unternehmen | 343 | ||
| Hans Rehhahn: Selektionsprozesse im Unternehmen | 345 | ||
| A. Einleitung | 345 | ||
| Β. Öffentliches Bildungssystem und Unternehmen | 346 | ||
| 1. Die Lebensfremdheit der Lehrer und die Verkrüppelung der nicht-intellektuellen Fähigkeiten | 346 | ||
| 2. Die Scheuklappenperspektive der „Berufsbildung" | 349 | ||
| 3. Selektionsprozesse im Unternehmen | 352 | ||
| a) Die berufliche und gesundheitliche Eignung | 353 | ||
| b) Die Bewährungsprognose | 354 | ||
| c) Das Arbeitsengagement | 356 | ||
| d) Die Mitbestimmung des Betriebsrates | 358 | ||
| e) Mißbrauchsvorsorge | 358 | ||
| C. Schluß | 359 | ||
| Günter Geisler: Personalpolitik im Spannungefeld von Berufsbildungsund Qualifikationsplanung im Unternehmen | 361 | ||
| A. Einleitung | 361 | ||
| B. Personalpolitische Problemlagen | 361 | ||
| C. Schluß | 376 | ||
| I. Thesen und Empfehlungen | 376 | ||
| II. Drohender Verlust der Personalhoheit | 379 | ||
| Literatur | 380 |
