Grundrechtsschutz, technischer Wandel und Generationenverantwortung
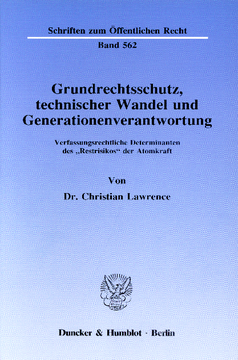
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Grundrechtsschutz, technischer Wandel und Generationenverantwortung
Verfassungsrechtliche Determinanten des »Restrisikos« der Atomkraft
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 562
(1989)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 14 | ||
| 1. Kapitel: Themenbeschreibung und Methode | 19 | ||
| 1. Teil: Themenbeschreibung unter Berücksichtigung kernenergiespezifischer Besonderheiten | 19 | ||
| A. Der Untersuchungsgegenstand | 20 | ||
| I. Grundrechtliche Einordnung „sozialadäquater Restrisiken" im Atomrecht | 20 | ||
| II. Normative Steuerung der quantitativen Risikozunahme | 21 | ||
| ΙII. Rechtliche Bewertung des durch die Entsorgung aufgeworfenen Generationenproblems | 22 | ||
| B. Tatsächliche und rechtliche Besonderheiten der Energieerzeugung durch Atomkraft | 23 | ||
| C. Konsequenzen der atomtechnischen Besonderheiten für den Gang der Untersuchung | 25 | ||
| 2. Teil: Methode der Untersuchung | 28 | ||
| A. Die Bedeutung des Vorverständnisses und der Methodenwahl für die Betrachtung atomarer Risiken | 28 | ||
| B. Aussagekraft der vertretenen methodischen Ansätze für die Risikoproblematik | 30 | ||
| C. Eigener methodischer Ansatz | 34 | ||
| 2. Kapitel: Grundrechtsdogmatische Einordnung der „sozialadäquaten Risiken" | 37 | ||
| 1. Teil: Ansätze der Risikodefinition und verfassungsrechtliche Einordnung der „sozialadäquaten Risiken" durch Literatur und Rechtsprechung | 37 | ||
| A. Gegenstand der „sozialadäquaten Risiken" | 37 | ||
| I. Einleitung | 37 | ||
| II. Konzeption des atomrechtlichen Instrumentariums als Reaktion auf die Besonderheiten des Regelungsgegenstandes | 38 | ||
| 1. Zweck des Atomgesetzes | 38 | ||
| 2. Der Verweis auf den „Stand von Wissenschaft und Technik" im Sinne von § 7 II Nr. 3 AtomG und daraus resultierender „dynamischer Grundrechtsschutz" | 40 | ||
| a) „Stand von Wissenschaft und Technik" im Sinne von § 7 II Nr. 3 AtomG | 40 | ||
| b) „Dynamischer Grundrechtsschutz" | 42 | ||
| aa) Inhalt dieses Postulats | 42 | ||
| bb) Kritik am postulierten „dynamischen Grundrechtsschutz" | 46 | ||
| cc) Stellungnahme | 47 | ||
| ΙII. Die gesetzliche Erfassung nuklearspezifischer Gefahren und Risiken | 49 | ||
| 1. Herkömmlicher Gefahren-und Risikobegriff | 49 | ||
| 2. Notwendigkeit einer Verfeinerung des Gefahrenbegriffs | 50 | ||
| 3. Kategorien der Gefahrenabwehr, der Risikovorsorge und des Restrisikos | 52 | ||
| a) Definitionen | 52 | ||
| b) Methoden der Einteilung aller denkbaren Risiken in die Kategorien Gefahrenabwehr, Risikovorsorge und Restrisiko | 55 | ||
| aa) Postulat „absoluter Sicherheit" durch das VG Freiburg | 55 | ||
| bb) Probabilistische Risikowertungen aufgrund naturwissenschaftlicher Risikoberechnung | 56 | ||
| (1) Inhalt | 56 | ||
| (2) Aussagekraft | 57 | ||
| cc) Deterministische Risikoabschichtung | 59 | ||
| (1) Maßstab „praktischer Vernunft" | 59 | ||
| (aa) Inhalt, Ursprung | 59 | ||
| (bb) Unterschiedliche Anwendung des „Maßstabs praktischer Vernunft" durch das Bundesverfassungsgericht und Breuer | 61 | ||
| (cc) Kritik am „Maßstab praktischer Vernunft"; Stellungnahme | 62 | ||
| (2) Trennung „erkannter" und „nicht erkannter" Risiken | 64 | ||
| (aa) Inhalt | 64 | ||
| (bb) Kritik | 67 | ||
| c) Konkrete Umsetzung der Einteilung Gefahrenabwehr, Risikovorsorge und Restrisiko im Genehmigungsverfahren | 68 | ||
| B. Staatsverantwortung für Kernenergierisiken und dogmatische Einordnung der „sozialadäquaten Restrisiken" in Rechtsprechung und Literatur | 72 | ||
| I. Begründung und Umfang der staatlichen Verantwortung für kerntechnische Risiken aus Art. 2 II S. 1 GG | 73 | ||
| 1. Konkurrenz zur Annahme grundrechtlicher Schutzpflichten | 73 | ||
| 2. Ableitung einer unmittelbaren Staatsverantwortung aufgrund der Genehmigung atomarer Anlagen | 74 | ||
| 3. Grundsätzliche Vorwürfe gegen die Kerntechnik allgemein | 77 | ||
| II. Aussagen des Bundesverfassungsgerichts und der Literatur zur Einordnung von Restrisiken | 78 | ||
| 1. Stellungnahme des Bundesverfassungsgerichts | 78 | ||
| 2. Stellungnahmen der Literatur und sonstiger Rechtsprechung | 79 | ||
| a) Situationsbedingtheit des Grundrechtsschutzes, Abhängigkeit von technologischer Rahmensetzung | 80 | ||
| b) Die Steuerungsfunktion der politisch-planerischen Ebene | 81 | ||
| c) Kritische Stimmen zur grundrechtlichen Situationsprägung und „Vorbestimmung" durch „sozialadäquate Risiken" | 82 | ||
| 2. Teil: Eigene Analyse der „sozialadäquaten Risiken" | 85 | ||
| A. Unterschiede in den Begründungen der „sozialadäquaten Risiken" durch das Bundesverfassungsgericht und Degenhart | 85 | ||
| B. Einordnung und Qualifizierung der „sozialadäquaten Risiken" | 86 | ||
| I. Theoretische Möglichkeiten der grundrechtsdogmatischen Einordnung von Restrisiken | 87 | ||
| II. Analyse der theoretischen Möglichkeiten | 90 | ||
| 1. Restrisiken als Ausdruck einer Ausgestaltung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit | 90 | ||
| a) Überwiegende Auffassungen zur Grundrechtsausgestaltung | 90 | ||
| aa) Inhalt dieser Konstruktion | 90 | ||
| bb) Kritik, Anwendbarkeit auf die Risikoproblematik | 92 | ||
| (1) Spannungsfeld zu Art. 1 III GG, Gefahren der Eigendynamik | 92 | ||
| (2) Problem der Anwendbarkeit einer Ausgestaltungskompetenz auf Art. 2 II S. 1 GG | 93 | ||
| b) Institutionelle Grundrechtstheorie Häberles | 94 | ||
| aa) Inhalt | 94 | ||
| bb) Kritik, Stellungnahme | 95 | ||
| 2. Restrisiken als Ausdruck einer „immanenten" Grundrechtsschranke | 97 | ||
| a) Terminologie | 97 | ||
| b) Dualismus von Tatbestands-und Schrankenlösung | 98 | ||
| aa) Außentheorie | 98 | ||
| bb) Innentheorie | 99 | ||
| cc) Resultierender Dualismus von enger Tatbestandstheorie und weiter Tatbestandstheorie | 100 | ||
| c) Relevanz des Immanenzgedankens im Atomrecht | 101 | ||
| d) Verschiedene Modelle immanenter Grundrechtsbegrenzungen | 103 | ||
| aa) F. Müllers Theorie der „sachspezifischen Modalität" | 103 | ||
| (1) Inhalt | 103 | ||
| (2) Kritik, Anwendbarkeit auf die Risikoproblematik | 105 | ||
| bb) Enge Tatbestandstheorien durch Ausgrenzung des Inhalts „allgemeiner Gesetze" | 107 | ||
| (1) Inhalt, Bedeutung | 107 | ||
| (2) Kritik an einer Restrisikoerklärung durch den Vorbehalt der „allgemeinen Gesetze" | 109 | ||
| cc) Legitimation der Restrisiken über die „Gemeinschaftsklausel" des Bundesverwaltungsgerichts | 113 | ||
| dd) Unmittelbare und mittelbare Anwendung der Schrankentrias aus Art. 2 I GG auf die nachfolgenden Grundrechte zur Legitimation von Restrisiken | 113 | ||
| ee) „Eigentliche" Immanenzlehre des Bundesverfassungsgerichts als Rechtfertigung „sozialadäquater Restrisiken" im Atomrecht | 115 | ||
| (1) Einordnung | 115 | ||
| (2) Anwendbarkeit der „immanenten Schranken im eigentlichen Sinne" auf Grundrechte, die unter einem speziellen Einschränkungsvorbehalt stehen | 115 | ||
| (3) Inhalt der Immanenzlehre des Bundesverfassungsgerichts | 117 | ||
| (4) Kritik, Stellungnahme | 119 | ||
| (5) Anwendung der Immanenzlehre des Bundesverfassungsgerichts auf die Nutzung der Atomkraft | 120 | ||
| (aa) Grundrechte der Betreiber atomarer Anlagen | 121 | ||
| (bb) Art. 74 Nr. 11 a GG als Verfassungsauftrag zur friedlichen Nutzung der Kernenergie; EURATOM »Vertrag | 122 | ||
| (cc) Verfassungsrechtliches Wachstumsgebot (§ 1 S. 2 StabilitätsG) | 123 | ||
| (dd) Art. 74 Nr. 11 a GG als risikolegitimierende Kompetenznorm | 124 | ||
| aaa) Vertretene Auffassungen in Rechtsprechung und Literatur | 125 | ||
| bbb) Kriterien zur Bewertung des materiellrechtlichen Gehaltes von Art. 74 Nr. 11 a GG in bezug auf das Restrisiko der Atomkraft | 127 | ||
| ccc) Umsetzung der Kriterien auf das Verhältnis von Art. 74 Nr. 11 a GG zu Art. 2 II S. 1 GG | 129 | ||
| C. Zusammenfassung | 131 | ||
| 3. Kapitel: Normative Steuerung und Entwicklung der „sozialadäquaten Risiken" | 134 | ||
| 1. Teil: Notwendigkeit einer Steuerung, Regelungsdefizite | 134 | ||
| A. Problemansatz | 134 | ||
| B. Notwendigkeit einer Risikogesamtbetrachtung und Risikosteuerung | 135 | ||
| C. Analyse der Steuerungsfähigkeit bisherigen Rechts | 139 | ||
| I. Gesetzliche Steuerimgsinstrumente | 139 | ||
| II. Verfassungsrechtliche Aussagen zur Risikosteuerung | 141 | ||
| 1. Aussagen des Bundesverfassungsgerichts | 141 | ||
| a) Verhältnismäßigkeit, Güterabwägung, Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers | 141 | ||
| b) „Dynamischer Grundrechtsschutz" des Bundesverfassungsgerichts | 143 | ||
| 2. Aussagen in der Literatur | 144 | ||
| a) Inhalt | 144 | ||
| b) Rückführung dieser Auffassungen auf funktionell-grundrechtliche Aspekte | 144 | ||
| c) Kritik an den funktionell-rechtlichen Bezügen dieser Auffassungen | 147 | ||
| D. Zwischenergebnis | 149 | ||
| 2. Teil: Steuerungsansätze | 151 | ||
| A. Unmöglichkeit einer gesetzlichen Festlegung des Restrisikos | 151 | ||
| B. Steuerung der Restrisiken durch „geordneten" Verfassungswandel | 153 | ||
| I. Verfassungsrechtlicher Ansatzpunkt | 153 | ||
| 1. Gnindrechtskonkretisierung und Verfassungs wandel | 154 | ||
| 2. Grundlagen des Verfassungswandels | 155 | ||
| a) Positivistische Betrachtung des Verfassungswandels | 155 | ||
| b) Moderne Auffassungen, Stellungnahme | 157 | ||
| II. Steuerungsfähigkeit dieses Prozesses (Grenzen des Verfassungswandels durch die atomare Nutzung) | 161 | ||
| 1. Ansatzpunkte | 161 | ||
| 2. Grenzen des Verfassungswandels | 162 | ||
| a) Materielle Grenzen | 162 | ||
| aa) Wortlaut der Verfassungsnorm | 162 | ||
| bb) Ausdrückliche Entscheidungen des Verfassungsgebers/Identität der Verfassung | 164 | ||
| cc) Normative Leitfunktion der Verfassung als Steuerungsminimum | 165 | ||
| b) Formelle Grenzen | 166 | ||
| aa) „Typus"-orientierte, prinzipiell rückschauende Entwicklung | 166 | ||
| bb) Kontinuität der Verfassungsentwicklung als Verfahrensvorgabe | 168 | ||
| 3. Konsequenzen für die Restrisikoentwicklung | 169 | ||
| C. Ergebnis | 172 | ||
| 4. Kapitel: Verfassungsrechtliche Aspekte der Zukunftswirkung nuklearer Technik, insbesondere der nuklearen Entsorgung | 174 | ||
| 1. Teil: Problemstellung, vertretene Auffassungen | 174 | ||
| A. Problemstellung | 174 | ||
| 1. Technische Vorgaben der Endlagerung | 174 | ||
| 2. Konsequenzen und Fragestellungen | 175 | ||
| B. Die vertretenen Auffassungen und Ansatzpunkte im Überblick | 177 | ||
| 2. Teil: Eigene Untersuchung | 179 | ||
| A. Relativität der Fragestellung | 179 | ||
| B. Methodische Vorfragen | 181 | ||
| C. Denkbare Anknüpfungspunkte | 182 | ||
| 1. Vorüberlegungen | 182 | ||
| a) Gegenstand der Zukunf tsver antwortung | 182 | ||
| b) Rechtskonstruktive Möglichkeiten | 183 | ||
| 2. Demokratie | 183 | ||
| 3. Planungsgrundsätze | 186 | ||
| 4. Pflicht zum Umweltschutz | 189 | ||
| D. Zeitliche Grenzen staatlicher Verantwortung, Ergebnis | 191 | ||
| Thesen | 195 | ||
| Literaturverzeichnis | 198 |
