Die Finanzierung mittelständischer Unternehmungen in Deutschland
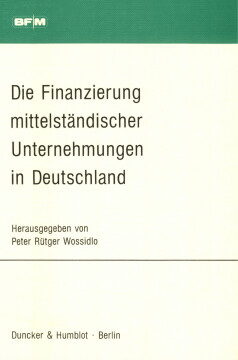
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Finanzierung mittelständischer Unternehmungen in Deutschland
1. Bayreuther Symposium für Betriebswirtschaft Bayreuth, 3.–4. März 1983
Editors: Wossidlo, Peter Rütger
(1985)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| 1. Bayreuther Symposiums für Betriebswirtschaft | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Prof. Dr. Peter Rütger Wossidlo: Die Finanzierungssituation mittelständischer Unternehmungen | 13 | ||
| A. Zur Bedarfslage | 15 | ||
| I. Die erhöhte Insolvenzanfälligkeit mittelständischer Unternehmungen | 15 | ||
| 1. Die Gruppe der mittelständischen Unternehmungen | 15 | ||
| 2. Die Insolvenzanfälligkeit | 17 | ||
| II. Die negative Entwicklung der Eigenkapitalquote | 20 | ||
| 1. Die Multifunktionalität des Eigenkapitals | 21 | ||
| 2. Der akzelerierte Eigenkapitalabbau in rezessiven Phasen | 22 | ||
| 3. Der Zusammenhang zwischen Eigenkapitalquote und Insolvenzanfälligkeit | 25 | ||
| 4. Der langfristige Trend zur Verringerung der Eigenkapitalquote | 27 | ||
| a) Die Darstellung der langfristigen Entwicklung | 27 | ||
| b) Die Ursachen der langfristigen Entwicklung | 30 | ||
| B. Zur Versorgungslage | 37 | ||
| I. Die quantitative Entwicklung des Beteiligungsmarktes | 37 | ||
| 1. Die Kapitalanbieterstruktur | 37 | ||
| a) Institutionelle Anbieter | 37 | ||
| b) Private Anleger | 39 | ||
| c) Staatliche Anbieter | 40 | ||
| 2. Der Umfang des Kapitalangebotes | 41 | ||
| II. Die qualitative Entwicklung des Beteiligungsmarktes | 42 | ||
| 1. Direkte versus indirekte Beteiligung | 43 | ||
| 2. Offene versus stille Beteiligung | 44 | ||
| Anhang | 48 | ||
| Zinsbedingte Akzeleration der Eigenkapital-Auszehrung | 48 | ||
| A. Problemstellung | 48 | ||
| I. Ausgangssituation | 48 | ||
| II. Prämissen | 49 | ||
| III. Aufgabe | 50 | ||
| B. Aufgabenlösung | 50 | ||
| I. Tabellarische Entwicklung des Eigenkapitals | 50 | ||
| II. Tabellarische Entwicklung des Fremdkapitals | 50 | ||
| III. Analytische Ableitung der Verschuldung | 50 | ||
| IV. Berechnung des Überschuldungszeitpunktes (T) | 52 | ||
| C. Zusammenfassung | 55 | ||
| LITERATURVERZEICHNIS | 60 | ||
| Wolfram Gruhler: Aspekte der Eigenkapitalausstattung deutscher Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung der Unternehmensgröße, der Rechtsform und des Wirtschaftsbereichs | 63 | ||
| A. Befund | 65 | ||
| I. Zur Materiallage | 65 | ||
| 1. Allgemein | 65 | ||
| 2. Mittelstandsspezifisch | 66 | ||
| 3. International | 69 | ||
| II. Empirische Darstellung | 69 | ||
| 1. Stand und Entwicklung der vertikalen Eigenkapitalausstattung für “alle” Unternehmen | 69 | ||
| 2. Zur größenspezifischen Eigenkapitalausstattung und -entwicklung | 71 | ||
| 3. Zur sektoralen Eigenkapitalausstattung und -entwicklung | 73 | ||
| 4. Zur Eigenkapitalausstattung nach Rechtsform | 75 | ||
| III. Internationaler Überblick | 76 | ||
| B. Ursachen der Eigenkapitalauszehrung | 77 | ||
| I. Ertragsschwächung | 77 | ||
| II. Ursachen des Ertragsverfalls | 78 | ||
| C. Funktionen der Eigenkapitalbasis | 80 | ||
| I. Zur Frage der Angemessenheit | 80 | ||
| II. Bedeutung für unternehmerische Existenzfähigkeit und Flexibilität | 81 | ||
| Tabellenanhang | 86 | ||
| LITERATURVERZEICHNIS | 96 | ||
| Thomas Buch: Die Eigenmittelausstattung der Unternehmen | 97 | ||
| A. Der statistische Befund | 98 | ||
| I. Der langfristige Rückgang der Eigenmittelquote | 98 | ||
| II. Wichtige Determinanten für die Höhe der Eigenmittelquote | 98 | ||
| 1. “Rechtsformtypische” Einflüsse | 99 | ||
| 2. “Branchentypische” Einflüsse | 100 | ||
| 3. Einflüsse der Produktionstechnik | 101 | ||
| 4. Eigenmittelausstattung und Zinsbelastung | 102 | ||
| B. Die Unternehmensbilanzstatistik der Deutschen Bundesbank | 103 | ||
| I. Umfang und Repräsentationsgrad des verfügbaren Bilanzmaterials | 103 | ||
| II. Die Hochrechnung der Abschlußergebnisse | 103 | ||
| III. Die Streuung der Eigenmittelquoten | 104 | ||
| Volker Dolch: Aktuelle Finanzierungserfahrungen einer deutschen Elektronik-Unternehmung | 112 | ||
| A. Vorbemerkungen | 113 | ||
| B. Die Entwicklungsgeschichte | 113 | ||
| I. Die Entstehung | 113 | ||
| II. Der Markt | 113 | ||
| III. Die Entwicklung | 114 | ||
| IV. Die Finanzierung | 114 | ||
| C. Schlußbemerkungen | 116 | ||
| Peter Langendorf: Aktuelle Finanzierungserfahrungen einer deutschen Textil-Unternehmung | 118 | ||
| A. Zur Lage der Textilindustrie | 119 | ||
| B. Zur Umsatzentwicklung | 120 | ||
| C. Zur Notwendigkeit der Technologisierung | 122 | ||
| D. Zur Veränderung der Umfeldbedingungen | 123 | ||
| Dr. Karl Gerhard Schmidt: Die Funktionen des Eigenkapitals aus der Sicht der Unternehmungen und der Banken | 134 | ||
| A. Zur These der finanziellen Krise bundesdeutscher Unternehmungen | 136 | ||
| B. Die Frage nach dem angemessenen Eigenkapital | 137 | ||
| I. Zur Begriffsbestimmung und Charakterisierung des Eigenkapitals | 137 | ||
| II. Die Eigenkapitalausstattung der Unternehmungen | 139 | ||
| III. Anmerkungen zur Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten | 141 | ||
| 1. Der Begriff des haftenden Eigenkapitals | 142 | ||
| 2. Die Angemessenheit des haftenden Eigenkapitals im Lichte des KWG und der vom Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen aufgestellten Grundsätze | 143 | ||
| IV. Finanzierungsregeln im Urteil von Theorie und Praxis | 145 | ||
| C. Die Funktionen des Eigenkapitals | 147 | ||
| I. Das Prinzip der risikoentsprechenden Finanzierung | 148 | ||
| II. Das Eigenkapital als Schutz in Krisenzeiten | 148 | ||
| III. Das Eigenkapital zur Sicherung der Unabhängigkeit | 149 | ||
| IV. Das Eigenkapital als Maßstab für die Gewinn- und Verlustzuweisung | 149 | ||
| V. Die Haftungs- und Garantiefunktion des Eigenkapitals | 150 | ||
| VI. Das Eigenkapital als Basis für das Kreditpotential | 150 | ||
| D. Schlußbemerkung | 151 | ||
| LITERATURVERZEICHNIS | 153 | ||
| Dr. Walter Bergerhof: Die Anforderungen mittlerer Unternehmungen an Finanzierungsformen mit Eigenkapital | 156 | ||
| A. Kennzeichnung der Finanzierungssituation mittlerer Unternehmen | 157 | ||
| B. Anforderungen mittlerer Unternehmen an die Finanzierung | 158 | ||
| C. Entwicklungsmöglichkeiten der Mittelstandsfinanzierung in Deutschland | 161 | ||
| Wolfgang Arnold: Zur Diskussion über die Struktur der mittelständischen Eigenkapitalnachfrage | 164 | ||
| A. Eigenkapitalschwäche mittelständischer Unternehmungen | 166 | ||
| I. Empirische Belege zur Kapitalstruktur | 166 | ||
| II. Auswertung der empirischen Belege | 166 | ||
| III. Ursachen der Eigenkapitalentwicklung | 167 | ||
| B. Finanzierungserfahrungen mittelständischer Unternehmer | 169 | ||
| I. Darlegung der Ausgangspositionen | 169 | ||
| 1. Marktverhältnisse und Finanzierungsanlässe | 170 | ||
| 2. Anpassungsstrategien | 170 | ||
| II. Unkonventionelle Wege der Eigenkapitalbeschaffung | 171 | ||
| 1. Eigenkapitalaufnahme bei Kapitalbeteiligungsgesellschaften in Deutschland | 172 | ||
| 2. Eigenkapitalaufnahme bei Venture Capital-Gesellschaften in den USA | 173 | ||
| C. Banken als Partner der mittelständischen Unternehmungen | 174 | ||
| I. Möglichkeiten zur Bereitstellung von Eigenkapital | 174 | ||
| II. Beratungstätigkeit der Banken | 175 | ||
| III. Zukunftsorientierte Kreditwürdigkeitsbeurteilung | 175 | ||
| D. Anregungen zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung mittelständischer Unternehmungen | 176 | ||
| Prof. Dr. Jochen Sigloch: Der Einfluß der Besteuerung auf die Eigenkapitalbildung der Unternehmung | 179 | ||
| A. Problemstellung | 181 | ||
| B. Grundlagen | 182 | ||
| I. Finanzierungsformen | 182 | ||
| II. Abgrenzung der Belastungssphäre | 182 | ||
| III. Abgrenzung der Steuerarten | 185 | ||
| IV. Beurteilungsmaßstab | 185 | ||
| C. Einfluß der Besteuerung auf die Beteiligungsfinanzierung | 187 | ||
| I. Besteuerung der Zuführung von Beteiligungskapital | 188 | ||
| II. Laufende Besteuerung von Beteiligungskapital | 189 | ||
| 1. Sondersteuer „Gewerbesteuer“ | 189 | ||
| 2. Faktische Sondersteuer “Vermögensteuer” | 194 | ||
| 3. Besteuerungsunterschiede zwischen Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften | 198 | ||
| a) Besteuerungsunterschiede bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer | 198 | ||
| b) Besteuerungsunterschiede bei der Vermögensteuer | 199 | ||
| c) Besteuerungsunterschiede bei der Gewerbesteuer | 201 | ||
| III. Besteuerung der Rückzahlung von Beteiligungskapital | 202 | ||
| IV. Zwischenergebnis | 202 | ||
| D. Einfluß der Besteuerung auf die interne Eigenfinanzierung | 203 | ||
| I. Steuerwirkungen bei offener Selbstfinanzierung | 203 | ||
| II. Steuerwirkungen bei stiller Selbstfinanzierung | 207 | ||
| III. Steuerwirkungen bei Finanzierung aus steuerfreien Rücklagen | 208 | ||
| IV. Steuerwirkungen bei Umschichtungsfinanzierung | 209 | ||
| V. Zwischenergebnis | 209 | ||
| E. Ergebnisse und Folgerungen | 210 | ||
| I. Zusammenfassende Thesen | 210 | ||
| II. Folgerungen | 211 | ||
| ANHANG: | 214 | ||
| Symbolverzeichnis | 216 | ||
| LITERATURVERZEICHNIS | 217 | ||
| Dr. Ulrich Fritsch: Mittelständische Unternehmen – Kandidaten für die Börse? | 221 | ||
| A. Die Situation | 222 | ||
| B. Quantitative Merkmale für den Gang an die Börse | 222 | ||
| C. Qualitative Merkmale für den Gang an die Börse | 225 | ||
| D. Die Ausgestaltung der Emission | 226 | ||
| E. Die Einwände gegen die AG | 228 | ||
| I. Überfremdung | 228 | ||
| II. Publizität | 228 | ||
| III. Mitbestimmung | 229 | ||
| IV. Steuern | 231 | ||
| V. Kosten | 231 | ||
| F. Ergebnis | 233 | ||
| Bernd Ertl: Die Einführung mittelständischer Unternehmen an die Börse – Techniken und Erfahrungen– | 234 | ||
| A. Der Kapitalmarkt in den USA | 236 | ||
| B. Der deutsche Kapitalmarkt | 236 | ||
| I. Das Anlegerverhalten | 236 | ||
| II. Der institutionelle Rahmen | 237 | ||
| C. Voraussetzungen für den Gang an die Börse | 239 | ||
| I. Der Normalfall | 239 | ||
| II. Der Ausnahmefall | 241 | ||
| D. Wie man an die Börse geht | 241 | ||
| I. Die Unterlagen | 241 | ||
| II. Die Finanzierungsinstrumente | 242 | ||
| 1. Vorzugsaktien | 242 | ||
| 2. Stammaktien | 242 | ||
| 3. Genußscheine | 243 | ||
| III. Die Ermittlung des Emissionskurses | 243 | ||
| IV. Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft | 244 | ||
| V. Das Zeichnungsverfahren | 245 | ||
| VI. Der günstigste Emissionszeitpunkt | 245 | ||
| VII. Die Börseneinführung | 247 | ||
| VIII. Die Emissionskosten | 247 | ||
| E. Ausblick | 248 | ||
| Fritz Schwab: Das österreichische Beteiligungsmodell | 250 | ||
| A. Einführung | 251 | ||
| B. Das Beteiligungsfondsgeschäft | 252 | ||
| I. Allgemeines | 252 | ||
| II. Das Verfahren im Beteiligungsfondsgeschäft | 253 | ||
| 1. Der Genußschein | 254 | ||
| 2. Der Beteiligungsnehmer | 259 | ||
| 3. Die Beteiligungsfondsgesellschaft | 261 | ||
| C. Das Treuhandgeschäft | 262 | ||
| D. Erfahrungen mit den bisherigen Fonds in Österreich | 263 | ||
| E. Vorschau | 264 | ||
| Rainer Schwarz: Zur Diskussion über die Möglichkeiten zur Schaffung eines organisierten Marktes des Eigenkapitals | 266 | ||
| A. Beteiligungsmarkt als Untersuchungsobjekt | 268 | ||
| B. Traditionelle Institutionen zur Beteiligungskapitalversorgung | 268 | ||
| I. Beitrag der Börse | 268 | ||
| II. Rolle der deutschen Banken | 269 | ||
| C. Gesetzliche Rahmenbedingungen des Beteiligungsmarktes | 270 | ||
| I. Steuerliche Behandlung der Beteiligungsfinanzierung | 270 | ||
| II. Impulse durch das Vermögensbildungsgesetz | 271 | ||
| III. Publizitätspflichten und Publizitätschancen | 271 | ||
| 1. Publizität zum Schutz der Anleger | 272 | ||
| 2. Publizität als Instrument zur Öffentlichkeitsarbeit der Unternehmen | 272 | ||
| D. Alternativen zum bestehenden Beteiligungsmarkt | 273 | ||
| I. Neue Organisationsformen für den Beteiligungshandel | 273 | ||
| 1. Innerbetriebliche Börse | 273 | ||
| 2. Regional begrenzter Markt des kleinen Eigenkapitals | 273 | ||
| II. Im Ausland praktizierte Finanzierungsvarianten | 274 | ||
| 1. Beteiligungsfonds-Gesellschaften in Österreich | 274 | ||
| 2. Schweizer Modell der kleinen Aktiengesellschaft | 275 | ||
| 3. Small Business Investment Companies in den USA | 275 | ||
| III. Mittelstandsgerechte Beteiligungsinstrumente | 276 | ||
| 1. Fungible KG-Anteile und GmbH-Anteile | 276 | ||
| 2. Stimmrechtslose Vorzugsaktien | 276 | ||
| 3. Genußscheine–Finanzierungsinstrumente ohne Mitgliedschaftsrechte | 277 | ||
| Dr. Rupert Pfeffer: Die anlagesuchenden Kapitalströme – Ansätze zur Nutzung für die mittelständische Wirtschaft | 279 | ||
| A. Zur Entwicklung der Finanzlage und der Investitionstätigkeit mittlerer Unternehmen | 280 | ||
| B. Zur Existenz anlagesuchender Kapitalströme | 283 | ||
| C. Lösungsansätze zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung | 290 | ||
| D. Zur Bedeutung steuerlicher Anreize für Anleger | 294 | ||
| Dr. Siegfried C. Cassier: Die spezifischen Finanzierungsmöglichkeiten der mittelständischen Unternehmungen | 298 | ||
| A. Ansatzpunkte für Verbesserungen der Eigenkapitalausstattung | 299 | ||
| B. Langfristiges Fremdkapital als Eigenkapitalersatz? | 304 | ||
| C. Die Deckung des Konsolidierungsbedarfs als aktuelles Hauptproblem | 307 | ||
| D. Verbesserungsmöglichkeiten bei den Rahmendaten für langfristige Unternehmenskredite | 309 | ||
| E. Verstärkung der Eigenkapitalähnlichkeit von langfristigen Krediten | 311 | ||
| Prof. Dr. Wolfgang Gerke: Die Akzeptanz der Kapitalbeteiligungsgesellschaft im Mittelstand | 314 | ||
| A. Das Umfeld der Beteiligungsfinanzierung mittelständischer Unternehmen | 316 | ||
| I. Gründerzeit ohne Akzeptanzprobleme | 316 | ||
| II. Das Versagen der Banken bei der Risikokapitalbereitstellung für mittelständische Unternehmen | 317 | ||
| B. Das Akzeptanzparadoxon | 318 | ||
| I. Das erste Akzeptanzproblem | 318 | ||
| II. Das zweite Akzeptanzproblem | 319 | ||
| C. Die Ursachen der Akzeptanzprobleme und deren Beseitigung | 320 | ||
| I. Akzeptanzprobleme durch Zukunftsängste | 320 | ||
| II. Niedriger Marktanteil der Kapitalbeteiligungsgesellschaften | 321 | ||
| III. Fehler in der Vertragspolitik der Kapitalbeteiligungsgesellschaften | 323 | ||
| 1. Fehlendes Risikoäquivalent durch Ertragsbeschränkungen | 323 | ||
| 2. Negative Portefeuilleselektion durch Kündigungsrechte | 325 | ||
| 3. Mangelnde Diversifikation | 324 | ||
| IV. Mangelnde Kooperation zwischen Kreditwirtschaft und Kapitalbeteiligungsgesellschaften | 325 | ||
| V. Fehler in der Finanzierungspolitik der Mittelstandsunternehmen | 327 | ||
| 1. Die Vernachlässigung der Kapitalstrukturrisiken | 327 | ||
| 2. Zu hohe Bewertung der Überfremdungsgefahr | 328 | ||
| D. Externe Maßnahmen zur Akzeptanzverbesserung | 329 | ||
| I. Die Übertragung des Investmentgedankens auf die Kapitalbeteiligungsgesellschaften | 329 | ||
| II. Die Einbeziehung der Kapitalbeteiligungsgesellschaften in die Maßnahmen zur Förderung der Vermögensbildung | 331 | ||
| III. Börseneinführung über Kapitalbeteiligungsgesellschaften | 332 | ||
| LITERATURVERZEICHNIS | 334 | ||
| Karl-Heinz Fanselow: Zu Innovationen gehört Eigenkapital – Wie sich die WFG an mittelständischen Unternehmen beteiligt | 337 | ||
| A. Zur Geschäftsentwicklung der WFG | 338 | ||
| B. Zur Portfolio-Politik der WFG | 340 | ||
| C. Zu den Problemen beim Beteiligungshandel | 342 | ||
| Dr. Klaus Nathusius: Das Venture Capital–Eine Variante der Unternehmensfinanzierung | 345 | ||
| A. Venture Capital–ein Schlagwort? | 347 | ||
| B. Definition und Abgrenzung | 348 | ||
| I. Ausprägungen des Venture Capital | 349 | ||
| 1. “Seed-Capital” | 349 | ||
| 2. Gründungsfinanzierung | 349 | ||
| 3. Wachstumsfinanzierung junger Unternehmen | 350 | ||
| 4. “Management-Buy-outs” und “Turn-arounds” | 350 | ||
| 5. Brücken-Finanzierung | 350 | ||
| II. Lebenszyklusbetrachtung | 351 | ||
| III. Wesentliche Merkmale des Venture Capital | 352 | ||
| C. Venture Capital-Zyklus | 353 | ||
| D. Venture Capital-Ansätze | 355 | ||
| I. Direkte Beteiligungen | 355 | ||
| II. Indirekte Beteiligungen | 356 | ||
| 1. Fonds-orientierte Ansätze | 356 | ||
| 2. Projekt-orientierte Ansätze | 357 | ||
| E. Stand der Venture Capital-Finanzierung | 357 | ||
| I. USA | 357 | ||
| III. Deutschland | 360 | ||
| F. Chancen der Zukunft | 360 | ||
| Walter Ruda: Zur Diskussion über die Struktur der Kapitalangebotsseite für die mittelständische Wirtschaft | 362 | ||
| A. Einführung | 364 | ||
| B. Verhalten der Kapitalanleger | 364 | ||
| I. Anlage am “grauen Kapitalmarkt” | 364 | ||
| II. Anlage in festverzinslichen Wertpapieren | 365 | ||
| C. Langfristiger Industriekredit als Finanzierungsinstrument | 365 | ||
| I. Reformbedürftige gesetzliche Kündigungsoption | 365 | ||
| II. Vereinbarung ertragsbezogener Zinssätze | 366 | ||
| D. Institutionalisierung von Kapitalsammelstellen zur Beteiligungsfinanzierung | 367 | ||
| I. Notwendigkeit zur Risikostreuung | 368 | ||
| II. Bankennähe von Kapitalsammelstellen | 368 | ||
| 1. Zukunftsorientierte Beteiligungswürdigkeitsprüfung | 369 | ||
| 2. Akzeptanzprobleme bei der Beteiligungsfinanzierung | 369 | ||
| E. Innovationsfinanzierung–Bereitstellung von Risikokapital | 370 | ||
| I. Bewertung des Innovationserfolges | 371 | ||
| II. Steuerliche Anreize | 371 | ||
| 1. Innovationsfinanzierungsgesellschaft | 371 | ||
| 2. Business Start-up Scheme | 372 | ||
| III. Venture Capital als Finanzierungsvariante | 372 | ||
| 1. Grundmodell des Venture Capital | 372 | ||
| 2. Aufnahmefähigkeit des Risikokapitalmarktes | 373 | ||
| 3. Eigenkapitalversorgung durch Venture Capital-Gesellschaften | 374 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 375 | ||
| Autorenverzeichnis | 379 |
