Finanzmanagement auf Basis von Expertensystemen
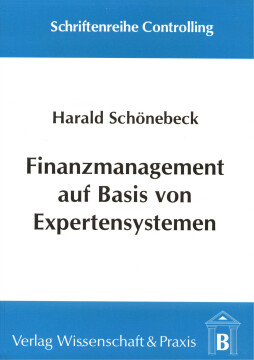
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Finanzmanagement auf Basis von Expertensystemen
Ein systemorienierter Ansatz zur wissensbasierten Informationsversorgung
Schriftenreihe Controlling, Vol. 4
(1994)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Expertensysteme bieten gegenüber der algorithmischen Massendatenverknüpfung den Vorteil, daß mit ihnen komplexe Problemsituationen anhand variabler Problemkriterien analysierbar sind. Häufig ist jedoch die Entwicklung leistungsfähiger Analyse- und Diagnosesysteme mit beträchtlichen Schwierigkeiten verbunden. Aufgrund der informatischen Systemcharakteristik kommt insbesondere der Formulierung und Abbildung des relevanten Fachgebietswissens eine gesteigerte Bedeutung zu. Inwieweit die Probleme des betrieblichen Finanzmanagements zukünftig auf der Grundlage der Expertensystemtechnologie lösbar sein werden, hängt wesentlich davon ab, ob die Integration der finanziellen Führungsaufgaben und Entscheidungsprozesse im Rahmen eines einheitlichen Verarbeitungsmodells gelingt. Die vielfältigen Funktions- und Datenbeziehungen zwischen den finanziellen Elementaraufgaben müssen in eine hierarchische Wissensstruktur überführt werden. Den Ausgangspunkt bildet die Definition des Finanzmanagements als rekursives Steuerungsmodell. Vor diesem Hintergrund liefert die vorliegende Arbeit einen entscheidungs- und informationssystemorientierten Ansatz zum betrieblichen Finanzmanagement mit seinen informationellen Grundlagen, seinen Datenquellen, Problemlösungsmethoden und Verarbeitungsfunktionen. Aus dem Inhalt: Expertensystemtechnologie als Schlüssel zur intelligenten Informationsverarbeitung, Anwendbarkeit von Expertensystemen in der Unternehmensführung, Konzeption eines Expertensystems für das Finanzmanagement.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | |||
| Inhaltsverzeichnis | I | ||
| Abkürzungsverzeichnis | VII | ||
| Abbildungsverzeichnis | XIII | ||
| A. Einleitung | 1 | ||
| 1. Einführung in die Problemstellung | 1 | ||
| 2. Zielsetzung | 2 | ||
| 3. Methodisches Vorgehen | 4 | ||
| B. Die Expertensystemtechnologie als Schlüssel zur intelligenten Informationsverarbeitung | 5 | ||
| 1. Die Idee der Künstlichen Intelligenz | 5 | ||
| 1.1 Definitions- und Anwendungsbereich | 5 | ||
| 1.2 Historische Entwicklung der KI-Forschung | 9 | ||
| 1.3 Die Expertensystemtechnologie | 13 | ||
| 1.3.1 Definitorische Einordnung | 13 | ||
| 1.3.2 Der Systemcharakter | 16 | ||
| 1.3.3 Die Wissensbasierung | 16 | ||
| 1.3.4 Entscheidungsunterstützung und Problemorientierung | 17 | ||
| 1.3.5 Anwendung schlußfolgernder Verknüpfungen | 18 | ||
| 2. Abgrenzung der Expertensystemtechnologie von der traditionellen Datenverarbeitung | 19 | ||
| 2.1 Hardwareanforderungen der Künstlichen Intelligenz | 19 | ||
| 2.2 Spezifische Software der Künstlichen Intelligenz | 21 | ||
| 2.3 Von der Datenverarbeitung zur Wissensverarbeitung | 24 | ||
| 2.3.1 Wissensverknüpfung versus Prozeßlösung | 24 | ||
| 2.3.2 Objektorientierung | 25 | ||
| 2.3.3 Trennung von Fakten und Regeln | 26 | ||
| 2.3.4 Zusammenhang von Problem- und Programmstruktur | 27 | ||
| 2.3.5 Modularisierung von Fachwissen | 28 | ||
| 2.3.6 Notwendigkeit der permanenten Programmsteuerung | 28 | ||
| 2.3.7 Das Kommunikationsmodell eines Expertensystems | 29 | ||
| 3. Aufbau und Arbeitsweise von Expertensystemen | 30 | ||
| 3.1 Der Begriff der Systemarchitektur | 30 | ||
| 3.2 Die Wissensbasis | 32 | ||
| 3.2.1 Wissensbegriff und Wissensarten | 32 | ||
| 3.2.2 Wissenserwerb und Wissensmodell | 35 | ||
| 3.2.3 Methoden der Wissensrepräsentation | 39 | ||
| 3.2.3.1 Die Grundform der Prädikatenlogik | 39 | ||
| 3.2.3.2 Semantische Netze | 40 | ||
| 3.2.3.3 Objekt-Attribut-Wert-Tripel | 42 | ||
| 3.2.3.4 Frames | 42 | ||
| 3.2.3.5 Produktionsregeln | 44 | ||
| 3.2.3.6 Vages Wissen | 48 | ||
| 3.3 Die Problemlösungskomponente (Inferenzkomponente) | 55 | ||
| 3.3.1 Inferenz und Problemlösung | 55 | ||
| 3.3.2 Arten von Inferenz | 57 | ||
| 3.3.2.1 Der Modus Ponens | 57 | ||
| 3.3.2.2 Monotone und nicht-monotone Inferenz | 58 | ||
| 3.3.3 Suchstrategien | 59 | ||
| 3.3.3.1 Vorwärtsverkettung | 59 | ||
| 3.3.3.2 Rückwärtsverkettung | 61 | ||
| 3.3.3.3 Tiefe-zuerst-Suche und Breite-zuerst-Suche | 62 | ||
| 3.3.3.4 Konfliktlösungsmechanismen | 63 | ||
| 3.4 Die Dialogkomponente | 65 | ||
| 3.4.1 Der Benutzerdialog im engeren Sinne | 65 | ||
| 3.4.2 Der Benutzerdialog im weiteren Sinne | 66 | ||
| 3.4.3 Informatische Dialogschnittstellen | 67 | ||
| 3.5 Die Erklärungskomponente (Wissensbeschreibung) | 69 | ||
| 3.6 Die Lernkomponente | 70 | ||
| 4. Klassifikation von Expertensystemen | 71 | ||
| 4.1 Die Klassifizierungsproblematik | 71 | ||
| 4.2 Leistungstypen von Expertensystemen | 73 | ||
| 5. Implementierung von Expertensystemen | 77 | ||
| 5.1 Definition des Projektmanagements | 77 | ||
| 5.2 Aufstellung des Projektteams | 80 | ||
| 5.3 Das Phasenkonzept als Grundlage der Projektdurchführung | 81 | ||
| 5.3.1 Suchfeldanalyse und Zielfestlegung | 81 | ||
| 5.3.2 Problembeschreibung und Projektdefinition | 82 | ||
| 5.3.3 Alternativensuche und -bewertung | 83 | ||
| 5.3.4 Projektrealisierung | 84 | ||
| 5.3.4.1 Knowledge Engineering | 84 | ||
| 5.3.4.2 Prototyping und Entscheidung über Einsatz und Ausbau | 86 | ||
| 5.3.4.3 Systemeinführung und Ausbildung der Anwender | 87 | ||
| 5.4 Barrieren bei der Systementwicklung | 88 | ||
| 5.4.1 Die Benutzerakzeptanz | 88 | ||
| 5.4.2 Der Experte als Engpaß | 89 | ||
| 5.4.3 Das “engineering gap” | 90 | ||
| 5.4.4 Technologische und sachlogische Barrieren | 91 | ||
| 5.4.5 Das Beharrungsvermögen der klassischen EDV-Lösungen | 92 | ||
| 6. Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von Expertensystemen | 94 | ||
| 6.1 Die Bewertungsproblematik | 94 | ||
| 6.2 Die Kosten-Nutzen-Analyse | 96 | ||
| 6.2.1 Nutzeneffekte | 96 | ||
| 6.2.2 Kosteneffekte | 98 | ||
| C. Zur Anwendbarkeit von Expertensystemen in der Unternehmensführung | 102 | ||
| 1. Grundbedingungen expertensystemgestützter Unternehmensführung | 102 | ||
| 1.1 Der Wandel des betriebswirtschaftlichen Bezugsrahmens | 102 | ||
| 1.1.1 Betriebswirtschaftslehre als evolutionäre Wissenschaft | 102 | ||
| 1.1.2 Der entscheidungsorientierte Ansatz | 103 | ||
| 1.1.3 Der führungssystemorientierte Ansatz | 106 | ||
| 1.1.4 Der betriebswirtschaftliche Systemansatz | 107 | ||
| 1.2 Die Modellorientierung der Betriebswirtschaftslehre | 112 | ||
| 1.2.1 Modellbegriff und Modellarten | 112 | ||
| 1.2.2 Modellsprachen | 116 | ||
| 1.2.3 Modellintegration | 118 | ||
| 1.3 Die Unternehmung als Informationsverarbeitungssystem | 119 | ||
| 1.3.1 Information als Produktionsfaktor | 119 | ||
| 1.3.2 Dynamische Informationsverarbeitung | 120 | ||
| 1.3.3 Wissensgenerierung | 121 | ||
| 1.4 Die Entwicklung der Informationstechnologie im Management | 122 | ||
| 2. Organisatorische Konsequenzen des expertensystemgestützten Managements | 128 | ||
| 2.1 EDV-Organisation als Führungsaufgabe | 128 | ||
| 2.2 Organisatorische Erweiterung der Systemkommunikation | 130 | ||
| 2.3 Veränderte Aufgabenhierarchien und Delegationsspielräume | 132 | ||
| 2.4 Informationsverdichtung im middle-management | 134 | ||
| 3. Betriebliche Managementbereiche und deren Eignung für den Expertensystemeinsatz | 135 | ||
| 3.1 Analyse geeigneter Anwendungsgebiete | 135 | ||
| 3.2 Ansätze zur Eignungsbestimmung | 136 | ||
| 3.2.1 Deskriptiv-enumerativer Ansatz | 136 | ||
| 3.2.2 Induktiv-empirischer Ansatz | 138 | ||
| 3.2.3 Funktional-analytischer Ansatz | 140 | ||
| 3.2.4 Normativ-synthetischer Ansatz | 142 | ||
| 3.3 Kurzbeschreibung existierender Systemlösungen und Prototypen | 145 | ||
| 3.3.1 Abgrenzung des Beschreibungsfeldes | 145 | ||
| 3.3.2 Expertensysteme für die Unternehmensbewertung | 145 | ||
| 3.3.3 Expertensysteme zur Erstellung des Jahresabschlusses | 147 | ||
| 3.3.4 Systeme für die Unterstützung der Jahresabschlußanalyse | 148 | ||
| 3.3.4.1 Expertisen zur Jahresabschlußanalyse | 148 | ||
| 3.3.4.2 Funktionsweise der einzelnen Analysemodule | 152 | ||
| 3.3.5 Expertensysteme zur Unterstützung des Controlling | 153 | ||
| 3.3.5.1 Grundlagen von Expertensystemen im Controlling | 153 | ||
| 3.3.5.2 Kurzbeschreibung von CONTREX | 153 | ||
| 3.3.5.3 Kurzbeschreibung von CEUS | 155 | ||
| D. Die Konzeption eines Expertensystems für das Finanzmanagement | 156 | ||
| 1. Grundlagen des expertensystemgestützten Finanzmanagements | 156 | ||
| 1.1 Abschätzung der Systemeignung | 156 | ||
| 1.2 Inhalte und Aufgaben des betrieblichen Finanzmanagements | 160 | ||
| 1.3 Die interne und die externe Sichtweise der finanziellen Führung | 163 | ||
| 1.4 Die Organisation des systemgestützten Finanzmanagements | 165 | ||
| 1.4.1 Die Aufgabenverteilung zwischen Treasuring und Controlling | 165 | ||
| 1.4.2 Die Controllingfunktion des systemgestützten Finanzmanagements | 166 | ||
| 1.4.3 Die Integration von Treasuring und Finanzcontrolling | 168 | ||
| 1.5 Das Kommunikationsmodell des Finanzmanagements | 170 | ||
| 1.5.1 Der originäre Ansatz | 170 | ||
| 1.5.2 Der derivative Ansatz | 171 | ||
| 1.5.3 Der simultane Ansatz | 171 | ||
| 1.5.4 Der rekursive Ansatz | 172 | ||
| 2. Die verrichtungsorientierte Ableitung eines finanzwirtschaftlichen Wissensmodells | 173 | ||
| 2.1 Die Problematik der Modellbildung | 173 | ||
| 2.2 Das Phasenkonzept des Finanzmanagements | 174 | ||
| 2.2.1 Finanzplanung | 174 | ||
| 2.2.2 Finanzdisposition und Liquiditätssteuerung | 177 | ||
| 2.2.3 Finanzkontrolle | 178 | ||
| 2.3 Das Verrichtungskonzept des Finanzmanagements | 182 | ||
| 2.3.1 Regelmäßige Verrichtungstätigkeiten der finanziellen Führung | 182 | ||
| 2.3.1.1 Strukturelle Liquiditätssicherung | 182 | ||
| 2.3.1.2 Situative Liquiditätssicherung | 183 | ||
| 2.3.1.3 Haltung der Liquiditätsreserve | 185 | ||
| 2.3.2 Unregelmäßig auftretende Tätigkeiten der finanziellen Führung | 187 | ||
| 2.3.2.1 Unterdeckungsfinanzierung | 187 | ||
| 2.3.2.2 Liquiditätssicherung im Krisenfall | 189 | ||
| 3. Die Integration des finanzwirtschaftlichen Domänenwissens | 192 | ||
| 3.1 Die Problematik der Wissensintegration | 192 | ||
| 3.2 Kriterien der finanzwirtschaftlichen Systemintegration | 194 | ||
| 3.2.1 Führungsintegration | 194 | ||
| 3.2.2 Phasenhomogenisierung | 195 | ||
| 3.2.3 Daten- und Methodenvereinheitlichung | 199 | ||
| 3.2.4 Schnittstellenspezifizierung | 203 | ||
| 4. Die Definition des Benutzermodells auf Basis des finanzwirtschaftlichen Instrumentariums | 207 | ||
| 4.1 Überblick über die Module der Systemkonzeption | 207 | ||
| 4.2 Das Modul der strategischen Kapitalbindungsplanung | 211 | ||
| 4.3 Das Modul der mehrjährigen Finanzstrukturplanung | 217 | ||
| 4.3.1 Jahresabschlußplanung | 217 | ||
| 4.3.2 Kennzahlenplanung | 222 | ||
| 4.3.3 Cash Flow-Planung | 229 | ||
| 4.3.4 Strukturelle Finanzflußplanung | 232 | ||
| 4.4 Das Modul der operativen Finanzplanung | 237 | ||
| 4.4.1 Der einjährige Finanzplan als Integrationsinstrument | 237 | ||
| 4.4.2 Liquiditätsorientierte Staffelrechnungen und Tabellenplanungen | 239 | ||
| 4.4.3 Finanzprognoserechnung | 243 | ||
| 4.5 Das Modul der Finanzdisposition | 248 | ||
| 4.6 Das Modul der Finanzkontrolle | 249 | ||
| 5. Das Funktionsmodell des Expertensystems | 252 | ||
| 5.1 Die objektorientierte Datenintegration | 252 | ||
| 5.2 Die finanzielle Dispositionsebene als Systemeinstieg | 254 | ||
| 5.3 Die regelgestützte Faktenverknüpfung des Dispositionswissens | 260 | ||
| 5.4 Die strukturorientierte Diagnose kurzfristiger Steuerungsspielräume | 263 | ||
| E. Schlußbetrachtung | 268 | ||
| Literaturverzeichnis | 270 |
